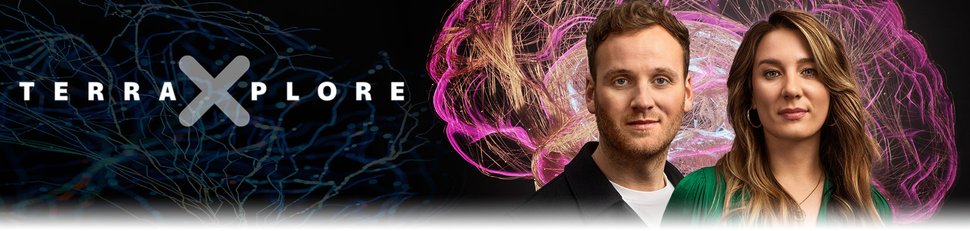98. Der Kampf mit den Kilos
Folge 98 (30 Min.)Torsten Prix kämpft mit Binge-Eating: Über 250 Kilo, Essen als Bewältigung. Psychologe Leon Windscheid erklärt, warum Maß schwerfällt und wie eng Ernährung und Psyche verbunden sind. Prix beschreibt Essen als Freund und Feind zugleich. Neurologin Sharmili Edwin Thanarajah zeigt, wie fettige und süße Nahrung das Belohnungssystem verändert. So beeinflussen sich Psyche und Essverhalten gegenseitig in einem oft unbemerkten Kreislauf. Ernährungspsychologe Adrian Meule betont, dass suchtähnliches Essverhalten zwar Parallelen zu Abhängigkeiten aufweise, Betroffene aber nicht vorschnell als esssüchtig bezeichnet werden sollten, um Stigmatisierung zu vermeiden.Essstörungen entstehen durch ein komplexes Zusammenspiel psychologischer, biologischer und sozialer Faktoren. Zudem erklärt Lebensmittelchemiker Guido Ritter, wie die Lebensmittelindustrie Produkte gezielt so gestaltet, dass sie durch Aussehen, Geruch, Geschmack und Textur besonders attraktiv wirken und Bedürfnisse auslösen. Dadurch essen viele Menschen häufiger und unbewusster, weil solche Lebensmittel das Belohnungssystem stark aktivieren. Das Zusammenspiel aus individueller Anfälligkeit und industriellen Strategien beeinflusst unser Essverhalten tiefgreifend und kann zu Kontrollverlust führen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 15.02.2026 ZDF 99. Jan Ullrich: Topleistung trotz Depression
Folge 99 (30 Min.)Psychologe Leon Windscheid (l.) und der ehemalige Radrennprofi Jan Ullrich (r.) auf einer gemeinsamen Fahrradtour.Bild: ZDF und Marius FuchtmannDepression hat viele Gesichter: Manche Menschen funktionieren nach außen perfekt, sind innerlich aber leer. „Terra Xplore“ fragt, was hinter der sogenannten hochfunktionalen Depression steckt. Psychologe Leon Windscheid trifft den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich. Der Tour-de-France-Sieger erzählt von Leistungsdruck, dem Absturz nach der Karriere und warum er zu lange wartete, sich Hilfe zu holen. Heute spricht er offen über seine Depressionen. Einige Betroffene können ihre Traurigkeit oder innere Leere besonders gut verbergen. Die Ursachen liegen oft in der eigenen Biografie: Wer früh lernt, immer stark zu sein, übersieht eigene Gefühle, erklärt Psychologin Prof. Eva-Lotta Brakemeier von der Universität Greifswald.Im Netz zirkulieren Begriffe wie Smiling Depression oder hochfunktionale Depression, die Betroffene beschreiben, aber keine offiziellen Diagnosen darstellen. Von Prof. Ulrich Hegerl, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, erfährt Leon Windscheid, wie solche Zuschreibungen wissenschaftlich einzuordnen sind, warum sie zugleich helfen und schaden können. Und weshalb Aufklärung wichtig ist, um Depressionen früher zu erkennen und offen darüber zu sprechen. Das Ziel: viel Verständnis für Betroffene und weniger Stigmatisierung zu erreichen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mo. 09.03.2026 ZDF 100. Gemeinsam aus der Depression
Folge 100 (15 Min.)Im Sozialexperiment spricht Psychologe Leon Windscheid (r.) mit den Teilnehmenden über Depression und wie unterschiedlich diese Erkrankung aussehen kann und vor welche Herausforderung sie die Menschen stellt.Bild: ZDF und Marius FuchtmannMillionen Menschen erkranken in Deutschland im Laufe ihres Lebens an einer Depression. Nach außen funktionieren manche noch perfekt, obwohl sie innerlich leer sind. Im Sozialexperiment zu hochfunktionaler Depression spricht Leon Windscheid mit Betroffenen. Die Folge zeigt, wie unterschiedlich Depressionen erlebt werden und warum Offenheit wichtig ist. Was alle Teilnehmenden vereint, ist der Wunsch, sich auszutauschen, um anderen Mut zu machen. Denn niemand muss in einem seelischen Tief alleine bleiben. Es gibt Wege, die aus der Depression führen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Mo. 09.03.2026 ZDF 101. Christian und Felix Neureuther: Was macht gute Väter aus?
Folge 101 (20 Min.)Ski-Legende Christian Neureuther (r.) war für seinen Sohn Felix (l.) immer Vorbild und Begleiter – nicht nur im Sport, sondern vor allem im Leben. Heute ist Felix (41) selbst vierfacher Vater.Bild: Anna Wagner / ZDFWann ist ein Vater ein guter Vater? Was geben Männer weiter, wenn sie Väter werden? Psychologe Leon Windscheid sucht mit den Skilegenden Christian und Felix Neureuther nach Antworten. Christian (76) war für seinen Sohn stets Vorbild und Begleiter. Heute ist Felix (41) selbst vierfacher Vater und gibt Werte wie Familie, Zusammenhalt und Verantwortung weiter – unterstützt von Christian. Eine Vater-Sohn-Bindung mit Nähe und Vertrauen. Wissenschaftliche Einblicke geben Bindungs- und Väterforscher: Sie zeigen, wie sich Vatersein psychologisch, soziologisch und neurobiologisch auswirkt. Welche Rolle spielt die Bindung? Unterscheiden sich Väter und Mütter in ihrem Verhalten? Was läuft schon gut – und wo braucht es noch Veränderungen? (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Do. 12.03.2026 ZDF 102. Vater und Kind – eine Bindung, die das Leben prägt?
Folge 102 (25 Min.)Psychologe Leon Windscheid (M.) spricht mit Teilnehmenden des Sozialexperiments über ihre Vater-Kind-Beziehungen.Bild: Marius Fuchtmann / ZDFEine liebevolle Eltern-Kind-Bindung schenkt Kindern Vertrauen, Halt und den Mut, ihre Welt zu entdecken. Väter hinterlassen durch Nähe, echtes Engagement und tägliches Vorbild tiefe Spuren. Sie können die Entwicklung stärken und Resilienz wachsen lassen. In einem Studioexperiment geht Psychologe Leon Windscheid der Frage nach, was Vatersein heute heißt: Nähe, Distanz, Verantwortung – oder auch Vorwürfe? Persönliche Geschichten von Vätern, Töchtern und Söhnen machen deutlich, wie vielfältig Vaterschaft gelebt und erlebt wird. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Do. 12.03.2026 ZDF 103. Schocktherapie gegen Rassismus?
Folge 103 (15 Min.)1968 teilt die Lehrerin Jane Elliott ihre Klasse nach Augenfarbe – Blau gegen Braun. Psychologe Leon Windscheid zeigt, warum dieses pädagogische Experiment bis heute fasziniert.Bild: ZDF und Pascal GarbrechtRassismus im Klassenzimmer: Ein Unterricht wird zum Experiment gegen Diskriminierung. Eine Grundschullehrerin stellt die Frage, ob wir rassistische Denkmuster verlernen können. 1968 trennt die Lehrerin Jane Elliott ihre Schulklasse nach Augenfarben: Blau gegen Braun. In wenigen Minuten entstehen Macht, Ausgrenzung und Diskriminierung. Psychologe Leon Windscheid zeigt, was uns dieses radikale Schulexperiment bis heute lehrt. Das „Blue Eyes, Brown Eyes“-Experiment ist eines der bekanntesten Antirassismus-Experimente in der Schule. Jane Elliott wollte Rassismus, Vorurteile und Diskriminierung für Kinder erfahrbar machen – und löste eine Debatte über rassismuskritische Pädagogik aus.Leon Windscheid beleuchtet psychologische Mechanismen hinter Vorurteilen, wie den „Ingroup-Outgroup-Bias“ oder den „Stereotype Threat“. Der Bildungsforscher Prof. Dr. Karim Fereidooni zeigt, wie tief Rassismus bereits im Denken von Kindern verankert ist – und welche rassismuskritischen Bildungsansätze helfen, Diskriminierung abzubauen und rassistische Denkmuster nachhaltig zu verlernen. Die Reihe „Terra Xplore – Brain Projects“ beleuchtet weltberühmte Experimente, Diagnosen und Therapien. Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn fragt Psychologe Dr. Leon Windscheid: Was können wir aus diesen Geschichten für unsere eigene Psyche lernen – und warum wirken manche Methoden bis heute nach? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mo. 16.03.2026 ZDF 104. Sechs schizophrene Brüder – Die Familie Galvin
Folge 104 (15 Min.)12 Kinder, sechs mit Schizophrenie: Die Geschichte der Familie Galvin beleuchtet ein medizinisches Rätsel und zeigt, wie Stigma und Vorurteile psychische Erkrankungen verschärfen können. Frühe Warnzeichen, dramatische Verläufe: Vom ersten Auftreten der Schizophrenie im Hause Galvin über die harten Psychiatriepraktiken der 60er- und 70er-Jahre bis zur modernen Wissenschaft zeigt Leon Windscheid, wie die Diagnose die Familie prägte. Die „zweite Krankheit“ Hinter der perfekten Fassade kämpfen die Familienmitglieder mit rätselhaften Symptomen: Ein Sohn hört Stimmen, ein anderer wird im Wahn zur Gefahr.Wo liegen die Ursachen von Schizophrenie? Sind es unsere Gene, Umweltfaktoren oder gar die Erziehung? Psychiater Prof. Andreas Meyer-Lindenberg ordnet ein, wie sich das Verständnis psychischer Erkrankungen verändert hat – und warum Stigmatisierung bei Schizophrenie auch heute oft als „zweite Krankheit“ wirkt. Der Fall Galvin verdeutlicht, wie entscheidend frühe Behandlung, Aufklärung und Empathie sind und was wir alle gegen Vorurteile im Umgang mit psychischen Erkrankungen tun können. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mi. 25.03.2026 ZDF
Terra Xplore: Wochen-Vorschau
Hol dir jetzt die fernsehserien.de App