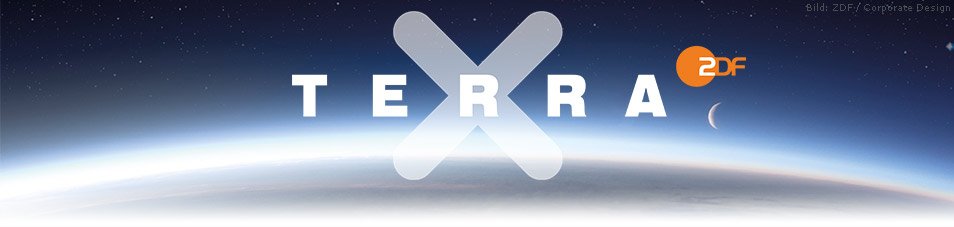1525 Folgen erfasst (Seite 21)
Geheimbünde: 1. Der Code der Illuminaten
45 Min.Seit Dan Browns Erfolgsroman „Illuminati“ ist der Geheimbund der Illuminaten einem Millionenpublikum bekannt. Im Mai 1776 in Ingolstadt gegründet, hatte sich der Geheimbund nichts weniger als die Veränderung der herrschenden Systeme auf die Fahne geschrieben. Der Gründervater Adam Weishaupt war ein angesehener Philosoph und Theologe, der nicht nur die erdrückenden Dogmen der Kirche, sondern auch die totalitäre Regierungsform seiner Zeit bekämpfte. Um dieses Ziel zu erreichen, wollten er und seine Mitverbündeten die herrschenden Gewalten Schritt für Schritt unterwandern und die entscheidenden Positionen im Machtgefüge durch Mitglieder ihrer Bruderschaft besetzen.Der Staat, von dem er träumte, sollte sich am Vorbild der alten Athener orientieren. Seine Ideen erwiesen sich als äußerst populär: Immer mehr Menschen schlossen sich den Illuminaten an. Viele Mitglieder hatten zuvor bereits anderen Geheimbünden angehört, wie den Freimaurern oder den Rosenkreuzern. Auch bei diesen Bruderschaften ging es um Veränderung, aber eher um die Verwandlung des Individuums in einen besseren Menschen. Die Mitgliedschaft bei den Illuminaten versprach einen aktiven Anteil bei der Gestaltung einer „neuen Weltordnung“, die anstelle der alten Systeme treten sollte. Als die Regierungsorgane davon Kenntnis bekamen, wurde der Geheimbund sofort bei Strafe verboten. Nur zehn Jahre operierte die von Weishaupt gegründete Bruderschaft. Doch bis heute halten sich Gerüchte, dass die „Erleuchteten“ noch immer existieren und ihre Ziele im Verborgenen weiter verfolgen. Etwa in Geheimbünden wie den „Skull and Bones“. Die Anfang des 19.Jahrhunderts gegründete, exklusive Studentenverbindung an der Yale Universität gehört zu den verschwiegensten Orden überhaupt. Ihr Hauptquartier trägt den bezeichnenden Namen „Gruft“. Zu ihren Mitgliedern zählen mindestens zwei ehemalige Präsidenten der USA und viele weitere einflussreiche Persönlichkeiten. Und tatsächlich gibt es eine enge Verbindung nach Deutschland. Die Rosenkreuzer, die damals so viele Mitglieder an die Illuminaten verloren, operieren bis heute ganz offen in vielen Ländern weltweit. Die Bewegung, die im frühen 17. Jahrhundert entstand, vertraute noch ganz den Prinzipien der Alchemie, der Umwandlung eines unedlen in einen edlen Stoff. Dieses Prinzip glaubten sie auch auf den Menschen anwenden zu können. Das Geheimnis um die dafür notwendigen Riten soll dem sagenhaften Gründer Christian Rosenkreuz von altägyptischen Priestern offenbart worden sein. Alle Organisationen, die sich auf den alten Rosenkreuzerorden berufen, haben bis heute eine stark esoterische Ausrichtung. „Terra X – Geheimbünde: Der Code des Illuminaten“ folgt den Spuren des legendären Illuminatenordens und erkundet dabei auch noch andere geheime Organisationen, die ihre Wurzeln angeblich in der Antike haben. Drei Folgen werden sonntags, 19:30 Uhr, ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 05.01.2014 ZDF Geheimbünde: 2. Die Erben der Templer
45 Min.Die Freimaurer sind die wohl zahlenmäßig größte geheime Bruderschaft der Welt. Mehr als vier Millionen Anhänger versammeln sich regelmäßig in ihren Tempeln und Logenhäusern. Ihre Grundideale sind Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Dass sich dennoch regelmäßig Verschwörungstheorien um den Geheimbund ranken, liegt an ihren zum Teil bizarr anmutenden Ritualen sowie der selbstauferlegten Geheimhaltungspflicht. Bis heute gelten die Freimaurer als eine undurchsichtige Gemeinschaft. Als die älteste Freimaurerloge Deutschlands im Juli 2012 zur 275-Jahrfeier in die Hamburger Michaeliskirche einlädt, kommen Gäste aus aller Welt.Zur Verständigung benötigen sie keine gemeinsame Sprache, denn die geheimen Zeichen der Bruderschaft sind überall auf der Welt gleich. Viele dieser Zeichen stammen wahrscheinlich noch aus den Anfängen der Bewegung, die in den Bauhütten der mittelalterlichen Kathedralen ihren Anfang nahm. Damals vollbrachten die Steinmetze in den Augen der Menschen beim Bau der gigantischen Kathedralen wahre Wunder. Als verschworene Gemeinschaft zogen sie von Baustelle zu Baustelle und teilten ihr Wissen lediglich untereinander. Weder der allmächtige Klerus, noch Staatsmänner oder Könige hatten einen Anteil daran. Wenn die Freimaurer unter sich waren, konnten sie frei über alles reden. So entstanden im Lauf der Zeit größere Diskussionsrunden, in die auch Nicht-Handwerker aufgenommen wurden. In den Logen kann man seine Meinung frei äußern, ohne Rücksicht auf soziale Unterschiede, denn hier ist theoretisch jeder Mensch gleich. Anwälte, Ärzte und Politiker zählen ebenso zu den „Brüdern“ wie Handwerker und Künstler. Ihr aller Ziel – so die offizielle Lesart – ist es, ein besserer Mensch zu werden. Wie lässt es sich dann aber erklären, dass ausgerechnet eine Loge der Freimaurer, die sogenannte Propaganda Due (P 2), in die Vorgänge um die Ermordung des Direktors der italienischen Banco Ambrosia, Roberto Calvi, verstrickt scheint? Seit der Gründung der ersten Loge im frühen 18. Jahrhundert wird immer wieder die Frage nach dem Grund für die strikte Geheimhaltung laut. Spricht das nicht dafür, dass der Geheimbund vielleicht doch etwas zu verbergen hat? Und was hat es mit den Anspielungen auf den Salomonischen Tempel in Jerusalem auf sich, die in jedem Tempel der Freimaurer zu finden sind? Könnte es gar eine Verbindung zu den sagenumwobenen Tempelrittern geben, wie manche vermuten? „Terra X: Geheimbünde – Die Erben der Templer“ begibt sich auf Spurensuche nach den historischen Wurzeln der Freimaurer, und spannt einen Bogen von den sagenumwobenen Tempelrittern des Mittelalters bis zur Gegenwart. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 12.01.2014 ZDF Geheimbünde: 3. Die Masken der Verschwörer
45 Min.Gelang es den Amerikanern tatsächlich, in den 1960er Jahren auf dem Mond zu landen, oder wurde dieses bahnbrechende Ereignis in der Wüste von Nevada inszeniert? Waren die Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 wirklich fanatische Muslime oder hatte nicht doch vielleicht die amerikanische Regierung ihre Hand im Spiel? Könnte Jesus Christus tatsächlich Nachkommen gehabt haben, wie von einigen Autoren spekuliert wird? Die Geschichte der Menschheit ist voll von Verschwörungstheorien. Hinter allem Geheimnisvollen, allem schwer Verständlichen oder nach menschlichem Ermessen Unvorstellbaren vermuten wir schnell einen vorsätzlichen Betrug.Oft scheint die erfundene Verschwörung sehr viel glaubhafter als die banale Wahrheit. Als der Amerikaner Bill Kaysing 1976 zum ersten Mal Zweifel an der Mondlandung äußerte und mehrere angeblich untrügliche Beweise dafür anführte, dass die NASA die Mondlandung nachgestellt habe, begannen auf einmal viele seiner Zeitgenossen an dieser Sternstunde der Raumfahrt zu zweifeln. Tatsächlich waren die Russen bei dem Wettlauf zum Mond den Amerikanern am Anfang weit überlegen. Doch dann gelingt es plötzlich den Yankees, diesen Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt zu setzen, während auch in den Folgejahren nicht ein einziger Kosmonaut auf dem Mond landen kann. Ging es dabei tatsächlich mit rechten Dingen zu, oder handelte es sich um ein Täuschungsmanöver der US-Regierung, die manche sogar als Drahtzieher hinter den Terroranschläge vom 11. September 2001 vermuten? Die Ereignisse dieses Tages haben sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Bis heute werden immer wieder Stimmen laut, die die offizielle Darstellung anzweifeln, zumal ein Teil der Untersuchungsakten noch immer unter Verschluss ist. So hält sich zum Beispiel das Gerücht, dass der Anschlag Teil der sogenannten jüdischen Weltverschwörung sei, als deren Beweis immer wieder die „Protokolle der Weisen von Zion“ herangezogen werden. Diese Protokolle sollen geheime Treffen einflussreicher Juden wiedergeben, die sich angeblich regelmäßig auf dem alten Friedhof in Prag treffen, um Pläne zur Übernahme der Weltherrschaft zu schmieden. Unter der Herrschaft der Nazis dienten sie als Rechtfertigung des millionenfachen Mordes. Längst weiß man, dass die Protokolle eine im Auftrag des zaristischen Geheimdienstes ausgeführte Fälschung sind, doch bis heute hält sich in vielen Teilen der Welt hartnäckig der Glaube an ihre Echtheit – und noch immer fordern sie unschuldige Opfer. „Terra X – Die Masken der Verschwörer“ begibt sich auf die Spuren einiger der berühmtesten Verschwörungstheorien der Moderne und stößt dabei auf Halbwahrheiten, dreiste Lügen, aber auch auf noch immer ungelöste Fragen. Letzte Folge der Reihe „Terra X: Geheimbünde“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 19.01.2014 ZDF Der Geheimcode der Maria Stuart
45 Min.George Lasry ist Informatiker und hat ein Programm entwickelt, das ihn bei der Entschlüsselung geheimer Symbole immerhin unterstützt. Auf diese Weise kam zumindest heraus, in welcher Sprache die geheimen Briefe verfasst waren.Bild: ZDF und GedeonDrei Codeknacker entdeckten und entschlüsselten geheime Briefe von Maria Stuart. Über 440 Jahre lagerten sie in der französischen Nationalbibliothek lagen, ohne dass jemand davon wusste. Es geht um 57 Dokumente aus der Feder der schottischen Königin, die in einer trickreichen Geheimschrift verfasst waren und die sie in englischer Gefangenschaft schrieb. „Terra X“ zeigt, wie ein Forschertrio den historischen Schriftstücken auf die Spur kam. Bereits im Frühjahr 2021 entdeckt der Astrophysiker und Hobby-Codeknacker Satoshi Tomokiyo aus Tokio zufällig mehrere Briefe aus dem 16. Jahrhundert in einem digitalen Archiv der französischen Nationalbibliothek.Hinweise auf Verfasser und Herkunft der Briefe aus unzähligen, oft nur knapp zwei Millimeter großen fremdartigen Zeichen kann er nicht finden. Erst in Zusammenarbeit mit zwei anderen leidenschaftlichen Hobby-Kryptologen – George Lasry, einem Computerexperten aus Tel Aviv, und Norbert Biermann, Professor an der Hochschule der Künste Berlin – gelingt in mühsamer und langwieriger Analyse und Symbol für Symbol eine Entschlüsselung. Es dauert ein Jahr, bis die drei Codeknacker den Inhalt der mysteriösen Briefe kennen. Sie machen weiter, und 2023 können sie mit absoluter Sicherheit die historische Sensation vermelden, woher die Schreiben stammen. Es handelt sich um 57 Dokumente, die Maria Stuart in ihrer Gefangenschaft verfasste. Sie sind entstanden in den Jahren 1578 bis 1584. Die schottische Königin, in ihrem Land in Ungnade gefallen, lebte eingesperrt durch Königin Elisabeth I. in englischen Burgen. Nur per Brief und Bote konnte sie mit ihren Unterstützern kommunizieren, vor allem mit dem französischen Botschafter in London. Maria Stuart betrieb auf diese Weise ihre Politik, mal klug, mal leichtsinnig, als Monarchin aus ihrer Welt hinter Gittern. Viele dieser Korrespondenzen sollten – unbemerkt von ihren Wächtern – an ihre Verbündeten im Ausland gelangen. Mit einem speziellen Geheimcode versehen und auf verschlungenen Wegen wurde die geheime Post nach draußen geschmuggelt. Die „Terra X“-Dokumentation zeigt den geradezu kriminalistischen Spürsinn, mit dem die drei Codeknacker den Briefen auf die Spur gekommen sind. Zugleich wird das Schicksal der schottischen Königin, ihre immer tiefere Verstrickung in Verschwörungen und der schicksalhafte Weg in ihr Ende auf dem Schafott nachgezeichnet. Welchen Stellenwert die gefunden Briefe haben, ist eine der großen Fragen, denen jetzt Historiker nachgehen. Immerhin handelt es sich um einen der bedeutendsten Abschnitte europäischer Geschichte des 16. Jahrhunderts, den Machtkampf zwischen zwei verwandten Herrscherinnen in einem von Religionskriegen zerrissenen Europa. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 28.12.2025 ZDF Der Geheimcode von Stonehenge
45 Min.Er gilt als eines der größten Geheimnisse Europas. Bis heute kann niemand mit Sicherheit sagen, wer ihn erbaut hat oder welchen Zweck er erfüllt. Seit fast 5000 Jahren umschließt der Steinkreis von Stonehenge einen heiligen Ort, doch dessen kultische Bedeutung ist nur in Ansätzen bekannt. Die Ausrichtung der Steine deutet darauf hin, dass das Heiligtum als vorzeitliches Observatorium genutzt wurde. Die Megalithen sind exakt auf die Beobachtung der Winter- und Sommersonnenwende hin ausgerichtet. Zumindest darüber sind sich die Wissenschaftler einig.Neue Funde in der Umgebung könnten jedoch darauf hinweisen, dass Stonehenge noch eine ganz andere Bedeutung hatte. Der Archäologe Mike Parker Pearson ist davon überzeugt, dass der berühmte Steinkreis nur Teil eines weit größeren Ganzen ist. Im benachbarten Durrington hat Pearson nicht nur die Überreste der größten bisher bekannten Steinzeitsiedlung Europas gefunden, sondern auch Spuren einer weiteren Kreiskonstruktion, diesmal allerdings nicht aus Stein, sondern aus Holz. Pearson ist davon überzeugt, dass das gesamte Areal rund um Stonehenge, inklusive des Flusses Avon, ein gewaltiger, zusammenhängender Kultbezirk ist, in dem sich die Menschen aus England zweimal im Jahr trafen, um gemeinsam die Sommer- und Wintersonnenwende zu feiern und zugleich der Verstorbenen zu gedenken. Auf einer riesigen Prozessionsstraße pilgerten die Menschen damals vom Holzkreis zum Steinkreis, für Pearson eine symbolische Reise vom Leben zum Tod: Stonehenge der Ort der kollektiven Ahnenverehrung. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 13.12.2009 ZDF Die geheime Entdeckung – Rätsel der Urzeit
45 Min.Als Forscher kürzlich einen Ausgrabungsfund untersuchten, trauten sie ihren Augen nicht. Erst nach eingehenden Analysen zusammen mit weiteren Spezialisten sind sie sich sicher: Dieser Fund verändert alles, wovon ein ganzer Wissenschaftszweig bisher überzeugt war. Die Entdeckung ist so sensationell, dass sich alle Beteiligten zur Geheimhaltung verpflichten mussten. Jetzt zeigt Terra X exklusiv im deutschen Fernsehen die Entdeckung und ihre umwälzenden Folgen für unser Weltbild. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 31.05.2009 ZDF Der geheime Kontinent (1): Was geschah vor Kolumbus?
45 Min.Die Dokumentation „Der geheime Kontinent“ erzählt eine legendäre Geschichte unter ganz neuem Blickwinkel: die Entdeckung Amerikas – und wie sie die Lebensbedingungen auf der Welt für immer veränderte. Es ist die Geschichte des „Columbian Exchange“, des größten Kulturaustausches der Weltgeschichte durch den Transport von Pflanzen, Tieren, Bakterien, Genen von und nach Amerika. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 18.07.2010 ZDF Der geheime Kontinent (2): Sie kamen über das Meer
45 Min.Der zweite Teil des Films erzählt, wie sich Natur und Leben Amerikas durch die Ankunft der Weißen verändern – und wie auch Europa davon profitiert. Die Spanier bringen das Pferd – und bald bevölkern Millionen von Mustangs die nordamerikanischen Prärien. Dann kommt das europäische Hausschwein – es wird die Nahrungsgewohnheiten der Menschen komplett verändern. Die Wälder verschwinden, Getreide, Apfelbaum und Kirschbaum aus Europa kommen – und die europäische Honigbiene, ein fleißiger Bestäuber. Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich so der wilde Kontinent Amerika in ein zweites Europa verwandelt. Dabei wurden die Ureinwohner verdrängt – nicht durch Kriege, sondern durch lautlose Eroberer: die Krankheitserreger von Pocken und Pest. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 25.07.2010 ZDF Das Geheimnis der Dino-Mumie – Der Hadrosaurus aus den Badlands von North Dakota
45 Min.USA, 2005: Ein junger Paläontologe entdeckt einen komplett erhaltenen Körper eines Dinosauriers – eine Weltsensation. Der Film verfolgt das Abenteuer um die spannenden Ausgrabungsarbeiten, den Transport, die Untersuchung und die Rekonstruktion der Dino-Mumie. Erzählt wird die Geschichte in atemberaubenden Bildern und mit neuester 3D-Grafikanimation. „Das Geheimnis der Dino-Mumie“ ist eine internationale Koproduktion von National Geographic TV und dem ZDF. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 23.03.2008 ZDF Das Geheimnis der Eismumie
Im Beisein eines Filmteams gelang im Juli 2006 einer internationalen Archäologengruppe im mongolischen Altaigebirge ein Sensationsfund: die Mumie eines 2500 Jahre alten blonden Skythenkriegers. Im ewigen Eis seines Grabkurgans hatte sich der Leichnam, der in einen prächtigen Pelzmantel gehüllt war und einen vergoldeten Kopfschmuck trug, wie in einer Zeitkapsel erhalten. Das „Schliemanns Erben“-Team hatte vier Wochen lang hautnah die aufregende Suche und Entdeckung des „Fürsten aus dem Eis“ verfolgt. (Text: ZDF)Geheimnis der großen Pyramide
45 Min.Was wissen wir wirklich über das letzte erhaltene Weltwunder, den großen Pharao und die Zeit des Pyramidenbaus? Was wollte Cheops in dem auf Ewigkeit angelegten Steinkoloss verborgen halten? Wie wurde das riesige uralte Monument erbaut, das mit seinen 2,3 Millionen Kalksteinblöcken an bautechnischer Präzision seinesgleichen sucht? (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 22.06.2003 ZDF Geheimnis Mensch (1): Die Kinder des Feuers
45 Min.Im ersten Teil von „Geheimnis Mensch“ erzählt Jacques Malaterre die Geschichte des Menschen von den ersten Zweibeinern bis zum Homo erectus.Vor acht Millionen Jahren erhoben sich die ersten großen Affen in der dürren Savanne auf ihre wackeligen Beine. Ihre Vorfahren hatten als Waldbewohner gelebt, bis eine gewaltige Naturkatastrophe – die Bildung des ostafrikanischen Grabenbruchs – ihre Umwelt drastisch veränderte. Die üppigen Urwälder waren verschwunden, die Clans hatten sich auf die wenigen Bauminseln einer riesigen Graslandschaft verteilt. Die Bäume boten nicht genug Nahrung, und die Jungen, die zu dieser Zeit geboren wurden, hatten kaum eine Überlebenschance. Schließlich machte sich einer von ihnen, Orrorin, mit seinem Clan auf, um in der Savanne nach Futter zu suchen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 23.03.2003 ZDF Geheimnis Mensch (2): Die Herren der Eiszeit
45 Min.Jacques Malaterre erzählt im zweiten Teil der Reihe „Geheimnis Mensch“ eine mögliche Version der Geschichte von Neandertaler und Homo sapiens.Was die Neandertaler tatsächlich angesichts der ersten modernen Menschen gedacht und empfunden haben, können wir heute nur erahnen. Fakt ist, dass sich der moderne Mensch überall auf dem Globus ausbreitete und die anderen Nachkommen seines Vorfahren Erectus verdrängte. Obwohl die Neandertaler körperlich weit überlegen waren und im Schnitt sogar über ein größeres Gehirn verfügten als Homo sapiens, verschwanden die letzten ihrer Art vor rund 25 000 Jahren. Ihr Aussterben birgt eines der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte. War Homo sapiens als Eroberer gekommen und hatte seinen entfernten Vetter einfach niedergemetzelt, oder hatten die „neuen Menschen“ Krankheiten aus Afrika mitgebracht, denen das Immunsystem des nördlichen Verwandten nichts entgegen zu setzen hatte? Oder war die Geburtenrate unserer Vorfahren einfach höher als die des Neandertalers? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 30.03.2003 ZDF Geheimnis Saudi-Arabien
45 Min.Spielszene: Jahrhunderte lang zogen Händler und Nomaden durch die arabische Wüste.Bild: Oliver Halmburger / ZDFSaudi-Arabien trägt den Namen des Clans, der das Land 1932 zum Königreich machte. Seine Macht geht auf einen Pakt zurück, der religiösen Eifer mit politischem Kalkül verband. Auf der Arabischen Halbinsel liegt der Ursprung des Islam. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Mekka. Die Stadt war schon ein beliebter Pilgerort und Ziel unzähliger Handelskarawanen, lange bevor der Prophet Mohammed seine neue Religion verkündete. Die Landschaft Saudi-Arabiens ist vor allem von Vulkanen und Wüsten geprägt und vielerorts schroff und abweisend.Früher herrschten in dem unwirtlichen Gebiet Clans, die sich oft gegenseitig bekriegten, denn fruchtbares Land war und ist knapp. Uralte Felsbilder erzählen von einer Zeit, als die Arabische Halbinsel noch eine fruchtbare Savannenlandschaft war, doch das ist lange vorbei. Karawanenstraßen durchziehen die Einöde, auf denen Händler wie die sagenumwobenen Nabatäer mit ihren Kamelen Güter über die Halbinsel transportierten. Im saudischen Mada’in Salih haben sie ihre Spuren in Form von riesigen Grabfassaden hinterlassen. Nichts weiter als ein Karawanenposten auf der legendären Weihrauchstraße war bis ins 7. Jahrhundert nach Christus auch die Stadt Mekka. Allerdings existierte dort ein Heiligtum, zu dem die Beduinen aus den umliegenden Tälern regelmäßig pilgerten, um ihre Götter zu verehren, darunter ein besonderer Stein. Ihn beließ der berühmteste Sohn der Stadt an seinem Ort, als er alle anderen Götterbilder aus dem heiligen Bezirk entfernte. Dem Propheten Mohammed gelang damals, woran andere vor ihm scheiterten. Er vereinte die Stämme der Arabischen Halbinsel unter dem Banner einer neuen Religion und machte Mekka zu einer ihrer heiligsten Stätten. Doch selbst in den 1920er-Jahren glich Mekka eher einem Dorf, das nur zu Zeiten der Pilgerfahrt zu einer riesigen Zeltstadt wurde. Der Wandel in eine moderne Großstadt setzte erst in den 1950er-Jahren ein, als die herrschende Familie Al Saud ganze Quartiere einreißen ließ, um die Große Moschee zu erweitern. Mehr Platz für immer mehr Pilger. Seitdem haben die Bauarbeiten nie mehr aufgehört. Mittlerweile steht in Mekka das dritthöchste Gebäude der Welt. Auch an der Moschee wird wieder gearbeitet, 20 Milliarden Euro sind dafür veranschlagt. Keiner weiß besser als die Al Sauds, was man im Namen der Religion erreichen kann, denn ihre Herrschaft fußt auf dem Wahhabismus, einer besonders strengen Auslegung des Islam. Ein Pakt, den der Emir Muhammad ibn Saud mit dem religiösen Führer Muhammad ibn Abd al-Wahhab im Jahr 1744 geschlossen hat, bestimmt das Leben in Saudi-Arabien bis heute. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.11.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 29.11.2020 ZDF Geheimnisse auf dem Meeresgrund
45 Min.Florian Huber, Archäologe und Forschungstaucher, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Geheimnisse der Unterwasserwelt zu lüften.Bild: ZDFVerborgen in den Tiefen unserer Meere liegen mehr Schätze als in den Tresoren und Museen unserer Erde – Relikte aus der Vergangenheit, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Die Dokumentation folgt dem Unterwasser-Archäologen und Forschungstaucher Florian Huber auf seiner Reise rund um den Globus, präsentiert verschollen geglaubte Wracks und erzählt ihre spannende Geschichte. Etwa drei Millionen Wracks liegen auf dem Grund der Gewässer unseres Planeten, und jedes hat seine eigene, verborgene Geschichte. Doch die stummen Zeitzeugen sind in Gefahr.Plünderer und der biologische Verfall sind eine ernste Bedrohung für die Schiffswracks. Florian Huber hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wracks zu schützen und ihre Geschichten zu rekonstruieren. Er taucht hinab zu Relikten aus dem Ersten Weltkrieg, zu uralten Fossilien, antiken Frachtenseglern, und er macht sich auf die Suche nach verborgenen Schätzen auf dem Meeresgrund. Vor Helgoland liegen gleich vier deutsche Kriegsschiffe auf Grund, die noch weitgehend unerforscht sind. Sie sanken dort in einem Seegefecht im August 1914. In den vergangenen Jahren haben Raubtaucher das Wrack der „SMS Mainz“ immer wieder geplündert und damit die Totenruhe der gefallenen Seeleute gestört. Jetzt ist den deutschen Behörden ein Schlag gegen die Raubtaucher gelungen: Die Bundespolizei hat die gestohlenen Artefakte von der „SMS Mainz“ bei den niederländischen Plünderern entdeckt und beschlagnahmen lassen. Die Objekte vom Meeresgrund werden in Dresden restauriert. Am anderen Ende der Welt analysiert Hubers Team zwar ebenfalls Kriegsschiffe, allerdings stammen diese aus dem Zweiten Weltkrieg und stellen ein massives Umweltproblem dar. In der paradiesischen Südsee-Inselwelt von Chuuk Lagoon befindet sich der größte Schiffsfriedhof der Welt. Die Wracks mitten im Pazifik sind tickende Zeitbomben, schließlich lagern immer noch Treibstoff und Munition in den Bäuchen der rostenden Wracks. Durch die fortschreitende Korrosion tritt jedes Jahr immer mehr Gift aus und bedroht das einzigartige Ökosystem der Inseln. Vor Mauritius erforscht Florian Huber ein Wrack, das in die Geschichte einging: die „Saint Géran“. Das Schiff der französischen Ostindienkompanie zerschellte am 17. August 1744 vor Mauritius an einem Riff und sank. Die „Saint Géran“ wurde im weltberühmten Roman „Paul et Virginie“ von Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre verewigt. Er erzählt die Geschichte einer tragischen Liebe. Das Wrack ist jedoch in Vergessenheit geraten. Florian Huber macht sich auf Spurensuche – nach dem Wahrheitsgehalt der Geschichte und nach den Überresten des Schiffes. Zunächst per Ultraleicht-Wasserflugzeug aus der Luft und dann mit seiner Crew aus Forschungstauchern. In kaum einer anderen Region der Erde liegen mehr Schiffswracks auf dem Meeresgrund als in der Ostsee. Das liegt nicht nur an den zahlreichen Seeschlachten, die in diesem Meer stattfanden, sondern vor allem am geringen Salzgehalt der Ostsee. Dieser Umstand führt dazu, dass der Schiffsbohrwurm, der Wracks in anderen Regionen zusetzt, dort kaum vorkommt. Daher befinden sich auch alte Holz-Wracks noch immer in einem hervorragenden Zustand. Der Unterwasserarchäologe Florian Huber analysiert den Erhaltungszustand von einem ganz besonderen Wrack weit im Norden der Ostsee. Zwischen Finnland und Schweden liegt die „Plus“ auf Grund. Das Schiff gehörte zu den sogenannten „Flying P-Linern“ der Hamburger Reederei Laeisz. Bei nur drei Grad Celsius Wassertemperatur taucht er mit seinen Kollegen in eine Tiefe von 32 Metern hinab und nimmt das Wrack unter die Lupe. Florian Hubers Reise um den Globus führt die Zuschauer auch auf die Bahamas. Denn auf den Inseln befinden sich besonders geheimnisvolle Orte – die sogenannten Blue Holes. Die tiefen Kalksteinhöhlen aus grauer Vorzeit sind voller Wasser. Als bei den verschiedenen Eiszeiten auf dem Planeten der Wasserspiegel sank, lagen die Höhlen zwischenzeitlich trocken. Noch heute finden die Taucher Überreste aus jener Zeit. Florian Huber stößt auf einen urzeitlichen Krokodilschädel. Die Reise um den Globus liefert spannende wissenschaftliche Einblicke in die Unterwasserarchäologie und präsentiert dabei gleichermaßen ebenso vielfältige wie spektakuläre Unterwasseraufnahmen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 10.08.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 11.08.2019 ZDF Geheimnisse aus der Tiefe
45 Min.In dieser „Terra X“-Folge mit Florian Huber sind der Walchensee, die Wimsener Höhle, die Ostsee und der Meeresnationalpark Kosterhavet die neuen Tauchreviere des Unterwasserarchäologen. Die „Terra X“-Dokumentation „Geheimnisse aus der Tiefe“ folgt dem Unterwasserarchäologen und Forschungstaucher Florian Huber auf seinen Expeditionen in verborgene Unterwasserwelten und zeigt, was sie so einzigartig, herausfordernd und manchmal gefährlich macht. Florian Hubers Beruf ist alles andere als eintönig: Er ist Forschungstaucher und Unterwasserarchäologe zugleich.Einen Großteil seiner Zeit verbringt er damit, ungeklärte Wrackfunde wissenschaftlich zu untersuchen. Aber auch der Schutz der Biodiversität in den Meeren, die Erforschung spektakulärer Unterwasserhöhlen oder die Entwicklung moderner Methoden für die Unterwasserarchäologie beschäftigen Florian Huber und sein Team. Für die „Terra X“-Dokumentation „Geheimnisse aus der Tiefe“ ist der Forscher in Deutschland und Schweden unterwegs und entdeckt verborgene Plätze und vergessene Geschichten. Eine handelt vom Walchensee. Mit 192 Metern ist er der tiefste Gebirgssee Deutschlands. Zahlreiche Mythen ranken sich um das südlich von München gelegene Gewässer. Bodenlos soll der See sein, unergründlich und voller Schätze. Zudem glaubten die Menschen über viele Jahrhunderte, dass auf seinem Grund ein riesiger Urzeit-Wels hause, der mit einem einzigen Flossenschlag die ganze Region mitsamt der Landeshauptstadt überfluten könne. Im Zweiten Weltkrieg wird der See zum feuchten Grab, als ein britischer Bomber vom Typ Avro Lancaster in das Gewässer stürzt und die siebenköpfige Besatzung dabei ums Leben kommt. Nach über 50 Jahren ist Florian Huber der Erste, der die Überreste des Flugzeuges wissenschaftlich untersucht. Von Bayern aus reist der Forscher in den hohen Norden von Schweden. Direkt an der Grenze zu Norwegen erstreckt sich der Meeresnationalpark Kosterhavet. Das Besondere: Etwa 97 Prozent des Schutzgebietes liegen unter der Meeresoberfläche. Es sind die mehr als 12 000 Tier- und Pflanzenarten, die dieses Gebiet so einzigartig machen. Dazu gehören unter anderem die Kleine Seenadel, der Nagelrochen, Seeanemonen und Korallen. Im über 200 Meter tiefen Koster-Graben, einer Verwerfungsrinne, die vor Millionen von Jahren entstanden ist und sich bis in den Nordatlantik erstreckt, leben seltene Tiefsee-Arten. Florian Huber geht mit Meeresbiologen auf einen Tauchgang in die spektakuläre Unterwasserwelt des Koster-Archipels. Nicht weniger aufsehenerregend ist die Schwäbische Alb mit ihren weltberühmten Fossilfunden aus der Steinzeit. Florian Huber besucht die aktuellen Ausgrabungen im Hohle Fels und trifft den Ausgrabungsleiter Professor Nicholas Conard, den Entdecker eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit: die Venus vom Hohle Fels. Sein eigentliches Ziel aber ist die für die Öffentlichkeit unzugängliche Wimsener Höhle. 1000 Meter der tiefsten Unterwasserhöhle Deutschlands sind bereits erforscht. Bronzezeitliche Knochenfunde führen seit Jahren zu Spekulationen. Florian Huber will eine DNA-Probe nehmen und die sogenannte Schatzkammer mit einem 3-D-Laserscanner vermessen. Das Unternehmen ist nicht ungefährlich, unter Tauchern gelten Höhlentauchgänge als Königsdisziplin. Ein Wrack hat es Florian Huber ganz besonders angetan: die „Hedvig Sophia“ – das einstige Flaggschiff der königlich-schwedischen Marine und Stolz der Nation. Das schwedische Kriegsschiff lief im April 1715 in einem blutigen Seegefecht zwischen Dänemark und Schweden in der Kieler Förde auf Grund. Entdeckt wurde die „Hedvig Sophia“ 2008, ein Jahr später begannen die ersten Voruntersuchungen. Florian Huber gehörte damals zum Team. Jetzt taucht er nochmals zu den verbliebenen Relikten am Grund der Ostsee hinab, um ihren Erhaltungszustand zu überprüfen. Geborgen werden die Überreste nicht, denn eine Bergung und fachmännische Konservierung wären mit Kosten verbunden, die sich die meisten Institutionen nicht leisten können. Deshalb suchen Unterwasserarchäologen ständig nach neuen Möglichkeiten, wie sie ihre Arbeit dokumentieren und auch einem größeren Publikum zugänglich machen können. Eine Möglichkeit offenbart das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz. Dort trifft Florian Huber den Leiter für Digitale Technologien, Professor Michael Orthwein. Seine Idee: Museumsbesucher sollen vom Zuschauer zum Zeugen der Wissenschaft werden und per VR-Technik einen virtuellen Tauchgang zu Schiffswracks wagen. Florian Huber macht die Probe aufs Exempel: Mit einem VR-Headset beamt er sich auf die „Madrague de Giens“, ein römisches Schiffswrack aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Der Film folgt Florian Huber zu den unterschiedlichen Schauplätzen und dokumentiert die Arbeit des Forschers. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 17.03.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 21.03.2021 ZDF Geheimnisse der Tiefsee – In den Kellern der Korallenriffe
45 Min.Ein roter Seeigel auf Korallenfelsen.Bild: ZDF und NHKEin weiteres Mal taucht „Terra X“ in das dunkle Reich der Tiefsee ab, in die Kellergeschosse atemberaubender Korallenriffe, auf der Suche nach lebenden Fossilien. Im Herbst 2014 macht sich ein japanisches Expeditions-Team in Begleitung des renommierten Meeresbiologen Mark Erdmann auf, um die dunklen Regionen tropischer Ozeane zu erkunden. Ihr Weg führt sie über das Great Barrier Reef zu den Tiefseeschluchten vor Indonesien und Papua-Neuguinea. Erdmann, der bereits mehrere unbekannte Arten entdeckt hat, hofft, hier ein weiteres Mal fündig zu werden.Den Forschern steht bei ihrer Unternehmung das Forschungsschiff „Alucia“ mit zwei Tauchbooten zur Verfügung, die vom Mutterschiff abgelassen werden und bis in Tiefen von über 1000 Metern vordringen können. Eine Reise in die Tiefsee ist gleichzeitig auch eine Zeitreise. Denn das Reich der ewigen Dunkelheit ist von lebenden Fossilien bevölkert. Da sich ihr Lebensraum in Jahrmillionen nur unerheblich verändert hat, waren sie nicht wie andere Wesen auf dem Planeten gezwungen, sich stetig neuen Bedingungen anzupassen. Deshalb begegnen die Forscher bei ihren Tauchgängen Arten, die schon lange aufgrund von Versteinerungen bekannt waren, doch als längst ausgestorben galten. Mark Erdmann und seinem Team gelingt mit Hilfe von Ködern, Fotofallen und ihren Tauchbooten, einige dieser scheinbaren Urzeitwesen vor die Kamera zu bekommen. Sogar zwei große Exemplare einer neu entdeckten Fischart kommen im Höhlensystem am Fuße eines Riffs zum Vorschein – die Krönung der Expedition. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 29.05.2016 ZDF Geisterschiff im Wattenmeer
45 Min.Im März 1822 läuft in der Elbmündung bei Cuxhaven ein Schiff auf Grund. Ein schwerer Orkan verhindert die Rettung, die Mannschaft kommt ums Leben, die Ladung geht über Bord. Bei dem Schiff handelt es sich um die „Gottfried“, die von Triest nach Hamburg unterwegs war. Die Fracht – hunderte altägyptische Kostbarkeiten – hat der preußische Adlige Freiherr Menu von Minutoli zum Teil selbst ausgegraben, zum Teil im ägyptischen Luxor eingekauft. Die Havarie der „Gottfried“ stürzt von Minutoli in den finanziellen Ruin und in eine persönliche Krise. Er träumte davon, in Berlin ein großartiges Museum zu bauen – zu Ehren des Vaterlandes und König Friedrich Wilhelms III.. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 28.10.2012 ZDF Die Geister vom steinernen Wald – Lemuren auf Madagaskar
Die Geschichte der Schönheit (1): Die Suche nach der Schönheitsformel
45 Min.„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ – die wohl bekannteste Frage aus einem deutschen Märchen bildet den Auftakt der ersten Folge der neuen „Terra X“-Reihe „Die Geschichte der Schönheit“. Senta Berger begibt sich auf die Suche nach den Geheimnissen der Schönheit und fahndet nach den Ursprüngen dieses weltumspannenden Faszinosums. Die Reise beginnt in Ägypten, wo deutsche Archäologen vor 100 Jahren das vielleicht schönste Gesicht der Weltgeschichte aus dem Schutt der Geschichte bergen: die Büste der Nofretete. Der Name bedeutet übersetzt: „Die Schöne ist gekommen“.Tatsächlich sind die Gesichtszüge der ägyptischen Prinzessin bis heute ein ästhetisches Ideal, dem selbst moderne Schönheitschirurgen nacheifern. Sind es Symmetrie und Perfektion, die Nofretetes Schönheit ausmachen? Modeschöpfer Wolfgang Joop behauptet das Gegenteil: Die kleine Beschädigung der Büste und die feine Asymmetrie machen erst die eigentliche Schönheit perfekt. Schönheit brauche den Makel. Andere historische Epochen bestätigen diese Auffassung, etwa der Barock oder das Rokoko: Als besonders schön gilt dort das Schönheitspflästerchen, das die Symmetrie des Gesichts durchbricht. Madame Pompadour, Marie Antoinette oder auch der Sonnenkönig Ludwig XIV. haben die Kunst des schönen Makels zur höchsten Blüte erhoben. Schönheit braucht Individualität. Das beweisen Wissenschaftler in einem aufsehenerregenden Experiment. In der Geschichte hat das vielleicht keiner besser gewusst als Napoleon, dessen auffällige Stirnlocke zum modischen Markenzeichen wurde, selbst heute noch bewundert von Charlie Le Mindu, dem Friseur von Lady Gaga. Trotz seiner eher schmächtigen und untersetzten Gestalt wusste Napoleon: „Macht macht schön“. Senta Berger erfährt von Experten, dass Schönheit tatsächlich einer der wirkungsmächtigsten Kräfte der Weltgeschichte ist. Kein Wunder, dass schon die Philosophen der Antike das Schöne für das Abbild alles Göttlichen hielten. „Das Gute, das Wahre, das Schöne“ – für die Antike waren das untrennbare Größen. Leonardo da Vinci versuchte, diesem tiefen Geheimnis der Schönheit noch näher zu kommen – und fand die Antwort im Lächeln seiner Mona Lisa, einem der berühmtesten Gemälde der Welt. Worin besteht die geheimnisvolle Schönheit dieser Darstellung? Hat Leonardo damit das Schönheitsrätsel gelöst? Oder hält vielmehr die Natur in ihrer unüberschaubaren Vielfalt die Antwort bereit auf die Frage, was eigentlich wahre Schönheit ist, warum es überhaupt Schönheit gibt? Gibt es eine allgemeine „Schönheitsformel“, die sich aus den vielfältigen Naturerscheinungen herauslesen lässt? Tatsächlich gibt es diese Formel, nämlich eine mathematisch exakt definierte Proportion, die viele Dinge erfüllen, die wir als schön empfinden. Die zweite Folge „Terra X: Die Geschichte der Schönheit“ wird am Sonntag, 3. November 2013, 19:30 Uhr, ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 27.10.2013 ZDF Die Geschichte der Schönheit (2): Der Preis der Schönheit
45 Min.„Ist Schönheit nicht in Wirklichkeit eine einzige Frechheit?“, fragt Senta Berger provokativ. Denn Schönheit ist alles andere als ein demokratisches Gut: Der eine hat’s, der andere nicht. Alles höchst ungerecht, wie auch ein wissenschaftliches Experiment beweist: Schöne Menschen werden von Kindesbeinen viel mehr gefördert als unattraktive. Doch der Preis der Schönheit kann teuer bezahlt sein: Schon die Griechen der Antike wussten, dass die Schönheitsgöttin Aphrodite am liebsten mit dem Kriegsgott Mars liebäugelte.Kampf, Neid und Missgunst waren in der Geschichte oft die verlässlichsten Begleiter der Schönheit. Die Geburt der Schönheit beginnt mit einem grausamen Vatermord, wie die antike Sage von der Geburt der Schönheitsgöttin Venus erzählt. Und dass der Anblick von überwältigender Schönheit grundsätzlich tödlich endet, hat schon vor 150 Jahren der Dichter August von Platen behauptet. „Schönheit muss leiden“ – so weiß es das deutsche Sprichwort. Und wenn Senta Berger in die Weltgeschichte blickt, dann wird klar, wie sehr. Ob die Tellerlippen afrikanischer Ureinwohner, die Schmucknarben amerikanischer Indianerstämme, die Lotusfüße weiblicher Chinesen, die Halsringe der Frauen von Myanmar oder das Tattooing und Piercing unserer modernen Welt: All diese Schönheitsideale sind mit hohem körperlichem Einsatz und oft unter großen Schmerzen erkauft. Senta Berger spürt den Gründen für dieses irritierende Phänomen nach, das unsere gesamte Weltgeschichte durchzieht. Auch der Preis der Schönheit ist hoch. Auf den orientalischen Sklavenmärkten des Mittelalters, wo für blonde Frauen aus nördlichen und östlichen Ländern Spitzenpreise erzielt wurden, wurde Schönheit als kostbarstes Gut gehandelt. Als so begehrenswert galt Schönheit, dass man sie regelmäßig hinter Haremstüren vor den Blicken der Welt verschloss. Tragik und Glanz liegen da oft dicht beieinander: Senta Berger erzählt die Geschichte von Roxelane, jener Haremssklavin, die als Kriegsbeute nach Istanbul verschleppt wurde, es im Topkapi-Palast des osmanischen Sultans Süleyman aber zu höchstem Ansehen brachte. Moderne Wissenschaftler haben inzwischen das Geheimnis der orientalischen Schönheitsmittel entschlüsselt, die im Harem wie in einem Schönheitslabor über Jahrhunderte entwickelt wurden. Die moderne Kosmetikindustrie, die es auf einen weltweiten Umsatz von 140 Milliarden Dollar bringt, bedient sich auch heute noch am verführerischen Wissen aus tausendundeiner Nacht. Wie etwa der weltberühmte Parfümeur Serge Lutens, der in Marrakesch residiert und für die teuersten Parfümmarken der Welt seine Düfte kreiert. Immer noch ist einer der wesentlichen Inhaltsstoffe des Parfums das Ambra, eine Ausscheidung des Pottwals, die nur selten im Meer gefunden wird und die so kostbar ist, dass man sie noch heute mit Gold aufwiegt. Wissenschaftliche Highlights verbinden sich mit den faszinierenden Rekonstruktionen historischer Sternstunden, immer begleitet von der Frage nach dem zwingenden Mechanismus dieses ewigen Rätsels: Wie funktioniert „Schönheit“ denn eigentlich? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 03.11.2013 ZDF Geschichte der Tiere (1): Der Hund
Hund und Katze sind die beliebtesten und treuesten Wegbegleiter des Menschen. Die zweiteilige „Terra X“-Reihe erzählt alles Wissenswerte dieser einzigartigen Erfolgsstory.Im Mittelpunkt der ersten Folge steht die Kulturgeschichte des Hundes. Sie beginnt mit dem Lagerwolf. In grauer Vorzeit geht er mit dem Mensch eine Zweckbeziehung ein. Aus anfänglichem Misstrauen entstehen Zuneigung und enge Bindung.“Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos.“ Eine Erkenntnis, die zuerst der deutsche Schauspieler Heinz Rühmann formuliert hat, bevor Loriot sie später ein wenig präzisierte.Für den deutschen Humoristen war ein Leben ohne Mops unter keinen Umständen vorstellbar. Rund fünf Millionen Hundehalter in Deutschland geben beiden prominenten Künstlern Recht. Der Hund ist nicht nur das erste Haustier, sondern auch der beste Freund des Menschen.Liebe auf den ersten Blick ist es nicht, als sich Grauwolf und Mensch zum ersten Mal begegnen. „Canis lupus“ ist vom Hunger getrieben und stöbert in der Müllhalde einer Steinzeitsiedlung. Mit der Großen Eiszeit ist das friedlich grasende Großwild abgewandert. Die neuen Beutetiere sind kleiner, schreckhafter und flinker. Die Jagd im Rudel kostet mehr Kraft, erfordert anderes Vorgehen und bringt längst nicht immer den gewünschten Erfolg. Die schwierigen Verhältnisse in der Umwelt zwingen Mensch und Wolf zu einer bis dahin nie dagewesenen Kooperation, sagen Forscher. Der Mensch folgt der Fährte der Wölfe, die mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn selbst drei Tage alte Spuren wittern können. Im Gegenzug duldet er, wenn die scheuen Tiere in ihre Siedlungen eindringen und sich über die Essensreste hermachen. Aus gegenseitiger Duldung wird allmählich Zutrauen – die Evolution bringt den Lagerwolf hervor. Er ist dem Wolf zwar genetisch noch näher als dem Hund, aber im Verhalten zeigt er sich bereits deutlich zutraulicher und lebt im losen Verbund mit der Gemeinschaft. Der Lagerwolf gilt als direkter Vorfahr des Hundes, der seinen Siegeszug als treuer Wegbegleiter des Menschen vermutlich in der Zeit antritt, als aus Jägern und Sammlern Bauern und Viehzüchter werden. Schon damals übernimmt der Hund Aufgaben als Wach- und Hütehund. Und er stellt seine hohe soziale Anpassungsfähigkeit unter Beweis. Eigenschaften, die ihm Jahrtausende später gottgleichen Status bescheren. Dass der Hund eines Thrones wert ist, haben viele Hochkulturen gewusst. Die Ägypter ernennen den schakalköpfigen Anubis zum obersten Richter ihres Totenreichs. Die Griechen suchen eher nach rationalen Erklärungen für das außergewöhnliche Wesen des Hundes. Der Philosoph Xenophon liefert die erste wissenschaftliche Abhandlung über Erziehung, Fährtenarbeit und Verhalten. Die Römer gehen noch einen Schritt weiter: Sie züchten unterschiedliche Jagdhund-Rassen, führen aus dem Ausland Luxushündchen ein, schicken Kampfhunde in die Arena und halten Hunde, die vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Mit der Christianisierung ändert sich die gesellschaftliche Wertschätzung der Vierbeiner. Die Kirche entdeckt ihre vermeintlich dunkle Seite als Begleiter von Hexen und Dämonen. Als die Bestiarien im 10. Jahrhundert aufkommen, hat sich die Lage schon wieder etwas entspannt. Der Hund wird zur Symbolfigur menschlicher Tugenden wie Treue, Wachsamkeit und Mut. Kaiser, Könige und Adlige präsentieren sich stolz mit ihren Lieblingen. Der Hund avanciert zum Prestigeobjekt. Welche Rasse zu wem passt, ist über Jahrhunderte aber nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, sondern vor allem der eigenen gesellschaftlichen Stellung. Daran hat sich womöglich bis heute nicht viel geändert, aber inzwischen hat der Hund vor allem das Herz des Menschen erobert. Er ist sein bester Freund, sein Kind- oder Partnerersatz. Er versteht auch ohne Worte, er liebt bedingungslos. Die Moderne verhilft ihm vielleicht zur größten Wertschätzung in der Jahrtausende alten Geschichte zwischen Mensch und Hund.Teil 2 „Geschichte der Tiere: Die Katze“, am 09.08., um 19:30 Uhr. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 02.08.2015 ZDF Geschichte der Tiere (2): Die Katze
Hund und Katze sind die beliebtesten und treuesten Wegbegleiter des Menschen. „Terra X: Geschichte der Tiere“ erzählt alles Wissenswerte dieser Erfolgsstory.Im Mittelpunkt dieser Folge steht die Geschichte der Katze. Vor etwa 11 000 Jahren kommt sie auf samtenen Pfoten und mit scharfen Krallen aus der Wildnis und erobert sich einen Platz in der Zivilisation. Ihrem Wesen nach aber bleibt die Hausmieze eine Wildkatze.Der deutsche Journalist und Schriftsteller Kurt Tucholsky hat einmal über die Katze gesagt, sie sei das einzige vierbeinige Tier, das dem Menschen eingeredet habe, er müsse es versorgen, ohne dass es selbst dafür etwas tun müsse.Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Der Mensch liebt die Katze, füttert sie, überhäuft sie mit Zuwendung und gibt ihr ein Zuhause. Im Gegenzug demonstriert sie ihre Unabhängigkeit und zeigt sich überaus eigensinnig. Die Katze gehorcht nicht, will sich nicht unterordnen und bleibt ein sturer Einzelgänger. Selbst die treueste und verschmusteste Katze der Welt kann schon mal von heute auf morgen die Beziehung zu ihrem Besitzer beenden und grußlos für immer verschwinden. Katzenhalter können sich ihres unberechenbaren Mitbewohners nie hundertprozentig sicher sein. Dabei ist es die Katze genauer gesagt die Falbkatze – die vor rund 11 000 Jahren in einer Art „Selbstdomestikation“ die Welt des Menschen betritt. Doch anders als der Hund wartet das kleine Raubtier damit, bis die Jäger und Sammler des Alten Orients das Feuer beherrschen und sesshaft sind. Ihre Karriere beginnt sie als Resteverwerter und erfolgreicher Mäusejäger. Kein anderes Haustier beherrscht die Technik des Lauerns, des schnellen Zugriffs und Tötens so wie die Katze. Die Jungsteinzeitler schätzen sie dafür. Und nicht nur sie, wo immer in den folgenden Jahrtausenden auf dem Globus Siedlungen entstehen, gehört mindestens eine Katze zum Haushalt. Kultische Verehrung erfahren die Samtpfoten vor allem im Alten Ägypten. Forscher sagen, dass das Pharaonenreich ihren Wohlstand auch den Katzen zu verdanken habe, die in den zahlreichen Getreidespeichern Ratten und Mäusen nachstellten. Für ihre wertvollen Dienste werden die Jäger sogar vergöttlicht. Millionen enden trotzdem als Opfergabe an die Katzengöttin Bastet, die Ägypter kaufen von Händlern teure Katzenmumien. Mehr als einmal werden die Käufer dabei über den Tisch gezogen, wie jüngste Untersuchungen offenbaren. Nicht in jedem Exemplar ist auch tatsächlich Katze enthalten. Die Wissenschaftler entdeckten auf den Röntgenbildern Hölzer, Hunde- und andere Tierknochen. Die Nachfrage hat das Angebot zeitweise offensichtlich bei weitem überstiegen. Das erklärt vielleicht auch, warum die Pharaonen den Export von Katzen in fremde Länder unter Todesstrafe gestellt haben. Um 500 vor Christus gelangen über Griechenland trotzdem die ersten Katzen nach Europa und vermischen sich mit der dort heimischen Wildkatze. In Italien erobern sie als exotische Luxusgeschöpfe zunächst die Herzen der reichen Damen, bevor sie im Römischen Reich auch kultische Weihen erhalten. Erst ab dem 2. Jahrhundert nach Christus ist die Katze ein Haustier für alle und erweist sich als nützlicher Jäger auf üble Nager. Marder und Wiesel, die dafür immer eingesetzt wurden, sind schon bald aus dem Rennen auch deshalb, weil Katzen nicht so stinken und viel reinlicher sind. Im nebligen Germanien beginnt man, die Wildkatze anzuhimmeln. Sie ist aber nicht domestiziert, sondern als mystische Begleiterin der Fruchtbarkeitsgöttin Freya vorbehalten.Mit der Christianisierung jedoch folgt der tiefe Fall. Die Katze wird als Geschöpf des Teufels, der Hexen und Dämonen verdammt und später manchmal auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr schlechtes Image hält sich über Jahrhunderte. Noch im späten Mittelalter entstehen zahlreiche Sprichwörter, Mythen und Legenden – alle mit eindeutig negativer Botschaft. Nach damaligem Verständnis verkörpern Katzen weibliche Laster. Sie gelten als unmäßig, diebisch, treulos und sündig. Das halbwilde, unkontrollierbare Wesen von Katzen, die nächtlichen Jagdausflüge und das lautstarke Paarungsverhalten sorgen bis ins 18. Jahrhundert für Misstrauen und Verfolgungsexzesse durch Kirche und Staat. Erst ab dem 19. Jahrhundert gewinnt die Katze wieder an Ansehen. Dafür sorgt unter anderem der deutsche Zoologe Alfred Brehm. Inzwischen ist sie gesellschaftlich rehabilitiert, geliebt und bewundert. Manche von ihnen sind prominent, einige kosten ein Vermögen, Millionen leben als eigenwillige Stubentiger auf dem Sofa. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 09.08.2015 ZDF Die Geschichte des Essens: 1. Vorspeise
45 Min.Warum essen wir, was essen wir, und wie hat sich das entwickelt? Sternekoch Christian Rach begibt sich auf Reise durch die Kulturgeschichte des Kochens und des Essens. Die Fähigkeit, Speisen auf dem Feuer zuzubereiten, ist so alt wie die Menschheit. Doch bis zu den Menüs, wie wir sie heute kennen, hat es Jahrtausende gedauert. Jede Zeit hatte ihre Rezepte, Zutaten und Techniken. Christian Rach stellt sie vor. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das kocht. Durch die Jahrtausende hat sich die Fähigkeit, Speisen zuzubereiten, immer weiter verfeinert.Die Zutaten änderten sich ebenso wie die Art zu kochen und die Gerätschaften. Aber auch die Tischsitten waren ständigen Veränderungen unterworfen. Bis ins 18. Jahrhundert war es üblich, den Tisch komplett mit Schüsseln einzudecken, aus denen sich die Leute gegenseitig bedienten. Um 1800 taucht dann, ausgehend von der russischen Botschaft in Paris, die Idee des „Service a la Russe“ auf. Es wird jetzt in mehreren Gängen aufgetragen, so dass die Mitte des Tisches frei für Dekorationen bleibt und die Esser sich der gepflegten Konversation widmen können. Der erste Gang, die Vorspeise, besteht in Deutschland in der Regel aus Brot und Suppe. Das Brot ist der Dauerbrenner unter den Nährmitteln. Auf ihm gründete der Erfolg des Römischen Weltreiches, das mit den haltbaren Broten seine Soldaten ernährte. Bis in die Neuzeit ist Brot unser einziges Grundnahrungsmittel. Erst dann kommen Kartoffeln und Reis hinzu. Christian Rach lernt im Brotmuseum Ebergötzen, wie Steinzeitmenschen und Römer ihr Brot zubereitet haben. Küchenarbeit ist Schufterei. Das erfährt Rach in einer Mittelalterküche, in der bis zu 50 Gerichte gleichzeitig für Hunderte Esser zubereitet werden mussten. Vom Rupfen des Geflügels über das Kneten des Teiges von Hand und der Schlepperei der Zutaten. Immer wieder muss er „einen Zahn zulegen“, was nichts anderes hieß, als den Topf über der Feuerstelle am gezahnten Metall abzusenken, um die Hitze zu erhöhen. Erst die Jahrhunderte erleichterten das Leben der Hausfrauen und Männer. Die „Frankfurter Küche“ wurde anfangs des 20. Jahrhunderts entwickelt, um auf gerade einmal acht Quadratmetern die Wege in der Küche zu verkürzen und zu rationalisieren. Instantprodukte wie die Trockensuppe, die eigentlich als Armen- und Armeespeise erfunden wurde, hielten Einzug auch in die Alltagsküche. In Italien eröffnet noch heute in der Regel die Nudel das Menü. In der Emilia Romagna testet Christian Rach seine Pastazubereitung im Wettstreit gegen die lokalen Nudelköniginnen und schlägt sich tapfer. Aber wie isst man die Nudel am besten? Auch hier haben die Zeiten und Regionen ganz unterschiedliche Sitten hervorgebracht. Am schwersten hatte es die Gabel, sich durchzusetzen, hielt man sie doch lange für ein Werkzeug des Teufels. Noch Ludwig XIV. schlürfte seine Ragouts am liebsten durch die Finger. Doch der Siegeszug der Gabel war im Zuge der Verfeinerung der Tischsitten unaufhaltsam. Auch unfeine Geräusche bei Tisch waren schließlich verpönt. Andere Neuerungen hatten lediglich eine Hochzeit. Wie das rabiate Überwürzen von Speisen, um den eigenen Reichtum unter Beweis zu stellen. Christian Rach testet eine mittelalterliche Würzpaste. Ein Erlebnis, das nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen ist. Doch der menschliche Gaumen erträgt einiges, wenn er sich nur daran gewöhnt. Denn schließlich ist der Mensch, neben Ratte und Schwein, das einzige Lebewesen, das alles essen kann. Wenn es denn will. Die Reihe berichtet Wissenswertes, Skurriles und Amüsantes aus den Küchen der Zeiten. Christian Rach erlebt selbst, was es hieß, ein steinzeitlicher, mittelalterlicher oder neuzeitlicher Koch zu sein. Bei manchem ist es schade, dass es in Vergessenheit geriet, anderes dagegen ist aus gutem Grund wieder vom Herd verbannt worden. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 28.03.2015 ZDFneo Die Geschichte des Essens: 2. Hauptspeise
45 Min.Warum essen wir, was essen wir, und wie hat sich das entwickelt? Sternekoch Christian Rach begibt sich auf eine Reise durch die Kulturgeschichte des Kochens und des Essens. Die Fähigkeit, Speisen auf dem Feuer zuzubereiten, ist so alt wie die Menschheit. Doch bis zu den Menüs, wie wir sie heute kennen, hat es Jahrtausende gedauert. Jede Zeit hatte ihre Rezepte, Zutaten und Techniken. Christian Rach stellt sie vor. Über Jahrhunderte gilt in Deutschland Fleisch als das wertvollere Essen im Vergleich zu Gemüse, Früchten oder Fisch. Das Ergebnis: Deutschland ist Wurstweltmeister, 1500 Sorten wurden hierzulande entwickelt.Doch auf die Idee, Fleisch durch Erhitzen verdaulicher zu machen, musste man erst einmal kommen. Christian Rach lernt, eine Steinzeitsuppe im Felltopf zu kochen. Wenn man es weiß, ist es ganz einfach: Ein Fell in eine Vertiefung am Boden legen, Wasser und Zutaten dazu, anschließend heiße Steine wie einen Tauchsieder einführen, fertig ist ein brodelndes Gebräu. Und es schmeckt besser als erwartet. Die Küche der späteren Jahrhunderte hielt dann schon raffiniertere Genüsse bereit. Auch wenn die verspeisten Tiere uns heute etwas befremdlich anmuten: Biber oder Otter, Schwäne, Kraniche, sogar Flamingos oder Pfauen wurden aufgetischt. An des Königs oder Fürsten Tafel dann auch gern als Schaugericht präsentiert, wie Kalbskopf auf Fleischfladen mit Blumen aus Eiweiß oder Huhn im Glas mit aufgeblasener Haut. Gegessen wurde so etwas eher nicht, doch man stellte seinen Reichtum und Erfindungsgeist damit zur Schau. Und die Beilagen? Die Kartoffel, die noch immer auf den allermeisten Tischen gereicht wird, hatte es schwer, sich durchzusetzen. Erst höchste Anweisung durch Preußenkönig Friedrich II. machte sie salonfähig. Gemüse setzte sich schrittweise durch, erst Recht, seitdem man um seinen Vitaminreichtum weiß. Wie viel verzehrt wurde, macht heute staunen. So verputzte ein Steinzeitmensch zwischen 4500 und 5000 Kalorien am Tag. Er benötigte sie auch, um das körperlich anstrengende Leben zu meistern. Doch auch noch im Mittelalter nahmen Menschen, sofern nicht gerade Missernten, Kriege oder Dürren herrschten, bis zu 4000 Kalorien täglich zu sich. Fatale Auswirkungen hatte eine solche Ernährung bei denen, die sich nicht mehr körperlich betätigen mussten. Dass die Klosterbrüder des Mittelalters wohlbeleibt waren, ist kein Gerücht. Sie brachten es bisweilen auf bis zu 10 000 Kalorien am Tag. Von einer gepflegten Tafel war Wein über viele Jahrhunderte nicht wegzudenken. Im Kloster Eberbach im Rheingau erfährt Christian Rach, was es hieß, die Trauben von Hand zu lesen und in hölzernen Keltern zu pressen. Ein Aufwand, der gern in Kauf genommen wurde. Denn der Konsum von Wein und auch Bier lag früher aufgrund der oft schlechten Wasserqualität höher als heute. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 11.04.2015 ZDFneo
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail