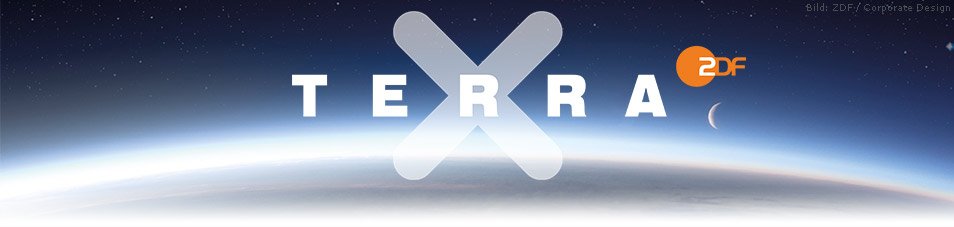1525 Folgen erfasst (Seite 22)
Die Geschichte des Essens: 3. Dessert
45 Min.Warum essen wir, was essen wir, und wie war die Entwicklung? Sternekoch Christian Rach begibt sich auf eine Reise durch die Kulturgeschichte des Kochens und des Essens. Die Fähigkeit, Speisen auf dem Feuer zuzubereiten, ist so alt wie die Menschheit. Doch bis zu den Menüs, wie wir sie heute kennen, hat es Jahrtausende gedauert. Jede Zeit hatte ihre Rezepte, Zutaten und Techniken. Christian Rach stellt sie vor. Ernährungsexperten sind die Nachspeisen suspekt: Sie gelten als dekadent, unnötig und in größeren Mengen sogar als schädlich.Aber genau das ist es ja, was Süßspeisen so reizvoll macht. Christian Rach begibt sich auf die Reise durch die Geschichte von Kuchen und Pudding, Pralinen und Schokolade. Unsere Vorstellung von Nachtisch oder Dessert entwickelt sich erst im 17. Jahrhundert an den Höfen Frankreichs. Vorher isst man in gehobenen Kreisen Europas noch „Buffet-Stil“: Alles kommt auf einmal auf den Tisch, süß und salzig werden nicht getrennt. Ein Großteil der Buffets ist ohnehin gesüßt, denn Zucker gilt als gesund. Man süßt auch Taubenragout, Nieren-Pudding, Austern oder Fisch. Dann wandelt sich der Geschmack. Man geht dazu über, Süßes und Salziges zu trennen. Und allmählich entwickelt sich ein eigener letzter, ausschließlich süßer Gang: unser Dessert. Seit die Kreuzritter im 12. Jahrhundert den Zucker aus dem Nahen Osten mitbrachten, ist er ein Prestigeobjekt, das anfangs sogar in Gold und Silber aufgewogen wird. Der industrielle Anbau von Zuckerrohr in der Karibik macht den Zucker preiswerter, doch er bleibt ein Zeichen von Wohlstand und Macht. Zuckerbäcker und Patissiere gelten in der Renaissance als Künstler und gestalten die Tafeln der Adligen mit ihren Zuckerkreationen. Die größten Zucker-Extravaganzen leistete sich die Handelsstadt Venedig. Prominente auswärtige Gäste und Herrscher werden mit süßen Festmahlen beeindruckt. Es gibt Zucker-Skulpturen von Päpsten, Königen, Kardinälen, Göttern und Tieren, und bisweilen werden ganze Gedecke täuschend echt aus Zucker geformt. Praktisch: Zerbrach ein Teller oder eine Gabel, konnte man die Reste gleich verspeisen. Pudding, die deutsche Süßspeise schlechthin, hat ihren Namen eigentlich von einer Fleischspeise, die schon die alten Griechen kannten. In Italien nannte man sie „Budino“, in Frankreich „Boudain“. Das bedeutete ursprünglich: „Wurstteig im Darm“. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Füllung des Darms süß. Und dann wurde der Darm durch ein Tuch oder eine Blechform ersetzt. Der Name Pudding ist geblieben. Christian Rach testet eines der ältesten erhaltenen Kuchenrezepte der Welt. Um etwa 1400 vor Christus von den Sumerern in Keilschrift niedergeschrieben und durchaus schmackhaft. In Tirol versucht er sich als „Eisschnellläufer“. Auch im alten Rom trank man schon eisgekühlte Getränke. Kaiser Nero liebte wohl gecrushtes Eis mit Sirup, den antiken Smoothie. Und er hatte gleich mehrere Sklaven abgestellt, ihm das begehrte Eis zu besorgen. Nicht nur der Kaiser, auch andere reiche Bürger, sogar Fischhändler verfügten über solche Läufer, die gepresste Schneeblöcke aus den nahe gelegenen Bergen und den Alpen in die Stadt brachten. Christian Rach geht auch der Frage nach, was es mit den „Kaffeepolizisten“ auf sich hatte, die Friedrich der Große in den Straßen Preußens schnüffeln schickte und warum Schokolade so lange als suspekt galt. Die Reihe berichtet Wissenswertes, Skurriles und Amüsantes aus den Küchen der Zeiten. Christian Rach erlebt selbst, was es hieß, ein steinzeitlicher, mittelalterlicher oder neuzeitlicher Koch zu sein. Bei manchem ist es schade, dass es in Vergessenheit geriet, anderes dagegen ist aus gutem Grund wieder vom Herd verbannt worden. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 18.04.2015 ZDFneo Die Geschichte des Lebens: 1. Wasserwesen
45 Min.Deutsche TV-Premiere Mo. 29.01.2007 ZDF Die Geschichte des Lebens: 2. Landgänger
45 Min.Deutsche TV-Premiere Di. 30.01.2007 ZDF Die Geschichte des Lebens: 3. Himmelsstürmer
45 Min.Deutsche TV-Premiere Mi. 31.01.2007 ZDF Die Geschichte des Lebens: 4. Menschen
45 Min.Deutsche TV-Premiere Do. 01.02.2007 ZDF Die Geschichte von Pferd und Mensch – Equus
45 Min.Wann, wo und wie wurde erstmals das Pferd gezähmt? Der Film folgt den Spuren einer einzigartigen Beziehung zwischen Menschen und einem Tier, eine Beziehung, die die Welt verändert hat. Der Film zeigt die letzten Reiternomaden der Erde, Pferdezüchter, Trainer, archäologische Stätten und Laboratorien auf drei Kontinenten und lässt sowohl das Urpferdchen als auch steinzeitliche Kulturen wieder auferstehen, die das Pferd vor 6000 Jahren gezähmt haben. Die Dokumentation ist eine Reise in die Geschichte der Menschheit und in die Biologie des Pferdes. Wie und warum hat der Mensch das Pferd gezähmt, und warum scheinen beide wie füreinander gemacht zu sein? Auf der Suche nach einer Antwort reiste ein deutsch-kanadisches Filmteam zwei Jahre lang um die Welt: von den letzten noch lebenden Reiternomaden im Altai-Gebirge zu archäologischen Stätten im heutigen Kasachstan, von der Grube Messel mit ihren einzigartigen Fossilien zu Ranchern in den USA und Tierpsychologen in England.Entstanden sind eindrucksvolle Bilder der einzigartigen Beziehung zwischen Mensch und Pferd. Der Film ist Zeuge, wie Evolutionsbiologen das Fossil des Urpferdchens zum ersten Mal virtuell zum Leben erwecken und Forscher die ersten Reiter entdecken: ein heute verschwundenes Volk, das vor 6000 Jahren das Pferd als Erstes domestizierte – aus einem ganz anderen Grund, als wir heute annehmen würden. Genetiker zeigen, wie eine zentralasiatische Reiterkultur vor knapp 5000 Jahren auf dem Rücken der Pferde nach Europa kam und vieles von dem nach Europa brachte, was wir heute als ureuropäisch betrachten würden, zum Beispiel auch die helle Hautfarbe. Bei dieser Einwanderungswelle wurden 90 Prozent der damaligen europäischen Ur-Bevölkerung ersetzt – ohne Blutvergießen, aber dennoch auf eine unerwartete und dramatische Art und Weise – durch das Einschleppen der Pest. Die Zähmung des Pferdes hat Europa, Asien und die ganze Welt für immer verändert. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 24.07.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 28.07.2019 ZDF Gigant aus Eis und Schnee
Gigant der Meere: Die Flotte des Admirals Zheng He
- Alternativtitel: Die Drachenflotte des Admirals Zehng He
Anfang des 15. Jahrhunderts verlässt eine der gewaltigsten Flotten der Weltgeschichte ihren Heimathafen, kommandiert von dem kaiserlichen Groß-Eunuchen Zheng He. Beladen mit Seide, Porzellan und anderen Kostbarkeiten sollen die Schiffe die Reichtümer der chinesischen Hochkultur in die unbekannte Welt jenseits des Chinesischen Meeres tragen. Der Ming-Kaiser Yong-le hatte den Bau der gewaltigen Flotte befohlen, und es wird seinen Schiffen tatsächlich gelingen, in friedlicher Mission bis nach Afrika vorzudringen. Im Hafen von Tai Ping lichten die 300 Schiffe im Jahre 1405 erstmals die Anker und nehmen Kurs nach Westen.Es ist die erste von sieben Entdeckungsreisen, mit der die Chinesen Seefahrergeschichte schreiben werden. Erst 100 Jahre später sollten den Europäern ähnliche Navigationsleistungen gelingen. Gigantisch sind allein schon die Ausmaße der Flotte: 120 Meter lang und 50 Meter breit glichen die Dschunken schwimmenden Städten, Admiral Zheng He befahl über 28 000 Mann Besatzung. Roter Faden dieses dokumentarischen Epos’ ist die Lebensgeschichte des Admirals, des größten Seefahrers in der Geschichte Asiens. Wie wurde dieser Eunuch moslemischen Glaubens zum engsten Vertrauten des Kaisers? Wie schaffte er es, in nur zwei Jahren Bauzeit die größte Flotte der Welt bauen zu lassen? Was war Ziel und Ergebnis der Entdeckungsreisen? Der Film profitiert hierbei in besonderem Maße von computergenerierten Szenen, mit denen die Expeditionsflotte zum Leben erweckt wird. Für die Reenactments wurden Teile der Werftanlagen und des gigantischen Flaggschiffs der Armada nachgebaut. Die Zuschauer inspizieren die gewaltigen Aufbauten der Dschunken, gleiten durch den mittelalterlichen Hafen von Nanjing, wo die schwimmenden Ungetüme vor Anker liegen, und erleben schließlich, wie die riesige Flotte den Ozeanstürmen trotzt. Überraschende Erkenntnisse treten zutage: 500 Jahre vor den Europäern entwickelten die Chinesen die Schottenbauweise, die die Schiffe unsinkbar machte. Und Admiral Zheng He besiegte den Skorbut, die tödliche Seefahrerkrankheit: Auf segelnden Agrarschiffen wurden frisches Gemüse und Sojasprossen mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt angebaut. Nach sieben erfolgreichen, friedvollen Fahrten bis nach Afrika befahl der Kaiser plötzlich die Einstellung aller Übersee-Expeditionen. Die stolze Flotte des Zheng He verrottete in den Häfen, das Reich der Mitte hatte sich wieder in seine Grenzen zurückgezogen. Die friedliche Mission der Flotte dient dem chinesischen Selbstverständnis heute als Beispiel für ein genügsames China, das keine Angriffskriege führt. Zheng He, dieser so einfallsreiche, multi-kulturelle Befehlshaber, wird noch heute wie ein Pop-Held von den Chinesen verehrt. Seine Expeditionen sind ein Kapitel der Weltentdeckung und bieten faszinierende Einblicke in die kulturellen und technischen Errungenschaften Chinas. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 01.10.2006 ZDF Giganten der Kunst: 1. Vincent van Gogh
45 Min.„Das Bildnis des Dr. Gachet“ von Vincent van Gogh wurde f¸r 75 Millionen Dollar versteigert.Bild: zdf / Lena Gr‰f / ZDF und Lena Gr‰f / © THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Lena Gr‰f.Wie wurde aus einem vermeintlichen Dilettanten einer der berühmtesten Künstler der Welt? Die „Terra X“-Doku „Giganten der Kunst – van Gogh“ zeichnet ein packendes Bild des Künstlers. Sie haben Grenzen gesprengt und Kunst für die Ewigkeit geschaffen: van Gogh, Rembrandt und Michelangelo. Diese Folge der „Terra X“-Reihe „Giganten der Kunst“ zeichnet ein neues, packendes Bild des Ausnahmekünstlers Vincent van Gogh. Seine Gemälde gehören heute zu den berühmtesten und teuersten der Welt. Wer war Vincent van Gogh? Ein Wahnsinniger oder ein tragisches Genie? Forscher sezieren mit neuesten Methoden seine Werke, wollen dem Geheimnis seiner Kunst auf die Spur kommen.Moderne Animationstechnik zeigt seine Meisterwerke in nie da gewesener Detail-Tiefe. Neue technische Analysen vermitteln verblüffende Erkenntnisse. Die Dokumentation zeichnet auf Basis seiner Brief-Korrespondenz ein differenziertes Bild des Menschen und Künstler Vincent van Gogh. Aufwendige Spielszenen lassen die wichtigsten Etappen seines Lebens und Schaffens lebendig werden. Sein tragisches Leben, seine Selbstverletzung am Ohr, seine rätselhaften Anfälle, sein dramatischer, viel zu früher Tod, die Wirkung seiner unverkennbaren Bilder – diese Zutaten haben Vincent van Gogh laut Umfragen zum bekanntesten Maler aller Zeiten gemacht. Zugleich verkörpert der Niederländer wie kaum ein anderer Künstler den Typus des irren Genies. Aber war Vincent van Gogh wirklich verrückt? Sind seine Bilder tatsächlich das Produkt eines Wahnsinnigen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der „Terra X“-Dokumentation. Gemeinsam mit den van Gogh-Experten Nienke Bakker, Louis van Tilborgh und Steven Naifeh folgt sie den Spuren von Vincent van Goghs Leben und zeichnet auf Basis seiner Brief-Korrespondenz ein differenziertes Bild des Menschen und Künstler Vincent van Gogh. Und sie zeigt, wie holprig van Goghs Weg in die Kunst war: Als Spätberufener zur Malerei gekommen, droht er anfangs am Handwerk zu scheitern. Erst vier Jahre vor seinem Tod wird aus dem Dilettanten einer der größten Maler aller Zeiten – ein Gigant der Kunst, der mit seinen rhythmischen Pinselstrichen und seinen leuchtenden Farben die Kunst seiner Zeit revolutioniert hat und ein gigantisches Werk hinterlässt. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 23.02.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 27.02.2022 ZDF Giganten der Kunst: 2. Rembrandt
45 Min.Rembrandt Van Rijn (Sven Hussock)Bild: ZDF / THE HISTORY CHANNELSeine Bilder blicken in die Seele der Menschen. Die „Terra X“-Doku „Giganten der Kunst – Rembrandt“ offenbart das Geheimnis des großen Meisters Rembrandt van Rijn. Rembrandt ist begehrt: bei Dieben und Museen. Eines seiner Gemälde, „Porträt von Jacob de Gheyn III“, zählt zu den am häufigsten geraubten Kunstobjekten der Welt. Die Dokumentation lüftet das Geheimnis des barocken Genies, das mit seinen Werken die Menschen verzaubert. Ohne einen „Rembrandt“ kommt heute keine Kunstsammlung von Rang und Namen aus. Mit seinen Porträts scheint der holländische Künstler direkt die Seele der Menschen zu erfassen.Rembrandt Harmenszoon van Rijn, 1606 als Sohn eines Müllers geboren, hat die Kunstwelt beeinflusst wie kaum ein anderer. Aber wer war dieses barocke Genie, das die Menschen durch die Jahrhunderte verzaubert? Rembrandt van Rijn führt lange ein Leben im Licht, bevor die Schatten ihn in die Tiefe reißen. Seine Biografie ist durchsetzt von Schicksalsschlägen und familiären Verwirrungen. Seine erste Frau Saskia verliert drei Kinder, erst das vierte, Titus, überlebt. Sie selbst stirbt mit 29 Jahren. Danach hat Rembrandt ein jahrelanges Verhältnis mit seiner wesentlich jüngeren Haushälterin, die ihn geschickt vor dem kompletten geschäftlichen Ruin bewahrt. Sie stirbt wie sein Sohn Titus an der Pest. Als der Malergigant mit 63 Jahren stirbt, ist er vereinsamt, verarmt und unverstanden. Die zweite Folge der „Terra X“-Reihe „Giganten der Kunst“ spürt Rembrandts Wurzeln in seiner holländischen Heimat Leiden und Amsterdam nach, reist aber auch zu Forschern nach Dresden und Boston. Der Film ist hautnah bei einem der größten Restaurierungsprojekte der Kunstgeschichte dabei, der „Operation Night Watch“ im Rijksmuseum. Er folgt Jan Six, einem berühmten Kunstexperten, der schon drei echte, bis dahin unbekannte Rembrandts aufgespürt hat. Und zeigt ein gewagtes Experiment, in dem künstliche Intelligenz einen neuen Rembrandt schaffen soll. Rembrandt inspirierte nachfolgende Künstler dazu, sich von Konventionen zu befreien und sich gänzlich der Kunst zu widmen. Ein Symbol für diese Freiheit und gleichzeitig Rembrandts Markenzeichen wurde später weltberühmt: das Barett als Kopfbedeckung der Unangepassten. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 23.02.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 10.07.2022 ZDF Deutsche TV-Premiere ursprünglich für den 06.03.2022 angekündigtGiganten der Kunst: 3. Michelangelo Buonarroti
45 Min.In jahrelanger harter Arbeit erschuf Michelangelo die weltber¸hmten Fresken der Sixtinischen Kapelle in Rom.Bild: Tamira Coldeway / ZDF und Tamira Coldeway / zdf / © THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Tamira Coldeway.Schon seine Zeitgenossen nannten Michelangelo den „Göttlichen“. Die „Terra X“-Doku „Giganten der Kunst – Michelangelo“ zeigt seinen aufregenden Aufstieg in den Künstlerolymp. Erzählt wird in packenden Spielszenen das Leben des Universalgenies. Und seine einzigartigen Statuen werden mit moderner 3-D-Animationstechnik sinnlich erfahrbar gemacht. Wer kennt ihn nicht, den „David“. Die berühmteste Statue der Kunstgeschichte. Ein Kunstwerk für die Ewigkeit. Sein Schöpfer: Michelangelo Buonarroti, der schon von seinen Zeitgenossen den Beinamen der Göttlichen bekam.Was trieb diesen Künstler an, der in seiner Zeit, der Renaissance, die Bildhauerei und Malerei revolutionierte und in der Architektur neue Maßstäbe setzte? Die „Terra X“-Doku taucht ein in das Leben des Universalgenies und beleuchtet anhand neuester Forschungsergebnisse einen Künstler, der noch längst nicht enträtselt ist. In packenden Spielszenen zeigt der Film Krisen und Kämpfe im Leben und Schaffen Michelangelos und macht so seinen Charakter bewegend lebendig: seine Kindheit mit dem jähzornigen Vater; seine Ausbildung am Hof der Medicis; seine Kämpfe mit den Päpsten; seine Liebe zur Seelenfreundin Vittoria Colonna; sein Leben für die Kunst, für die er sich körperlich und seelisch vollends verausgabt, zeitlebens zerrissen zwischen der Sehnsucht nach idealer Schönheit und Selbstzweifeln. Im Alter von gerade einmal 23 Jahren schafft Michelangelo mit der römischen „Pietà“ sein erstes Meisterwerk – und bricht mit allen Traditionen: die mädchenhaft junge und schöne Maria, der Körper des toten Christus von Leben durchpulst, als würde er schlafen. Auch mit seinem „David“ – aus einem 7 Meter hohen Marmorblock gehauen – bricht er Tabus: Ein anatomisch perfekter Körper als Ausdruck der Freiheit und Souveränität des Geistes. Aber auch als Freskenmaler schafft Michelangelo Kunstwerke von monumentaler Größe. Als er vom Papst das Angebot bekommt, das Deckengewölbe der Sixtinischen Kapelle zu schmücken, hat er noch nie Fresken gemalt – und nimmt den Auftrag dennoch an. Vier Jahre sperrt er sich in der Sixtina ein, arbeitet unter schlimmsten Entbehrungen fast Tag und Nacht. Am Ende hat er ein Deckenfresko geschaffen, wie man es bis dahin noch nicht gesehen hat: Die Schöpfungsgeschichte, deren ikonografisches Highlight „Gott erschafft Adam“ fast jedes Kind kennt. Seine Figuren wirken fast dreidimensional, der Bildhauer Michelangelo malt auch wie ein Bildhauer. Eine Wirkung, welche die Dokumentation mithilfe moderner 3-D-Animationstechnik sinnlich erfahrbar macht. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 23.02.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 17.07.2022 ZDF Deutsche TV-Premiere ursprünglich für den 13.03.2022 angekündigtGiganten der Kunst: 4. Caspar David Friedrich
45 Min.Seine Ausstellungen brechen Besucherrekorde, seine Bilder berühren zutiefst. „Terra X – Giganten der Kunst“ begibt sich auf Entdeckungsreise durch Leben und Werk Caspar David Friedrichs. Seine Bilder bestechen auch heute noch durch ihre Einfachheit und ihre Wucht. Und sie wühlen auf. Die Dokumentation „Terra X – Giganten der Kunst“ offenbart, warum der Maler Caspar David Friedrich mit seinem Werk noch immer berührt und verstört. Der Dichter Heinrich von Kleist sagte über eines seiner berühmtesten Bilder, dem „Mönch am Meer“, dass es ihm bei der Betrachtung so vorkomme, als seien ihm die Augenlider abgeschnitten.Wer sich auf die Bilder Caspar David Friedrichs einlässt, wird von ihrer Magie gefangen genommen. Für den Maler wird die Natur zu einem Rettungsanker und zu einer Quelle der Inspiration. In seiner frühen Kindheit erlebt er den Tod der Mutter und Schwester. Mit 13 Jahren ertrinkt sein Bruder vor seinen Augen, nachdem dieser Caspar David aus einem Eisloch in einem zugefrorenen See gerettet hat. Es sind die lebensverändernden Brüche, die bei Friedrich den persönlichen künstlerischen Ausdruck hervorbringen. „Terra X – Giganten der Kunst“ begibt sich auf eine visuelle Entdeckungsreise durch sein Gesamtwerk und zeigt auf, wie der Künstler in seiner Malerei collagenartig Orte erschafft, die er tatsächlich nie gesehen oder besucht hat. Gerade das Werk und die Persönlichkeit von Caspar David Friedrich spornen an, neu entdeckt zu werden. Er gilt als bedeutendster Vertreter der Romantik. Die Dokumentation beleuchtet in emotionalen und visuell fesselnden Spielszenen die Momente seiner Biografie, die verständlich machen, wie große Kunst entstehen kann. Forschende untersuchen und dechiffrieren die Genese und Substanz seiner Meisterwerke und zeigen auf, wie modern seine Bilder noch heute sind. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 30.07.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 03.08.2025 ZDF Giganten der Kunst: 5. Gustav Klimt
45 Min.Seine Bilder provozieren mit sinnlicher Nacktheit in Gold. „Terra X: Giganten der Kunst“ erkundet Leben und Werk des geheimnisvollen Ausnahmekünstlers Gustav Klimt. Ob in Wien, New York oder Tokio: Seine Kunst zieht die Massen an, seine Werke werden zu Rekordsummen gehandelt. er zählt zu den bekanntesten und zugleich geheimnisvollsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Klimt ist ein Mann der Widersprüche: traditionsbewusst und grenzüberschreitend. Ein Feminist und Schürzenjäger. Ein liebevoller Familienmensch und beziehungsunfähig. Der scheue Mann aus einfachen Verhältnissen wird im Wien der Jahrhundertwende zum Anführer einer Künstlerrevolution, der Secession.Statt gefälliger Historienmalerei zu liefern, experimentiert er mit abstrakten Symbolen, mit Gold als Stilelement und provozierenden Inhalten. Seine Freizügigkeit sorgt für viele Skandale. Klimts Privatleben würde heute die Klatschspalten und sozialen Medien beherrschen. Unter seinem blauen Malerkittel soll er nichts getragen haben, er hatte Verhältnisse mit vielen seiner Modelle. Sechs uneheliche Kinder gehen daraus hervor. In der emanzipierten Modeschöpferin Emilia Flöge, die ihrer Zeit weit voraus war, findet er eine Seelenverwandte. Sie inspiriert Klimt und beeinflusst sein Werk. Sein Gemälde „Der Kuss“ gehört zu den weltweit bekanntesten Bildern überhaupt und steht damit auf einer Stufe mit Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ oder Edvard Munchs „Der Schrei“. Unzählige Liebespaare posieren vor dem Original im Wiener Museum Belvedere. Doch kaum einer weiß, wer auf dem Bild dargestellt ist. Forschende unterschiedlichster Fachrichtungen untersuchen und dechiffrieren die Entstehung von Klimts Meisterwerken. In visuell fesselnden Spielszenen verfolgt die Dokumentation „Terra X: Giganten der Kunst“ den künstlerischen Prozess Gustav Klimts und versucht, das Geheimnis seiner Kunst zu lüften. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 10.08.2025 ZDF Giganten der Kunst: 6. Frida Kahlo
45 Min.Sie gilt als die berühmteste Malerin der Welt. „Terra X: Giganten der Kunst“ erzählt über das dramatische Leben von Frida Kahlo und zeigt auf, warum ihre Werke Millionen von Menschen berühren. Sie ist der Superstar ihrer eigenen Bilder. Frida Kahlos Werk ist ein Publikumsmagnet, obwohl die meisten ihrer Gemälde von Schmerz und Verzweiflung erzählen. Ihre Malerei fasziniert dabei auch sehr junge Menschen. Was war die Triebfeder ihrer ungeheuren Kreativität und welche Frau verbirgt sich hinter diesen Bildern? In enger Zusammenarbeit mit Forschern ist „Terra X – Giganten der Kunst“ dem Mythos Frida Kahlo auf der Spur und setzt nach und nach ein spannendendes Mosaik einer außergewöhnlichen und vielschichtigen Künstlerin zusammen, die gleichzeitig Rebellin, Liebende und Leidende war.Geboren 1907 in Coyoacán, Mexiko, war Kahlos Leben von Dramen gezeichnet. Schon als Kind ist Frida körperlich beeinträchtigt, wird zum Gespött anderer Kinder. Ein schwerer Busunfall zerstört jäh Fridas Lebenspläne und wird zum Motor ihrer Kunst. Ihre Ehe mit dem mexikanischen Künstler Diego Rivera war ein Wechselspiel aus Liebe, Verrat und künstlerischer Inspiration. Mit visuell opulenten und emotional packenden Spielszenen erweckt „Terra X“ die Malerin und ihr Werk zum Leben. Die Dokumentation erzählt Frida Kahlo im Kontext ihrer Zeit und folgt ihren Spuren von Mexiko-Stadt über New York und Paris, wo sie mit Künstlern wie André Breton und Pablo Picasso zusammentraf. „Terra X: Giganten der Kunst“ beleuchtet, warum Frida Kahlos Kunst bis heute nichts an Relevanz verloren hat, und warum die Künstlerin mit ihrem Mut, sich selbst treu zu bleiben, heutzutage ein role model vieler junger Menschen ist. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 17.08.2025 ZDF Giganten der Meere: Die Welt der Megafrachter und der Kreuzfahrtriesen
45 Min.Die globale Wirtschaft wäre ohne Schiffe nicht denkbar. Sie transportieren 90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs. Dieser Film dokumentiert die Bedeutung und die Geschichte dieser Giganten. Wie sie gebaut werden, wie die ausgeklügelte Logistik auf den Weltmeeren funktioniert, was Spezialschiffe leisten, aber auch welche umweltfreundlicheren Alternativen in der Entwicklung sind, zeigt diese „Terra X“-Dokumentation mit Beispielen aus aller Welt. Während die Kreuzfahrt dem Ende der Pandemie entgegenfiebert, befindet sich die Handelsschifffahrt ungebremst auf Kurs.Nach einem kurzen Einbruch ist das Transportvolumen sogar gestiegen, der Konsum läuft auch im Lockdown auf Hochtouren. Von einer Werft in China und der Überführung eines Kreuzfahrt-Giganten geht die Reise zu Europas umschlagstärkstem Seehafen in Rotterdam, wo an einem völlig automatisierten Terminal Zehntausende Container pro Woche abgefertigt werden. Vorgestellt wird zudem ein außergewöhnliches Frachtschiff, ein sogenannter Halbtaucher, der theoretisch 422 Airbus A380 auf seinem Rücken tragen könnte. Originelle Computeranimationen verdeutlichen diesen und andere Vergleiche. Zu welch extremen Leistungen Spezialschiffe fähig sind, wird unter anderem an dem leistungsfähigsten Hochsee-Schlepper der Welt deutlich. Eindrucksvolle Bilder dokumentieren, wie es damit gelingt, eine 31 000 Tonnen schwere Bohrinsel um den halben Globus zu transportieren. Und im hohen Norden Finnlands kreuzen starke Eisbrecher als Retter in der Not. Die Aufnahmen zeigen, wie die „Polaris“ riesige Frachter befreit, die im Eis festsitzen. Aber nicht nur die Extreme bestimmen diesen Film. Es geht auch um die Kritik an der modernen Seefahrt. Denn die meisten Transport- und Kreuzfahrtschiffe fahren nach wie vor mit umweltschädlichem Schweröl. Dabei sind umweltfreundlichere Alternativen bereits auf dem Wasser unterwegs. Außergewöhnlich ist der „Energy Observer“, ein Katamaran, der als Forschungsschiff mit einem Energiemix aus Wasserstoff, Sonnenenergie und Windkraft zum Zeitpunkt der Dreharbeiten durch die Wellen Norwegens pflügte. Dieser Film bildet den gesamten Lebenskreislauf großer Schiffe ab. Dazu gehört auch ein Blick dorthin, wo nach drei Jahrzehnten im Einsatz ausrangierte Giganten der Meere landen. Die Kamera ist dabei, wenn ein tonnenschwerer Frachter auf einem Schiffsfriedhof an der pakistanischen Küste zerlegt wird – unter schwierigsten Bedingungen: vor allem für die Menschen, die dort arbeiten. Personal und Passagiere von Kreuzfahrtschiffen hat vor allem die Corona-Pandemie stark zugesetzt: Seit Anfang 2020 bewegt sich kaum noch eines dieser schwimmenden Hotels. Die Flotten ruhen, an Bord ist nur eine Notbesatzung. Zwei Schiffe einer deutschen Reederei liegen an der Pier in Bremerhaven. „Terra X“ dokumentiert, wie sich das Unternehmen auf einen Neustart vorbereitet: unter anderem mit Investitionen in neue Luftfilter, die die Passagiere noch besser vor Viren schützen sollen. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise über die Meere der Welt und fasst zusammen, was sonst oft nur in Teilaspekten beleuchtet wird: vom Leben und Vergehen, von der Geschichte und der Zukunft der „Giganten der Meere“. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.05.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 16.05.2021 ZDF Das Gold der Zaren: 1. Glanz und Blut
Das Gold der Zaren: 2. Schätze und Intrigen
Das Gold der Zaren: 3. Rausch und Elend
Goldrausch am Yukon – Glücksritter im Norden Kanadas
45 Min.Gold regiert die Welt, wie so oft in Krisenzeiten. Das glänzende Edelmetall ist so begehrt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Schlagzeilen in den einschlägigen Fachzeitungen wollen nicht abreißen, die Kurse an den internationalen Finanzmärkten explodieren. Schon längst übersteigt die Nachfrage das Angebot, die großen Minen stehen am Rand ihrer Kapazität. Junge Glücksritter glauben an einen neuen Goldrausch und eilen zu den Hot Spots rund um den Globus auf der Jagd nach freien Claims. Sie haben viel investiert in der Hoffnung, das schnelle Geld zu machen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 14.08.2011 ZDF Gorillas – Flüchtlinge im Bergwald
Das Grab der Schamanin – Ein Geheimnis aus der Steinzeit
45 Min.Auch der Panzer einer Sumpfschildkröte wurde im Grab der Schamanin gefunden. Diente der Panzer als Gefäß zum Anrühren von Medizin oder gehörte das lebende Reptil zu den Totemtieren der Schamanin?Bild: ZDFDie Schamanin von Bad Dürrenberg: Vor 9000 Jahren von ihren Zeitgenossen verehrt, 1934 von den Nazis entdeckt und für Propaganda missbraucht. Erst vor Kurzem wurde ihr Geheimnis gelüftet. Die aktuelle Untersuchung dieser außergewöhnlichen Frau enthüllt nicht nur spektakuläre Erkenntnisse über das Leben in der Mittelsteinzeit, sondern spiegelt auch die brandaktuelle Diskussion in der Archäologie: Wie viel Fake News verbergen sich in Wissenschaft? Im Fall der Schamanin könnte die Fehlinterpretation kaum gravierender sein.Im Nationalsozialismus deutete man das für die Mittelsteinzeit außergewöhnlich reiche Grab als letzte Ruhestätte eines bedeutenden Mannes. Der als arischer, weißer Vorfahr der Deutschen reklamierte Fund sollte die Rassentheorie stützen. Heute kann die Paläogenetik zweifelsfrei beweisen, dass die bestattete Person keineswegs zum frei erfundenen Bild des männlichen, heroischen Ur-Ariers passt. Zunächst einmal handelt es sich bei dem in Bad Dürrenberg entdeckten Skelett um die Überreste einer Frau. Sie gehörte zu den Jägern und Sammlern der Mittelsteinzeit. Wie alle frühen Europäer hatte sie einen dunklen Teint. Die helle Hautfarbe entwickelte sich erst später im Zusammenhang mit dem Konsum von Milchprodukten. Bauern und Viehzüchter aus Anatolien waren einige 1000 Jahre nach der Frau von Bad Dürrenberg die ersten hellhäutigen Siedler in Europa. Die Ausstattung des Grabes ist spektakulär für die Mittelsteinzeit. Überhaupt wurden damals nur ganz wenige Menschen in Erdbestattungen beigesetzt und dann auch nur sehr selten mit Beigaben. „Wenn man eine Klinge hat“, berichtet der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Harald Meller, „kann das schon viel sein. Andere Gräber sind überhaupt nicht vergleichbar!“ Im Grab der Bad Dürrenbergerin waren über 50 Zähne von Auerochsen, Wildschweinen und Hirschen gefunden worden – viele manuell durchbohrt und offenbar Teil einer Ritualkette. Dazu diverse Steinwerkzeuge und Klingen aus Feuerstein. Eine Nachgrabung 2023 legt außerdem nahe, dass noch Jahrhunderte nach dem Tod der Schamanin Opfergaben im Umfeld ihres Grabes abgelegt wurden. Wer also war diese Frau? Wie hat sie gelebt? Welche Bedeutung hatte sie zu ihren Lebzeiten und sogar darüber hinaus? Vieles deutet darauf hin, dass die hochgeschätzte Frau eine Schamanin war. Dafür sprechen nicht nur die zahlreichen Begleitfunde, die zu einer schamanischen Ausstattung gehört haben könnten, sondern auch zwei medizinische Entdeckungen: Die Schneidezähne waren abgefeilt, was auf ein Initiationsritual hindeuten könnte. Erstaunt waren die Forscher jedoch vor allem über die Wirbelknochen des Skeletts. Eine Fehlstellung zweier Halswirbel könnte die Frau in die außergewöhnliche Lage versetzt haben, die Blutzufuhr ins Gehirn zu drosseln. Auf diese Weise hätte sie bewusst einen tranceartigen Zustand herbeiführen können. Diese Praxis barg allerdings auch Gefahren. Eine davon war ein Phänomen, das die Medizin als Nystagmus bezeichnet. Gemeint ist eine schnelle, unwillkürliche Augenbewegung. Was heute vor allem als Symptom einer Krankheit definiert ist, könnte in der Mittelsteinzeit als besonderes Kennzeichen gewertet worden sein und die Autorität einer Schamanin zusätzlich gestützt haben. Der Film begleitet die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer kriminalistischen Spurensuche, in deren Verlauf das Rätsel um die Schamanin von Bad Dürrenberg Stück für Stück gelöst wird. Fest steht: Sie war eine Frau von sehr großer Bedeutung. Mithilfe fachübergreifender Wissenschaft, von Archäogenetik über Archäologie bis hin zu modernster medizinischer Forschung, sollen ihre Lebensumstände genauer beleuchtet werden. Die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Bereichen ermöglichen es zum ersten Mal auch, eine realistische 3-D-Gesichtsrekonstruktion der Schamanin zu erstellen. Diese wiederum dient als Datenbasis für neueste VFX-Technologie: „Unreal Engine“ kombiniert mit der „MetaHuman“-Technologie. Das Ergebnis: In einer komplett digital gebauten Welt, die die Fauna und Flora der Mittelsteinzeit nach dem aktuellen Wissensstand abbildet, agiert ein Avatar der Schamanin, der ihr Äußeres so naturgetreu wie derzeit möglich wiedergibt. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 13.11.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 29.06.2025 ZDF Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 17.11.2024Gratwanderungen – Das Jahr des Alpensteinbocks
Graue Riesen – Elefanten auf der Spur
Der Griff nach den Sternen
Der große Anfang – 500 Jahre Reformation (1): Der Funke
Hat Martin Luther Michelangelo getroffen? Was geschah vor 500 Jahren, in einer Epoche tiefgreifenden Wandels? Moderator Harald Lesch beschäftigt sich mit Martin Luther und seiner Zeit. In der dreiteiligen Dokumentation taucht Harald Lesch in die Welt Martin Luthers ein, in eine Zeit voller Widersprüche, ungeahnter Zusammenhänge und Weichenstellungen, die bis heute unser Leben bestimmen. Vor 500 Jahren verändert sich die Welt. Amerika wird entdeckt, der Buchdruck erfunden, Banken gewinnen an Macht, die Renaissance erreicht ihren Höhepunkt – es ist eine Zeit, in der sich der Mensch neu erfindet.Martin Luther findet sich unerwartet auf der großen Bühne der Weltpolitik wieder, bewundert, gefürchtet und verhasst. Denn er bringt das uralte Machtgefüge der katholischen Kirche ins Wanken und bereitet den Weg für ein neues Denken. Hinter der Reformation versammeln sich mächtige Protagonisten dieser Zeit. Für sie kommt der rebellische Mönch aus Wittenberg wie gerufen. Luther wird zur Galionsfigur der Erneuerer und zum Feindbild des Papstes. Denn die Thesen Martin Luthers vom Oktober 1517 markieren den Beginn einer Revolution, durch die sich für die Menschen viel mehr ändert als nur das Verhältnis zur Kirche. Die Dokumentation schlägt einen Bogen von der Zeit der Renaissance bis heute. Moderator Harald Lesch zeigt, wie die Folgen der Reformation unsere Welt bis heute prägen. Warum zum Beispiel gibt es in Deutschland Bundesländer? Ist es Zufall, dass es bis heute nur einen einzigen katholischen US-Präsidenten gab? Und wieso trägt der berühmte Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. den Reformator sogar in seinem Namen? Teil 1 – Der Funke Im ersten Teil der Dokumentation wandert Harald Lesch über die Alpen – wie der junge Augustiner-Eremit Martin Luther im Jahr 1510. Der junge Mönch wird in einer wichtigen Ordensangelegenheit nach Rom geschickt. Unterwegs macht er Station in Florenz, damals ein Zentrum der Kreativität. Eine Art Kulturhauptstadt Europas. Michelangelo, Raffael, Botticelli – sie prägen ein neues Bild vom Menschen. Wollen wir nicht auch heute noch aussehen wie eine Skulptur von Michelangelo? Harald Lesch trainiert in einem Fitnessstudio und stellt fest: Diese Art von vernunftbetontem Verhalten, die Vervollkommnung der eigenen Person – das ist ein Erbe des Humanismus vor 500 Jahren. Als Luther schließlich Rom erreicht, besteht die „Ewige Stadt“ halb aus antikem Schutt, halb aus entstehenden Prunkbauten. Für deren Finanzierung – vor allem für den Petersdom – ziehen die Päpste damals in großem Stil Ablasshandel auf. Das wird Luther noch später beschäftigen. Sein Orden organsiert damals die Ausmalung der Sixtinischen Kapelle durch Michelangelo. Waren also Martin Luther und Michelangelo zur selben Zeit in Rom? Zwei Giganten der Weltgeschichte an einem Ort. Der Reformator hätte nur durch eine Tür gehen müssen und hätte eines der spektakulärsten Kunstwerke der Weltgeschichte entdecken können. Harald Lesch geht in Rom der Frage nach, ob Luther vielleicht doch von dem Kunstwerk beeinflusst war. Als Luther in Rom ist, wächst in Brüssel ein kränklicher Junge auf, der bald ganz Europa, einschließlich aller Kolonien in Übersee, unter seiner Herrschaft vereinigen will: Mit 19 wird Karl V. Kaiser. Da ist Luther schon Revolutionär wider Willen, von Papst Leo X. gebannt. Aber Luther erweist sich als trotzig: Der Kampf beginnt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Fr. 14.04.2017 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail