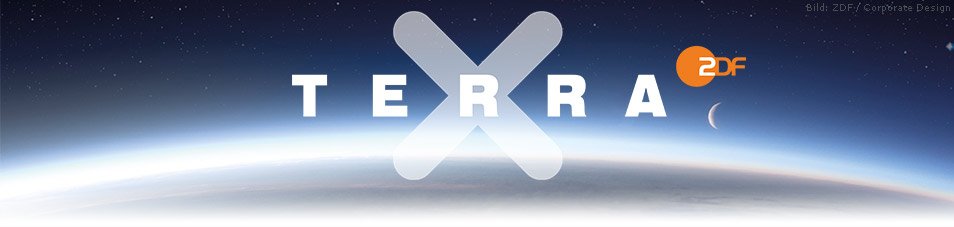1525 Folgen erfasst (Seite 23)
Der große Anfang – 500 Jahre Reformation (2): Die Explosion
Harald Lesch folgt der Spur des Geldes zu Luthers Zeiten. Welche Rolle spielen das Streben nach Reichtum, die Macht der Herrschenden, der Kirche und des Papstes? Und woher kommt der ganze Reichtum der Mächtigen? In einem heute fast vergessenen Bergwerk in Österreich stößt Harald Lesch auf erstaunliche Zusammenhänge. Die Lage der Bauern damals verschlechtert sich in weiten Teilen Deutschlands dramatisch. Sozialer Zündstoff en masse. Immer wieder flackern Aufstände im Land auf. Und nun kommen die Ideen der Reformation dazu. In vielen Gegenden regiert der Hunger. Hunderte Klöster werden um 1525 von aufgebrachten Bauern geplündert.Wer von den Mönchen nicht rechtzeitig fliehen kann, wird Opfer der zügellosen Gewalt. Die hungrigen Bauern sind empfänglich für neues Denken. Haben sie die Schriften Luthers falsch verstanden? Die Bauern haben jedenfalls Luthers Idee ernst genommen, dass jeder selbst die Bibel lesen soll. Der Prediger Thomas Müntzer verspricht den sozialen Wandel. Ursprünglich war er ein Anhänger Luthers. Aber Müntzer will die Revolution. Am Ende werden die Bauern rücksichtslos von den Truppen der Fürsten niedergemetzelt. In Frankenhausen gibt es über 6000 Tote. Für das gesamte Aufstandsgebiet liegen die Schätzungen zwischen 70 000 und 100 000 Todesopfern. In Frankenhausen entdeckt Harald Lesch einen Weg, der bis heute „Blutrinne“ heißt. Dort soll das Blut in Strömen geflossen sein. Müntzer wird grausam gefoltert und hingerichtet. Zum ersten Mal haben die deutschen Herrscher einen Massenaufstand niedergeschlagen. Ausgerechnet im Moment ihrer größten Resonanz verliert die Reformation ihre Unschuld und wird zum Anlass für eine Orgie der Gewalt. Und Martin Luther steht eindeutig auf der Seite der Gewaltherrscher. Viele Zeitgenossen haben ihn dafür heftig kritisiert. Droht die Reformation in der Welt von Wirtschaft, Politik und Krieg zu scheitern? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 16.04.2017 ZDF Der große Anfang – 500 Jahre Reformation (3): Das Feuer
Die Weltordnung des europäischen Mittelalters ist wie ein Kartenhaus. Ein ausbalanciertes Gebilde, dessen Fundament die Kirche ist, bricht unter der Kritik Luthers zusammen. Prompt nehmen an allen Ecken selbst ernannte Prediger die Rolle der Kirche ein und füllen das Vakuum. Ein besonders abschreckendes Beispiel entdeckt Harald Lesch in Münster. Zunächst waren die Täufer eine Bewegung von unten. Sie gehorchen keiner Autorität und berufen sich dabei auf Luther. Später aber wollen sie in der westfälischen Stadt ein „Neues Jerusalem“ begründen. Und sie regieren mit Gewalt. Manche nennen die Täufer heute die „Taliban des 16. Jahrhunderts“.Doch auch andere nutzen die Gunst der Stunde. So versuchen die deutschen Landesherren und zum Beispiel auch der englische König, ihre Macht zu festigen. Und in dieser politisch aufgeheizten Stimmung bekommt die Reformation auch noch ihren Sexskandal. Warum erlaubt Luther Bigamie und lässt zu, dass Landgraf Philipp von Hessen eine zweite Frau heiratet? Heute bekäme Luther dafür einen Shitstorm. Der Reformator wird weiterhin verehrt, aber die Reformation ist ihm entglitten. Die Macht seiner Worte hat er überschätzt. Luther hat Entwicklungen angestoßen, deren Folgen er nicht absehen konnte. Er wird verbittert, immer griesgrämiger und immer dicker. In dieser Zeit entstehen die sogenannten „Judenschriften“ Luthers. Harald Lesch sucht auch auf die Frage nach dem Antisemitismus des Reformators eine Antwort, spricht mit dem Lutherexperten Thomas Kaufmann und findet an der Stadtkirche zu Wittenberg ein Relief als Sinnbild des damaligen Judenhasses. Die Reformation ist zwar ohne Luther nicht denkbar, aber sie ist mehr als das. Sie hat sich emanzipiert und wurde ein Geschehen mit anderen Protagonisten und unvorhersehbarem Ausgang. Die Folgen der Reformation führen bis nach England und Amerika. Der Glaube vieler Menschen verändert sich und mit ihm die Lebensgeschichten und die Landkarte Europas – und weit darüber hinaus. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mo. 17.04.2017 ZDF Der große Bluff: Meisterbetrüger der Geschichte
Unfassbar, aber wahr: Hier wird der Eiffelturm verkauft, dort scheffelt ein Goldmacher Millionen, und ein schottischer Lord verkauft eine Kolonie, die es nicht gibt. Der große Bluff! Gibt es ein Geheimnis des Meisterbetrugs? Warum fallen wir immer wieder auf die Blender herein? „Terra X“ erzählt die Geschichten der großen Verführer und erforscht die Regeln, die ihre grandiosen Schwindeleien immer wieder zum Erfolg machen. „Terra X“ hat sich für diese Dokumentation an die Originalschauplätze der großen Gaunereien begeben: in die Hauptstädte der Welt, in legendäre Gefängnisse wie Alcatraz und in düstere Schlösser in den schottischen Highlands.Noch einmal werfen die Meisterbetrüger ihre Netze aus und spinnen den großen Coup. Der Ungar Victor Lustig ist ihr ungekrönter König, sein unglaublicher Bluff ist wirklich filmreif: Lustig verkaufte 1925 den Eiffelturm an einen Pariser Schrotthändler! 7000 Tonnen Schrottmetall, das Wahrzeichen von Paris als Alteisen zu verkaufen – so etwas gelang nur dem charmanten, einfühlsamen Lustig. Geduldig suchte er seine Opfer aus, schmeichelte sich ein, hörte ihnen zu – bis sie ihm grenzenlos vertrauten. „Terra X“ begibt sich auf die Spur dieses schillernden Betrugskünstlers. Was hat es mit seinem legendären Manifest „Zehn Gebote für den Meisterbetrüger“ auf sich? Nicht erst seit heute gibt es den Meisterbetrug, der die Finanzmärkte erschüttert und Regierungen taumeln lässt. Schon der Schotte Gregor MacGregor ging 1820 mit dem paradiesischen Land „Poyais“ in Europa hausieren und sammelte von gutgläubigen Auswanderern ein Staatsvermögen ein. Nur: Das verlockende Poyais gab es nicht! „Terra X“ begibt sich in Schottland auf Recherche zum MacGregor-Clan, wo der unheilvolle Vorfahr bis heute verehrt wird. Es war ein Geheimnis seines Erfolgs, dass der Betrug seinen Opfern so peinlich war, dass niemand ihn anzeigte. Diese Furcht der Opfer vor Hohn und Gelächter war es auch, die den Goldmacher Franz Tausend in der Weimarer Republik großmachte: Der verdiente Millionen mit der Verwandlung von krudem Metall in edles Gold. Ein Hokuspokus, dem seine Opfer nur zu gern glaubten. Die amerikanische Journalistin und Bestsellerautorin Maria Konnikova kommentiert in dieser „Terra X“-Dokumentation die grandiosen Betrügereien und verrät, warum der Betrug gar zum Wesen des Menschen gehört: „Wegen unserer Eigenschaft des Vertrauens. Denn was uns auf Hochstapler hereinfallen lässt, ist genau das, was uns als Menschen ausmacht.“ (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 10.08.2018 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 12.08.2018 ZDF Große Mythen aufgedeckt: 1. Noah und die Sintflut
45 Min.Die Geschichte von der Sintflut gehört zu den ältesten Mythen der Welt. Im Zeitalter des Klimawandels wirkt sie schockierend aktuell. „Terra X“ fragt, was es mit der Sintflut auf sich hat. In der Bibel heißt es, dass Gott beschließt, das gesamte Leben auf der Erde durch eine Mega-Überschwemmung zu vernichten. Hat die Geschichte aller fantastischen Details zum Trotz einen wahren Kern? Kann es die Sintflut gegeben haben? Und wenn ja, wann und wo? Die Geschichte von Noah und der Sintflut ist Teil der Schöpfungsgeschichte.Gerade erst hat Gott die Welt erschaffen, da trifft er die Entscheidung, sie sofort wieder zu zerstören. Den Grund dafür liefert das 1. Buch Mose gleich mit: „Der Menschen Bosheit war groß“, heißt es da, „alles Dichten und Trachten ihrer Herzen war böse.“ Eine Mega-Überschwemmung soll alle Sündhaftigkeit mit sich reißen – der fromme Noah und seine Sippe sind die einzigen Ausnahmen. Auf Gottes Geheiß hin baut er eine riesige Arche, in der er, zusammen mit einem Paar von jeder Tierart, die desaströse Flut überleben und den Kern einer neuen Welt nach der Flut bilden soll. Jahrhundertelang haben die Menschen die fantastischen Details des verstörenden Textes für bare Münze genommen. Mit der Aufklärung kommen erste Zweifel: Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist so eine weltweite Flut? Ist das Ausmaß physikalisch überhaupt erklärbar? Wie groß hätte das Boot sein müssen, um alle Tiere der Welt retten zu können? Sind die Zahlen in der Geschichte nicht eher symbolische Angaben? Was ist wahr, was Fiktion? Der Film geht diesen Fragen nach. Die Entstehung des Mythos wird lange ins 6. Jahrhundert vor Christus datiert. Doch die Entdeckung und Übersetzung mesopotamischer Keilschrifttafeln im 19. Jahrhundert werfen die Theorie über den Haufen. In den Gilgamesch- und Atrahasis-Epen tauchen Versionen der Sintflut-Geschichte auf, die der biblischen nicht nur in vielen Einzelheiten ähneln, sondern vor allem viel älter sind. Die Erkenntnis erschüttert die Welt der Wissenschaft: der Text in der Bibel – ein Plagiat! Noch eine andere Frage beschäftigt die Forschung: Welches reale Ereignis kann die Vorlage für den Mythos gewesen sein? Wo kann sich eine verheerende Flutkatastrophe zugetragen haben? Die Spurensuche führt zu den regelmäßigen Überflutungen von Euphrat und Tigris im 4. Jahrtausend vor Christus, vor allem aber zu einem Ereignis, das nicht nur lokale Ausmaße hatte, sondern weltumspannende: das Ende der letzten Eiszeit. Vor über 20 000 Jahren liegt der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute, gewaltige Wassermassen sind in Eis gebunden. Mit den steigenden Temperaturen im aufkommenden Holozän schmilzt das Eis. Wassermassen wälzen sich über die Landmassen in die Ozeane. Je nach geologischen Gegebenheiten geht das in einigen Regionen der Erde schneller, in anderen langsamer. Manche Siedler trifft es härter, manche weniger hart. Wo aber haben die Wassermassen die Menschen so überrascht, dass sie sich als Sintflut ins Gedächtnis gebrannt haben? In Ur im heutigen Irak? Am Persischen Golf? Am Schwarzen Meer? In der ersten Folge des Dreiteilers „Große Mythen aufgedeckt“ gehen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den möglichen Theorien auf den Grund. Was erzählen Bohrkerne, Tropfsteine oder auch Entdeckungen am Meeresgrund über Ablauf und Tempo einer vermeintlichen Mega-Überschwemmung? Was erzählt die Vergangenheit über den damaligen natürlichen Klimawandel und seine Auswirkungen auf den Menschen – und nicht zuletzt über das, was uns heute womöglich erneut bevorsteht? Der menschengemachte Klimawandel bringt die Erde in Gefahr. Wird sich die Geschichte der Sintflut wiederholen? (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 01.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 05.12.2021 ZDF Große Mythen aufgedeckt: 2. Das Nibelungenlied
45 Min.Die „Terra X“-Dokumentation deckt auf: „Das Nibelungenlied“ ist der erste deutsche „Frauenroman“ des Mittelalters – mit einer selbstbewussten Königin namens Kriemhild als Hauptfigur. „Das Nibelungenlied“ erzählt nicht Siegfrieds, sondern Kriemhilds Geschichte, wie neueste Forschungen belegen. Der Film konzentriert sich auf die realen politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der damaligen Zeit und die Rolle der Frau im Mittelalter. „Die Nibelungensage“ besitzt alle Zutaten, die ein gutes Fantasy-Stück braucht: Heldentaten, einen Drachen, einen Schatz, Liebe, Mord und Intrigen.Seit seiner Entstehung im Hochmittelalter wurde die Geschichte immer wieder neu erzählt und gedeutet. Es scheint alles gesagt zu sein. Doch das ist ein Irrtum. Die „Terra X“-Dokumentation bietet einen neuen überraschenden Zugang zu dem klassischen Stoff, der sich stellenweise wie ein Kommentar zu unserer Zeit liest: Nicht der Drachentöter Siegfried ist der eigentliche Held des Epos, sondern seine Ehefrau und Rächerin Kriemhild spielt die Hauptrolle. Es ist ihre Geschichte – mit der sich zugleich eine verblüffende neue Perspektive auf die Welt des Mittelalters eröffnet. Wie sehr das Epos auf Kriemhild bezogen ist, belegt ein Manuskript aus dem 16. Jahrhundert, das die Überschrift trägt: „Dies ist Kriemhilds Buch“. Der Film zeigt, dass der Drache, der Schatz und die Schwertkämpfe nur Randerscheinungen der Geschichte sind. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Auseinandersetzung der Geschlechter und der Kampf der Frauen um Anerkennung in einer von Männern dominierten Gesellschaft. Ohne falsche Rücksichten zeigt der unbekannte Autor eine Welt des Adels, in der die Frauen schnell zum Spielball männlicher Ambitionen und Pläne werden. In der adligen Welt des Hochmittelalters dreht sich alles um Ehre, Rang und Ansehen. Attribute, die in dieser Zeit auch schnell mit der Waffe in der Hand verteidigt werden. Der Kern der Nibelungensage reicht zwar bis in die Zeit der Völkerwanderung zurück, der Text aber spiegelt die Wirklichkeit seiner Entstehungszeit im Hochmittelalter wider. Ohne zu moralisieren, will der Autor dem adligen Publikum einen Spiegel vorhalten und ihm klar machen, wie problematisch der Ehrenkodex der Zeit ist, der schnell zu Mord und Totschlag führen kann. Von einem übersteigerten Ehrgefühl sind auch die weiblichen Protagonistinnen des Textes – neben Kriemhild spielt die Walküre Brünhild eine wichtige Rolle – durchdrungen. Beide Frauen werden mehrmals von den Männern der Geschichte instrumentalisiert und getäuscht, sorgen in ihrem Streben nach Selbstbehauptung und Anerkennung aber auch selbst für Konflikte und Verwerfungen. Exemplarisch zeigt sich das an Kriemhild, die sich vom Opfer zur Rächerin wandelt und die in ihrer Besessenheit nach unbedingter Vergeltung nicht weniger Schuld auf sich lädt als die Männer. Der Film erzählt die Schlüsselszenen des Nibelungenliedes und geht der Frage nach, welche historischen Wahrheiten sich hinter den Akteuren und ihren Handlungen verbergen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen beleuchten Hintergründe, decken Zusammenhänge auf und führen so in den faszinierenden Kosmos des höfischen Adels. Historische Dokumente wie der „Sachsenspiegel“ stellen Zusammenhänge zum Rechtsverständnis der Zeit her. Entstanden ist „Das Nibelungenlied“ in einer Epoche des Wandels – von der Rache zum Recht, von der Willkür zum Gesetz, von der Frauenverachtung zur erstmaligen Hochschätzung von Frauen im Zuge des neuen Minne-Ideals. All das führt zur zentralen überraschenden Erkenntnis, die der Film präsentiert: Hinter dem „Nibelungenlied“ verbirgt sich weniger die graue, fast vergessene Vorzeit, wie eine oberflächliche Lektüre nahelegen mag. Vielmehr verweist das hochmittelalterliche Epos mit einer kritischen Sicht auf die Gesellschaft seiner Zeit und einer differenzierten Beschreibung der Personen auf die Zukunft. Und genau das bündelt sich im Schicksal der eigentlichen Protagonistin dieser Geschichte: Kriemhild. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 08.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 12.12.2021 ZDF Große Mythen aufgedeckt: 3. Das Rätsel um König Artus
45 Min.König Artus und die Ritter der Tafelrunde – kein Mythos ist so lebendig wie der um den rätselhaften Herrscher der Briten. „Terra X“ fragt, wie der Mythos entstanden ist und was dahinter steckt. Bis heute wird nach Spuren von Artus’ Existenz gesucht. Doch er bleibt ein Phantom. Neueste Forschungen bringen eine alte Geschichtschronik ins Spiel, die das anglonormannische Herrscherhaus in Auftrag gegeben hat. Sie könnte die Lösung bringen. Der schillernde König Artus – sein Name ist untrennbar verknüpft mit heldenhaften Taten, verheerenden Schlachten und einem goldenen Zeitalter des Rittertums.Fantastische Elemente wie der Zauberer Merlin, das magische Schwert Excalibur oder die Suche der edlen Ritter nach dem Heiligen Gral machen seine Geschichten zu Bestsellern – damals wie heute. Immer wieder hat es Versuche gegeben, Spuren seiner realen Existenz zu finden. Doch niemand kann sagen, wo er gelebt hat, wo er gestorben ist oder begraben liegt. König Artus bleibt ein Phantom. Das bedeutendste Werk über ihn entsteht im 12. Jahrhundert, verfasst von dem heute so gut wie unbekannten Geistlichen Geoffrey of Monmouth. Es wird sofort nach seinem Erscheinen zu einem der meist verbreiteten und gelesenen Texte des Mittelalters. Als Teil einer gewaltigen Chronik Britanniens um 1135 geschrieben, stillt die Geschichte von König Artus aber nicht nur das Bedürfnis der Leser nach guter Unterhaltung. Es gibt starke Hinweise, dass hinter dem Werk ein politischer Auftrag steht – veranlasst vom anglonormannischen Königshaus. Mit der Erstürmung Britanniens durch Wilhelm dem Eroberer sind die Normannen die neuen Regenten auf der Insel. Als Geoffrey seine Geschichtschronik verfasst, hat Wilhelms Enkel, Stephen von Blois, den englischen Thron bestiegen. Seinen Regierungswillen muss er nicht nur gegenüber den unterworfenen Angelsachsen verteidigen, Gefahr geht auch von seiner Cousine Mathilda aus, die als Enkelin Wilhelm des Eroberers ebenfalls die englische Krone für sich beansprucht. Der Thronstreit entwickelt sich zu einem Bürgerkrieg, der das Land spaltet. Geoffreys Geschichtschronik ist möglicherweise der Versuch, den eigenen Machtanspruch durch einen frei erfundenen Stammbaum zu legitimieren. In seiner Geschichtschronik entwirft Geoffrey of Monmouth eine Genealogie, die von den Trojanern über die Römer bis zu Artus reicht. Dabei rühmt er Artus als idealen Herrscher: großzügig, mutig, militärisch und politisch als herausragende Führerfigur. In allen Darstellungen – von Artus Herrschaftsführung, seinen siegreichen Schlachten wie auch in den Schilderungen seines prunkvollen Hofes – versäumt es der Autor nicht, die glorreiche Welt der anglonormannischen Könige zu spiegeln. Schon bald nach der Veröffentlichung von Geoffreys Werk gerät eine Lawine ins Rollen: Viele Schriftsteller in Europa entdecken den legendären König Artus für sich und spinnen seine Geschichte fantasievoll weiter. Chrétien de Troyes baut die Ritter Lancelot und Parzival sowie die Suche nach dem Heiligen Gral in die Artus-Sage ein. In Deutschland sind es die Werke von Hartmann von Aue oder der berühmte „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach, die Artus populär machen. Geoffreys Artus wird dabei bis zur Unkenntlichkeit überdeckt. Auch viele Herrscher wollen vom Glanz von König Artus profitieren. Richard Löwenherz nennt sein Schwert Excalibur, der habsburgische Kaiser Maximilian lässt für sein Grabdenkmal in der Hofkirche zu Innsbruck eine Artus-Statue in Bronze gießen. Heinrich VIII. hat sich als „Artus der Tafelrunde“ in Winchester Hall porträtieren lassen. Königin Victoria ließ ihr Ankleidezimmer im Westminster Palast mit Bildern aus der Sage schmücken. Und nicht zuletzt tragen Prinz Charles, sein Sohn William und sein Enkel Louis den Beinamen Artus. Bis heute wird nach Spuren von Artus’ Existenz gesucht. Die meisten Forschenden glauben nicht an einen realen Artus. Für sie ist er schlichtweg die Verkörperung eines Ideals und jeder Autor erschafft seine eigene Artuswelt. Dabei scheinen oft reale Ereignisse und Personen durch. Bei Geoffrey könnten es die anglonormannischen Herrscher sein. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 01.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 19.12.2021 ZDF Die großen Fragen: 1. Gibt es Gott?
45 Min.Harald LeschBild: ZDF und Lukas SalnaDie Frage entfesselt Kriege, lässt Philosophen verzweifeln und kann uns tief erschüttern: Gibt es Gott? Harald Lesch findet in der Wissenschaft verblüffende Antworten. Lässt sich das Universum ohne Gott überhaupt denken? Oder werden Naturgesetze und unser Leben von einer „höheren Macht“ bestimmt? Bis heute versuchen große Denker immer wieder, Gott näher zu kommen. Manche sind sicher: Seine Existenz ist längst bewiesen. In dieser Folge „Die großen Fragen“ will Harald Lesch nicht weniger, als die vielleicht bedeutendste aller Fragen beantworten. Was kann die Wissenschaft über Gott sagen – und was nicht? Das Universum scheint wie für uns geschaffen: Galaxien, Sterne, Planeten – und damit auch unsere Erde – könnten nicht existieren, wenn die Naturgesetze nur ein klein wenig anders wären.Ist das ein Beweis für einen göttlichen Plan? Ist es vorstellbar, dass die komplexen Lebensformen auf der Erde sich ganz ohne Lenkung von außen selbst organisieren? Oder sind wir auf einem Irrweg, wenn wir versuchen, Gottes Existenz durch sein Wirken zu belegen? Kann unser Geist Gott erkennen – oder erweist sich alles nur als Hirngespinst? Auf der Suche nach einer Antwort lässt Harald Lesch sein eigenes Gehirn durchleuchten – und lernt dabei viel über Gott, sich selbst und die menschliche Natur. Kann es einen echten Beweis für Gottes Existenz überhaupt geben? Seit der Antike suchen Theologen, Philosophen und Naturwissenschaftler nach einem stichhaltigen Beweis. Der österreichische Mathematiker Kurt Gödel formulierte den wohl komplexesten dieser Beweise, geschrieben in der Sprache der Logik. Mithilfe eines Computers konnte bestätigt werden: Gödels Beweis ist tatsächlich folgerichtig. Ist die Existenz Gottes damit bewiesen? Sind Wissenschaft und Religion ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist, oder lassen sie sich doch versöhnen? Harald Lesch blickt mit den Zuschauern sowohl in die Tiefen des Alls als auch in den Mikrokosmos der ganz kleinen Organismen. Er zeigt wundersame Begegnungen und tiefe Einblicke in das menschliche Bewusstsein. Er erzählt die Geschichte von den frühesten Zeugnissen der Götterverehrung in der Steinzeit bis zu den neuesten Versuchen, die Existenz Gottes mithilfe künstlicher Intelligenz zu beweisen. Eine abenteuerliche Suche nach dem Schöpfer selbst. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.04.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 16.04.2023 ZDF Die großen Fragen: 2. Was ist der Sinn des Lebens?
45 Min.Lässt sich in der Natur ein universeller Sinn des Lebens finden – oder ist das eine falsche Fährte?Bild: Lukas SalnaAn dieser Frage kommt niemand vorbei: Was ist der Sinn des Lebens? Harald Lesch begibt sich auf die Sinnsuche und findet überraschende Antworten in der Wissenschaft. Die Suche nach Sinn ist Teil menschlicher Natur. Das zeigen persönliche Lebensgeschichten genauso wie die globale Geschichte der Menschheit. Bei so vielen Sinnsuchern sollte sich doch eine allgemeingültige Antwort finden lassen? Oder ist jeder Sinn nur Illusion? In dieser Folge der „Terra X“-Reihe „Die großen Fragen“ treibt die Frage nach dem Sinn Harald Lesch bis an die Grenzen des menschlichen Denkens.Schon die ersten Hochkulturen stellten sich die Sinnfrage. Die älteste schriftlich überlieferte Geschichte der Menschheit, das Gilgameschepos, erzählt von einem König, den Freundschaft, Tod und Trauer in eine tiefe Sinnkrise stürzten. Die antiken Philosophen sahen in der Suche nach der tiefsten Wahrheit den wahren Sinn des Lebens. Doch was bedeuten ihre Ideen für unser Leben heute? Wie sehr beeinflusst der Wunsch nach einem Sinn unser Denken und Erleben? Spielt vielleicht unser Gehirn uns nur etwas vor? Kinder nutzen gern eine Fähigkeit, die uns allen innewohnt: Wir sehen in Wolken, Felsen oder Bäumen Dinge, die es dort gar nicht gibt. Aus nur wenigen Linien konstruieren wir Gesichter und sogar Hinweise auf Zivilisationen auf fremden Planeten. Was sagt uns das über unsere Fähigkeit, Sinn zu erkennen? Ist die Fantasie der Ursprung unserer Suche nach einem Sinn? Spätestens seit der Entwicklung der Evolutionstheorie sucht die Biologie nach dem treibenden Motiv des Lebens. Bietet vielleicht sie die richtigen Antworten? Lässt sich in der Natur ein universeller Sinn des Lebens finden – oder ist das eine falsche Fährte? Aktuelle Untersuchungen der Entwicklung unserer uralten Vorfahren geben Hinweise, wo wir am ehesten Sinn und Erfüllung finden könnten. Aber was wäre, wenn sich kein Sinn finden ließe? Der antike Mythos von Sisyphos, der immer wieder vergeblich einen Stein den Berg hinaufrollt, erzählt genau diese Geschichte. Dennoch sollen wir uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Wie passt das zusammen? Wie sind Glück und Sinn miteinander verwoben? Die große Frage nach dem Sinn lässt Harald Lesch die Perspektive eines ungeborenen Babys einnehmen, führt ihn auf den Mars und zu Nelson Mandela in den südafrikanischen Freiheitskampf. Eine verblüffende Spurensuche unter Löwen und Tintenfischen, Glückssuchern und Nihilisten mit einer klaren Erkenntnis: Wer einen Sinn findet, lebt nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 19.04.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 23.04.2023 ZDF Die großen Fragen: 3. Haben wir eine Seele?
45 Min.Lässt sich die Existenz der Seele beweisen? Harald Lesch prüft die wissenschaftlichen, philosophischen und religiösen Theorien – und findet überraschende Antworten. Es ist eine Frage, die uns tief im Inneren berührt: Gibt es etwas, das unseren Tod überdauert? Die Suche nach einer Antwort führt von experimentellen Versuchen, die Seele zu wiegen, über spirituelle Traditionen bis hin zur modernen Hirnforschung. In der neuen Folge von „Terra X – Die großen Fragen“ widmet sich Harald Lesch einem der ältesten und faszinierendsten Themen der Menschheit: der Seele.Ist sie die unsterbliche Essenz unseres Seins oder nur ein Symbol für den menschlichen Wunsch nach Unsterblichkeit? Gibt es etwas in uns, das über unseren Tod hinaus weiter existiert, oder ist unser Ich nur eine flüchtige Illusion, geschaffen von unserem Gehirn? Harald Lesch beleuchtet das berühmte „21-Gramm-Experiment“, das einst das Gewicht der Seele bestimmen wollte, und zeigt, wie sich die Vorstellung einer Seele über die Epochen und Kulturen hinweg verändert hat. Von den westlichen Philosophen Aristoteles und Descartes bis zu den östlichen Weisheitslehren – was lässt sich heute aus ihren Überlegungen lernen? Haben Tiere eine Seele? Wie hängt sie mit unserem Bewusstsein zusammen? Wenn unser Denken und Fühlen nur das Ergebnis biochemischer Prozesse ist – kann dann trotzdem ein Teil von uns unabhängig von unserem Körper existieren? Erfahrungsberichte von Menschen, die dem Tod nur knapp entronnen sind, scheinen das zu bestätigen: Die Betroffenen berichten, während ihrer Nahtoderfahrung ihren Körper verlassen zu haben, sie beschreiben ein helles Licht und ein Gefühl vollkommenen Glücks. Haben sie den Moment erlebt, in dem ihre Seele den Körper verlassen hat? Heute soll künstliche Intelligenz bei der Suche nach der Seele helfen. Studien zur Visualisierung von Träumen mithilfe von KI öffnen ein Fenster zu unserem Unterbewusstsein – kommen wir so der Seele auf die Spur? In faszinierenden Bildern und Gesprächen mit Experten zeigt Harald Lesch, was Wissenschaft, Religion und Philosophie über den Kern des Menschseins zu sagen haben. Und er lädt die Zuschauer ein, über das eigene Selbstverständnis nachzudenken. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 14.05.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 18.05.2025 ZDF Die großen Fragen: 4. Gibt es das Schicksal?
45 Min.Ist alles vorherbestimmt? Harald Lesch geht dem Schicksal auf den Grund – zwischen antiken Mythen, moderner Wissenschaft und den Geheimnissen des Zufalls. Ist unser Leben ein vorgezeichneter Weg, eine Kette von Zufällen oder die Summe unserer Entscheidungen? Seit Jahrtausenden suchen Menschen nach Antworten, ob in Astrologie, Religion oder Wissenschaft. Welche Bedingungen bestimmen unser Leben? In dieser Folge von „Terra X – Die großen Fragen“ begibt sich Harald Lesch auf eine Reise durch Wissenschaft, Philosophie und Geschichte, um das Rätsel des Schicksals zu entschlüsseln.Es sind die unvorhergesehenen, die unwahrscheinlichen Lebensereignisse, die uns an eine Bestimmung glauben lassen. So wie die Geschichte von Violet Jessop, die drei Schiffsunglücke überlebte, obwohl sie nie schwimmen gelernt hatte. Kann so etwas Zufall sein? Schon die alten Griechen glaubten an ein unentrinnbares Schicksal, gelenkt durch die Schicksalsgöttinnen. Die Weissagungen des Orakels von Delphi galten als ein Blick in eine vorherbestimmte Zukunft. Legenden wie die von König Ödipus erzählen davon, dass nicht einmal die mächtigsten Menschen ihrem Schicksal entgehen konnten. Die Naturwissenschaft scheint ebenfalls eine Art Schicksal zu kennen: die Naturgesetze. Wenn alle Ereignisse im Universum eine Kette von Ursache und Wirkung sind, dann ist auch der Verlauf unseres Lebens vorherbestimmt. Doch wie passt die Chaostheorie in dieses Bild? Lassen die Naturgesetze doch Spielraum für echte Zufälle, für individuelle Freiheit? Wie viel Kontrolle haben wir über unser Leben? Experimente zeigen, dass Menschen ihren Beitrag zu ihrem Erfolg oft überschätzen, dass glückliche Fügungen eine größere Rolle spielen, als uns bewusst ist. Unsere Gene und unsere Herkunft suchen wir uns nicht aus – doch sie bestimmen den Verlauf unseres Lebens mehr, als uns lieb ist. Wie viel Einfluss haben wir auf unser Schicksal? Anhand verblüffender Experimente, philosophischer Betrachtungen und alltäglicher Erfahrungen zeigt Harald Lesch, ob es so etwas wie ein Schicksal geben kann – oder ob wir doch unseres eigenen Glückes Schmied sind. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 14.05.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 25.05.2025 ZDF Die großen Fragen: 5. Sind wir allein?
45 Min.Gibt es außerhalb der Erde intelligentes Leben im Universum? Was ist dran an UFO-Sichtungen? Prof. Harald Lesch nimmt uns mit auf eine spannende Spurensuche. In unserem Universum gibt es Abermilliarden Sterne. Viele davon ähneln unserer Sonne und werden wie sie von Planeten umkreist. Können wir da wirklich die einzigen intelligenten Lebewesen im All sein? Haben uns „die Anderen“ vielleicht sogar schon besucht? In dieser Folge von „Terra X: Die großen Fragen“ geht Prof. Harald Lesch einer der spannendsten Fragen der Menschheit nach: Sind wir allein im Universum? Was lehren uns die unterschiedlichen historischen, kulturellen und wissenschaftlichen Perspektiven auf diese Frage? 2017 gingen Videoaufnahmen von Piloten des US-Militärs um die Welt: Sie zeigen Objekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit am Himmel bewegen.Das Pentagon bestätigt später die Echtheit der Videos – doch von außerirdischen Objekten spricht es nicht. UFO-Gläubige misstrauen den offiziellen Stellungnahmen – immerhin hat das US-Militär schon in der Vergangenheit so einiges verschwiegen. Jenseits aller Spekulation erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie wahrscheinlich außerirdisches Leben tatsächlich ist. 2020 wurde der Planet Kepler-1649c entdeckt. Er ist etwa so groß wie die Erde und umkreist seinen Stern in einer Entfernung, die lebensfreundliche Temperaturen ermöglicht. Wird es uns eines Tages gelingen, außerirdisches Leben nachzuweisen – echte Aliens? Benannt ist Kepler-1649c nach Johannes Kepler, einem Astronomen, der Anfang des 17. Jahrhunderts gewirkt hat. Die Gesetze der Planetenbewegung, die Kepler beschrieben hat, sind bis heute gültig. Doch der Astronom war auch einer der ersten, die sich Gedanken darüber machten, wie Aliens aussehen können. Seinen Überlegungen faszinieren noch heute. Anhänger der Prä-Astronautik sind überzeugt, die Aliens wären schon längst hier gewesen. Sie deuten archäologische Funde wie die „Goldflieger“ aus Kolumbien oder den Grabstein von Palenque als Beweise für außerirdische Technologie. Doch die Archäologie hat andere Erklärungen. Ob UFO-Gläubige, Forschende oder schlicht Fans der Alien-Popkultur – sie alle eint die Sehnsucht nach Gesellschaft im Universum. Eine Sehnsucht, die uns sogar Botschaften ins All schicken lässt. Die Voyager-Sonden, die eine Wegbeschreibung zu uns an Bord haben, haben inzwischen unser Planetensystem verlassen. Aber ist es überhaupt klug, auf uns aufmerksam zu machen? Harald Lesch nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine fantastische Erkenntnisreise, illustriert durch Geschichten über Kanäle auf dem Mars, Lebewesen, die im antarktischen Eis leben, und Philosophen, die an der Intelligenz der Aliens zweifeln. Dabei schwingt immer auch die Frage mit, wie wir unsere eigene Rolle im Universum definieren. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 14.05.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 01.06.2025 ZDF Das große Serengeti-Puzzle
Der große Showdown – Männer im Temporausch
Der große Terra X-Jahresrückblick 2023
45 Min.Die „Terra X“-Experten Harald Lesch, Jasmina Neudecker und Mirko Drotschmann blicken zurück auf Krisen und Kontroversen im Jahr 2023 sowie auf neue Erkenntnisse aus der Welt des Wissens. Täglich erreichen uns Bilder und Nachrichten aus dem Reich der Wissenschaft: Oft sind wir uns ihrer Bedeutung nicht bewusst. „Der große ‚Terra X‘-Jahresrückblick“ stellt die Frage: Welche Ereignisse, Entwicklungen, Entdeckungen werden unser Leben auch künftig prägen? Zu Beginn des Jahres erobert künstliche Intelligenz die Öffentlichkeit im Sturm. Wird sie uns, wie häufig befürchtet, bald ersetzen? Droht uns ein gesellschaftlicher Umbruch wie damals beim Aufkommen der Elektrizität? Als diese im frühen 20. Jahrhundert ihren Einzug in das Arbeits- und Alltagsleben findet, verändert sie das Leben drastisch.Sowohl zu Hause als auch im Büro und bei fast jedem Werkzeug: Ohne Strom ging nichts mehr. Historiker Mirko Drotschmann stellt die Frage, wie sich der Einfluss von KI auf unser Leben mit Blick auf die Lehren aus der Vergangenheit entwickeln könnte – und wohin uns die neue digitale Revolution noch führt. Erdbeben, Unwetter, Flutkatastrophen – 2023 war vor allem in dieser Beziehung ein Rekordjahr. Jasmina Neudecker reist nach Kahramanmaraş in der Türkei, die Region, die im Frühjahr von zwei heftigen Erdstößen heimgesucht wurde. Die Beben kosteten über 50.000 Menschen das Leben und hinterließen kilometerweit ein verheerendes Ausmaß der Zerstörung. Die Biologin spricht mit Forschenden vor Ort, um herauszufinden, welche Erkenntnisse wir aus dem Beben ziehen können. Was können wir tun, um ähnliche Katastrophen vorherzusehen und uns frühzeitig besser zu schützen? Im April wurde ein historischer Schritt unternommen: Deutschland stellte die letzten Atommeiler ab. Hat unsere Energieversorgung seither gelitten? Wie geht es in Zukunft weiter, ohne auf fossile Energieträger zurückzugreifen? Ist grüner Wasserstoff die Lösung? Verfallen die alten Anlagen zu bleibenden Betonruinen? Harald Lesch begibt sich in Duisburg auf die Suche nach möglichen Lösungen unserer Energiefrage. „Der große ‚Terra X‘-Jahresrückblick“ rückt drei große Themen des Jahres noch einmal in den Fokus. Daneben gab es noch unzählige weitere große und kleine Nachrichten aus der Welt des Wissens. In unterhaltsamer Weise führen die drei „Terra X“-Köpfe durch das Jahr 2023 und lassen die wichtigsten, kuriosesten, bewegendsten und überraschendsten Ereignisse Revue passieren. Soviel ist sicher: Das Jahr 2023 hat es in sich. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 26.11.2023 ZDF Der große Terra X-Jahresrückblick 2025
45 Min.Europa muss unabhängiger werden. Mirko Drotschmann reist nach Paris und schaut 70 Jahre zurück, in das Jahr 1955, als Westdeutschland hier in die NATO aufgenommen wurde. Ein Blick zurück, der Hoffnung für die Zukunft geben kann.Bild: ZDF und Ralf Heinze / Caligari Entertainment GmbHEuropa am Scheideweg? Ein spannender Blick zurück auf das Jahr 2025. „Terra X“ erkundet die Risiken und Chancen Europas in einer Welt des Umbruchs. Was weiß die Wissenschaft? Die Herausforderungen sind mannigfaltig und global. Kriege, Klimawandel, Energiehunger – Europa muss politisch, wirtschaftlich und in der Forschung unabhängiger werden. Es gibt Lichtblicke. Welche Ereignisse und Entwicklungen werden unser Leben künftig sichern? Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker begeben sich auf eine facettenreiche Reise durch Europa und das Jahr 2025. Im April legte ein großflächiger Stromausfall die iberische Halbinsel lahm.Bis zu 24 Stunden dauerte der Blackout in Spanien und Portugal. Hätte diese Katastrophe verhindert werden können? Wie groß ist die Gefahr, dass das auch in Deutschland passiert? Harald Lesch besucht das Umspannwerk Wilster und erfährt, wie der Netzausbau und Großtrassen wie NordLink und SüdLink helfen sollen, künftige Stromausfälle zu verhindern. Um die Stromversorgung zu sichern, werden erneuerbare Energien ausgebaut und die digitale Infrastruktur gestärkt. Welche Rolle spielt dabei die rasante Entwicklung in der Nutzung von künstlicher Intelligenz – eine Technologie, die besonders viel Energie verschlingt. Europa hat sich zum Hotspot des Klimawandels entwickelt. Es erwärmt sich viel schneller als der globale Durchschnitt. Besonders Griechenland litt 2025 unter extremen Hitzeperioden wie im Juli 2025, als die Temperatur in Athen bereits in den Morgenstunden über 30 Grad Celsius lag und im Laufe des Tages über 40 Grad Celsius anstieg. Jasmina Neudecker macht sich vor Ort ein Bild, welche Maßnahmen Griechenland in Zukunft beim Kampf gegen die Hitze helfen sollen. Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch mit Bergstürzen wie der Katastrophe von Blatten in der Schweiz in Zusammenhang gebracht. Im Kanton Graubünden ist aktuell das Dorf Brienz bedroht: Nach dem Abgang einer Gerölllawine sind immer noch die Bergflanken extrem instabil. Aber auch rutschende Bodenschichten im Untergrund bedeuten eine Gefahr. Brienz wurde evakuiert und ist seit Monaten ein Geisterort – die Bewohner dürfen ihre Häuser nur stundenweise am Tag betreten. Mithilfe von Technik will man den Ort nun retten. Politische Entscheidungen erschweren 2025 zunehmend internationale Kooperationen nicht nur auf der Erde, sondern auch im Weltraum. Wie kann sich Europa hier unabhängig machen? Mirko Drotschmann prüft bei einer NATO-Übung die Sicherheitslage Europas, die Auswirkungen geopolitischer Spannungen und die Notwendigkeit, eigene Strategien zu entwickeln. „Der Große Terra X-Jahresrückblick 2025“ setzt den Wandel Europas in den Fokus und zeigt, wie sich Wissenschaft und Forschung neuen Aufgaben stellen müssen. Aber auch in diesem Jahr gab es daneben noch viele weitere verblüffende, weltbewegende und unterhaltsame Ereignisse aus der Welt des Wissens. Die drei „Terra X“-Köpfe lassen die bedeutendsten, kuriosesten und bewegendsten Ereignisse von 2025 Revue passieren. Ein wichtiges Jahr – und vielleicht der Beginn einer neuen Ära. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 30.11.2025 ZDF Große Völker: 1. Die Griechen
45 Min.Demokratie, Gesetze, Wissenschaft, Literatur, Theater, Olympische Spiele, Wasserversorgung, Straßennetze, Fernhandel, Überquerung der Weltmeere, Globalisierung – die Liste der Errungenschaften, die das Europa von heute kennzeichnen, ließe sich endlos fortführen. Doch ausnahmslos alles, was unser heutiges Leben prägt, basiert auf über 2000 Jahre alten Ideen und Erfindungen. Die neue „Terra X“-Reihe „Große Völker“ versteht sich als Zeitreise zu den Wurzeln Europas und den Nationen, die den Weg in die Moderne geebnet haben.In drei Folgen werden sowohl die herausragenden Pionierleistungen als auch die Lebenswelten der Griechen, Römer und Wikinger vorgestellt und die Auswirkungen ihrer Erfindungen auf das 21. Jahrhundert aufgezeigt. Die moderne Welt hat den alten Griechen eine Menge zu verdanken: die tragischsten Dramen und unterhaltsamsten Komödien, leider aber auch den Mathematikunterricht. Auch dass wir joggen oder Marathon laufen, ist den Griechen geschuldet – ebenso wie die Olympischen Spiele, die Menschen unterschiedlichster Herkunft friedlich miteinander vereinen sollen. Und nicht zuletzt ist die Demokratie das Erbe berühmter Vordenker aus Athen. Vielleicht haben es die meisten schon vergessen, aber Griechenland gilt als die Wiege Europas. Der Blick zurück in die Geschichte der Griechen beginnt nach den „dunklen Jahrhunderten“ um etwa 750 vor Christus. Damals entstehen an den zerklüfteten Küsten des östlichen Mittelmeers unabhängige Stadtstaaten, die untereinander im Dauerclinch liegen. Nur die Vorstellung von einer illustren wie ebenso intriganten Götterwelt, die vom Olymp aus alle Bereiche des irdischen Lebens beherrscht, verbindet sie. Kein Krieg, keine Hochzeit, keine sonstigen Handlungen werden geplant, ohne den Rat der himmlischen Helden einzuholen. Während die einen einer Welt aus Mythen und Mysterien nachhängen, wagen sich ein paar wenige Universalgelehrte an andere Modelle der Welterklärung. Die Philosophen beobachten die Natur, suchen nach Zusammenhängen zwischen Ursache und Wirkung und glauben fest an Erkenntnisgewinne durch logisches Denken. Sie sind die Begründer der Wissenschaft und bahnbrechender Errungenschaften – angefangen von der ersten Dampfmaschine über die Entdeckung der Erde als Kugel bis hin zum schusssicheren Brustpanzer. Eine der revolutionärsten Ideen der Griechen aber ist die Demokratie. Kaum zu glauben, aber sie ist ein Produkt der ständigen Kriege untereinander, vor allem aber gegen die übermächtigen Perser. Jeder Mann im Staat wird im Kampf gegen den Feind von außen gebraucht, im Gegenzug fordert das Volk umfassende Mitspracherechte. In Athen erkennen die Verantwortlichen früh, dass sie Zugeständnisse an die Bürger machen müssen. Nach und nach führen sie Reformen ein, bis eine völlig neue Verfassung entsteht. Sie soll den Griechen eine Herrschaftsform garantieren, die maßgeblich vom Volk ausgeht. Politisches Stimmrecht besitzen alle männlichen Griechen über 18 Jahre. Sklaven, Frauen und Kinder sind von der Meinungsbildung ausgeschlossen. Grundsätzlich fallen die Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip. In der Praxis sieht es aber so aus, dass zumeist die Reichen die große Linie vorgeben, denn sie sind die einzigen, die mit ihrem Privatvermögen haften können. Und das ist damals für jeden Spitzenpolitiker Pflicht. In späteren Zeiten wird die Volksherrschaft über Jahrhunderte erfolgreich vermieden. Erst mit der Französischen Revolution ändert sich das wieder. Inzwischen existieren weltweit 115 freiheitlich geführte Regierungen, die mehr oder weniger die Rechte des Einzelnen in ihrem Staatsvertrag verankert haben. Auch die Europäische Union beruft sich in ihrem Gründungspapier auf das politische Konzept aus dem alten Griechenland. Neben Politik und Wissenschaft haben noch zwei weitere Errungenschaften ihren Anfang in der Antiken Welt genommen. Zum einen ist das die Entstehung des Theaters, das damals vor allem dazu dient, den Bürgern über das Spiel auf der Bühne ihre Welt zu erklären. Der Zeit weit voraus ist dabei die Vorstellung, dass bei der Vorführung der Tragödien und Komödien die Seele des Menschen eine Wandlung vollzieht, wenn nicht sogar einen Heilungsprozess durchläuft. Jedes dramatische Werk folgt seither denselben Gestaltungsmustern, die damals von den großen Autoren Griechenlands entwickelt wurden. Die Einführung der Olympischen Spiele ist die zweite herausragende Pionierleistung. Das Ereignis findet alle vier Jahre statt. Eine Woche lang messen sich Freund und Feind in unterschiedlichen sportlichen Disziplinen. Während der Dauer des Spektakels, so verlangen es die Regeln, herrscht Frieden. Im 5. Jahrhundert nach Christus wird das Praktizieren des „heidnischen Kultes“ auf Erlass des christlichen Kaisers Theodosios verboten. Erst 1896 finden in Athen – nach 1500 Jahren Unterbrechung – die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Wie bei den alten Griechen stehen sie ganz im Zeichen der Völkerverständigung. Das ist bis heute so geblieben. Zwei weitere Folgen „Terra X: Große Völker“ werden ausgestrahlt: am Sonntag, 16. März, 19:30 Uhr, folgt „Die Römer“, und am Sonntag, 23. März, 19:30 Uhr, „Die Wikinger“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 09.03.2014 ZDF Große Völker: 2. Die Römer
45 Min.Es gibt zwar nicht viel, was nicht zuvor schon von den Ägyptern, Griechen oder Karthagern erfunden worden wäre, doch es gibt noch weniger, was die Römer nicht von ihnen übernommen, verbessert oder gar perfektioniert hätten. Die alten Römer sind ein Volk der Superlative, ihre Geschichte beginnt allerdings wenig spektakulär. Als Rom gegründet wird, ist die spätere Hauptstadt nicht mehr als eine malariaverseuchte Siedlung in einer sumpfigen Senke am Tiber. Doch nur wenige Jahrhunderte später schlägt dort das Herz eines Imperiums, in dem zu Spitzenzeiten über 55 Millionen Menschen leben.Fast 1000 Jahre hält die römische Herrschaft, bevor sie allmählich zerbröckelt. Besonders beeindruckend ist die Dynamik, mit der die anfangs keineswegs überlegene Republik zur Vormacht im gesamten Mittelmeerraum aufsteigt. Die Römer beweisen sich dabei nicht nur als Meister der Kriegsführung, sondern auch als Garanten anhaltenden Friedens. Geschickt schwören sie die eroberten Territorien auf die „Sache Roms“ ein. Die neuen Bundesgenossen erhalten ein hohes Maß an Selbstbestimmung und eine Verfassung, die ihnen wie jedem römischen Bürger auch die Gleichheit vor Recht und Gesetz zusichert. Und jeder – auch Sklaven und Besiegte – kann damals sein Bürgerrecht einfordern. Die Herren vom Tiber bieten aber noch mehr Annehmlichkeiten: Quer durchs Reich bauen sie Straßen und Aquädukte, bis in die entferntesten Winkel des Imperiums exportieren sie ihren Lebensstil und ihre Ideen zur Architektur öffentlicher Gebäude und Plätze. Mit den umfassenden Maßnahmen haben die Regenten nur ein Ziel verfolgt: einen Staat ohne Grenzen zu schaffen. Ein Plan, der nur einmal mehr beweist, wie sehr das antike Gedankengut in die heutige Welt übergegangen ist. Von einem barrierefreien Europa mit gleichen Rechten für alle träumen auch die Verantwortlichen in Brüssel. Wie schwer es ist, Völker aus unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen zu halten, haben auch schon die alten Römer gewusst. Als Kontrollorgan setzen sie deshalb ein Heer aus Legionären ein. Berufssoldat zu sein ist damals ein begehrter Job. Er bietet ein festes Einkommen, Aufstiegschancen und eine sichere Altersversorgung. Nach 25 Jahren erhält ein Legionär 14 Jahresgehälter und manchmal sogar noch ein Stück Land. Die soziale Sicherheit hat jedoch ihren Preis. Die meisten Männer leben bis zur Pensionierung dauerhaft fernab der Heimat. Viele Städte, die wir heute kennen, sind aus kleinen römischen Feldlagern entstanden. Die Manager des Großreichs residieren in Rom. Eine extrem schlanke Zentralverwaltung bildet das Rückgrat des Imperiums. Nur ein paar hundert Männer herrschen über ein Fünftel der Menschheit. Dafür entwickeln die Römer einen straff organisierten Beamtenapparat mit fein abgestuften Hierarchien und Zuständigkeiten, aber auch mit ständig wachsenden Aktenbergen. Durch kluge Investitionen in das Sozialwesen und in imposante Spektakel gelingt es den Politikern langfristig, das Volk bei Laune zu halten. „Brot und Spiele“ lautet die magische Formel. Jeder hat das Recht auf kostenloses Getreide und extravagante Unterhaltung. Highlights sind die Gladiatorenkämpfe im Kolosseum, die bis zu vier Monate dauern können. Lange haben Historiker gerätselt, warum das Römische Imperium mitten im schönsten Frieden dennoch kollabiert ist. Eine Vermutung lautet, dass allein die vielzitierte Dekadenz der Oberschicht schuld daran sei. Doch viele Forscher glauben inzwischen, dass die Barbaren den Untergang der Großmacht verursacht haben. Im 4. Jahrhundert nach Christus setzt die Völkerwanderung ein, und zigtausende Menschen drängen auf der Suche nach neuem Lebensraum ins Reich. Das Imperium gerät in vielerlei Hinsicht in Not und ist nicht mehr zu retten. Das Vermächtnis des Imperiums an die Nachwelt aber hat überlebt. Die Römer haben das Fundament für eine zivilisierte Welt gelegt und die Ausbreitung des Christentums maßgeblich befördert. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 16.03.2014 ZDF Große Völker: 3. Die Wikinger
45 Min.Als wilde Horde aus dem Norden machen die Wikinger 739 nach Christus zum ersten Mal von sich reden. Der Blitzangriff auf das nordenglische Kloster Lindisfarne ist der Auftakt einer Reihe von Plünderungen, die Europa dauerhaft in Angst und Schrecken versetzen. Mancher Regent bezahlt den „Seekriegern“ sogar eine Art Schutzgeld, nur damit sie nicht wiederkommen. Ihr Ruf als mordlüsterne Barbaren hält sich über viele Jahrhunderte. Dabei sind ihre Leistungen als mutige Entdecker, visionäre Händler und Begründer von Städten und Königreichen in Vergessenheit geraten.Doch es sind die Wikinger, die durch ihr Wirken den Verlauf der europäischen Geschichte im Mittelalter maßgeblich beeinflusst haben. Die ursprüngliche Heimat der Wikinger ist Skandinavien, genauer gesagt Dänemark, Norwegen und Schweden. In erster Linie leben die Nordmänner von der Landwirtschaft und der Fischerei. Ihre Höfe liegen weit voneinander entfernt, Städte gibt es anfangs nicht. Auf Raubzug gehen die Wikinger zunächst nur in den Sommermonaten, den Rest des Jahres verbringen sie mit ihren Sippen am heimischen Herd. Die Gründe für die saisonalen Kaperfahrten sind nicht ganz eindeutig. Aber vieles deutet darauf hin, dass sich die Versorgungslage wegen der stetig steigenden Bevölkerungszahlen zunehmend verschlechtert hat. Deshalb sind die Raubzüge ein willkommener Nebenerwerb. Sie haben aber auch dazu gedient, neuen Siedlungsraum aufzutun. Ob aus Not oder purer Beutelust – als unerschrockene Entdecker stellen die Wikinger ihre Fähigkeiten unter Beweis. Und überall hinterlassen sie ihren historischen Fußabdruck. Dazu gehören unter anderem Gebiete im heutigen Irland, England, in Frankreich oder auch in Deutschland. Doch schon früh steuern die Nordmänner immer weiter nordwärts. So erreichen sie Island. Obwohl die eisige Insel nur in den Ebenen und Tälern fruchtbaren Boden bietet, setzt schon bald eine große Einwanderungswelle ein. Auch Erik der Rote befindet sich unter den Emigranten. Als er aus Jähzorn zwei Morde begeht, wird er von der Insel verbannt. Die Zeit nutzt er, um im Atlantischen Ozean nach einer neuen Heimat zu suchen. Er findet sie auf Grönland – Grünland – wie Erik die Insel nennt. Sie bleibt bis Anfang des 15. Jahrhunderts fest in Wikingerhand. Die historisch spektakulärste Entdeckung aber macht Eriks Sohn Leif. Bereits 500 Jahre vor Christoph Kolumbus betritt er als erster Europäer im Norden Neufundlands amerikanischen Boden. Viel ist über den Namen Vinland – Weinland – gerätselt worden, den die Wikinger ihrer Entdeckung gaben. Weinreben haben die Männer dort nachweislich nicht gefunden, sondern Wiesen und Weiden. Trotz günstiger Bedingungen können sich die Wikinger dort nicht halten, die Eingeborenen schlagen sie irgendwann in die Flucht. Ohne ihre Schiffe wäre die Geschichte der Wikinger ganz anders verlaufen. Sie sind legendär und haben dem Volk sogar ihren Namen gegeben. „Vikingr“ bedeutet soviel wie „Krieger, die zur See fahren“. Berühmtberüchtigt sind die Drachenschiffe, hochwandige Segler aus Eichenholz mit grellbunten Rahsegeln, spitz zulaufendem Bug und Heck sowie einem flachen Kiel. Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn die Berserker in kriegerischer Absicht über die Meere fahren. Für den Handel entwerfen die Wikinger die „Knorr“. Sie ist zwar weniger schnell und wendig, kann dafür aber große Lasten transportieren. Der Schiffstyp wird noch jahrhundertelang nachgebaut – auch als die Wikinger als eigenständiges Volk schon nicht mehr existieren. Als Kaufleute machen sich die „Wilden aus dem Norden“ rasch einen Namen. Vom Norden aus erschließen sie völlig neue Routen, die bis ins heutige Russland und in den Vorderen Orient führen. Mit Fellen, Bernstein, Waffen und vor allem Sklaven werden die Wikinger reich. Aus ihren Siedlungen werden blühende Städte, Geschäftspartner aus aller Herren Länder kommen ins Land. Eine der bekanntesten Handelsplätze ist Haithabu. Die Metropole gilt als erste mittelalterliche Stadt in Nordeuropa. Die Gründe für das Ende der Wikingerzeit sind vielseitig. Einen erheblichen Beitrag leistet die Christianisierung in Skandinavien. Viele Heiden lassen sich bekehren. Denn anders als in ihrem Volksglauben verspricht die neue Religion jedem Menschen das Paradies. Die Missionierung führt zu einem Wandel der gesellschaftlichen wie politischen Struktur. Es gibt Könige und Staaten, die Krieger werden sesshaft und gehen nicht mehr auf Beutezug. Auch haben sich die anderen Völker die Kenntnisse der Wikinger zunutze und ihnen das Handelsmonopol abspenstig gemacht. Die Wikinger passen sich den neuen Verhältnissen in Europa an, gehen in anderen Völkern auf. So auch in der Normandie, die der dänische Wikingeranführer Rollo vom französischen König als Lehen erhält. Sein direkter Nachfahre, Wilhelm der Eroberer, ist es, der 1066 in der Schlacht bei Hastings die Engländer besiegt. So wird ein normannischer Wikinger König von England. Seine sozialen, politischen und rechtlichen Veränderungen bilden bis heute den Grundstein der britischen Monarchie. Letzte Folge der „Terra X-Reihe: Große Völker“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 23.03.2014 ZDF Große Völker: 4. Die Karthager
„Terra X“ forscht nach den Wurzeln des modernen Europa. Die Serie „Große Völker“ startet mit der Geschichte der Karthager, der einflussreichsten Handelsmacht in der Antike. Die meisten Berichte über die Karthager stammen von ihren Konkurrenten – den Griechen und Römern – und sind wenig objektiv. Die Karthager gelten als verschlagene Händler und grausame Kindsmörder. Doch Forscher haben herausgefunden: Sie waren besser als ihr Ruf. Die Geschichte der Karthager setzt vor rund 3000 Jahren ein, als phönizische Siedler ihre Mutterstädte im heutigen Libanon verlassen, um im Mittelmeerraum neue Kolonien zu gründen.Sie entstehen an den Küsten Nordafrikas, auf Sizilien, Sardinien, Korsika, den Balearen und im Süden Spaniens. Die prächtigste und mächtigste aber wird Karthago – eine blühende Metropole mit einem Hafen, den damals die ganze Welt bestaunt. Dort bauen die Karthager wendige Kriegsschiffe, aber auch schnelle Segler, die sie als Expeditionsschiffe einsetzen. Auf der Suche nach weiteren Handelsplätzen – und vor allem nach wertvollen Metallen – gelangen sie über die Grenzen der damals bekannten Welt hinaus: durch die Straße von Gibraltar bis nach Westafrika und vielleicht sogar bis nach England. Wo immer sie auftauchen, werden sie berühmt und berüchtigt – mal als kunstfertig gepriesen, dann wieder als geldgierig beschimpft. Voller Neid schaut man auf die Kaufleute, die „wie Fürsten auftreten“, wie es heißt. Auch sollen sie grausame religiöse Rituale pflegen, ihre Erstgeborenen töten und an speziellen Orten – den sogenannten Tophets – den Göttern opfern, um von ihrem Volk Krieg und Hungersnot abzuwenden. Davon berichten zumindest die Griechen und Römer. Lange hat man ihnen geglaubt, auch weil Funde von Kinderknochen ihre Überlieferungen gestützt haben. Aber inzwischen betrachten Forscher die Texte mit äußerster Vorsicht, denn die Karthager waren die größten Rivalen im Mittelmeerraum und womöglich Opfer von Verleumdungen. Heute tendiert man dazu, die Tophets als Begräbnisorte für tot geborene oder früh verstorbene Kinder zu sehen. 1000 Jahre lang beherrschen die Karthager als Händler die antike Welt. Dann übernimmt der Erzfeind Rom die Macht und zerstört Karthago – das Herz des phönizischen Kulturkreises. Doch da sind die Samen dieses großen Seefahrervolkes längst aufgegangen. Denn durch ihren Fernhandelsverkehr haben sie die Länder rund ums Mittelmeer zu einem Kulturraum geformt, in dem nicht nur Waren, sondern auch Ideen und Know-how frei hin- und herströmen. Sie haben die ersten Städte auf europäischem Boden gegründet – Keimzellen einer urbanen Kultur, die bis heute unser Leben prägt. Von ihnen stammt der Entdeckergeist, der Generationen nach ihnen beflügelt hat, wie Forscher erklären. Und sie liefern das nötige technische Wissen, um Schiffe für weite Fahrten über die Meere zu konstruieren. Ein Wissen, das sie zunächst an Griechen und Römer weitergeben, und das sich dann in die ganze Welt verbreitet. Das Wichtigste aber, was von ihnen bleibt, ist die phönizische Schrift, die in wenigen Jahrhunderten die Welt erobert und Ursprung aller westlichen Alphabete ist. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 16.10.2016 ZDF Große Völker: 5. Die Germanen
45 Min.In der zweiten Folge der „Terra X“-Reihe „Große Völker“ wird die Geschichte der Germanen erzählt. Es gibt kaum ein europäisches Land, das nicht auf germanische Ahnen zurückblicken kann. Als einheitliches Volk hat es die Germanen nie gegeben. Hinter der Bezeichnung verbergen sich zahlreiche Stämme und Sippen, die ab Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Christus in Mittel- und Nordeuropa gelebt haben und die unterschiedlicher nicht sein können. „Wild blickende blaue Augen, rötliches Haar und große Gestalten, die allerdings nur zum Angriff taugen.“ So abfällig beschreiben die Römer die Barbaren östlich des Rheins.Gemeint sind die Germanen, die selbst ihren Namen einem Römer zu verdanken haben. Julius Caesar soll sie in seiner Abhandlung über den Gallischen Krieg so genannt haben. Auch an ihrer Heimat lassen die Herrscher vom Tiber kein gutes Haar. Tacitus beschreibt sie als grauenerregendes, durch Wälder und Sümpfe durchsetztes, grässliches Gebiet. Fast alles, was über die Germanen bekannt ist, überliefern die Römer. Beide verbindet eine jahrhundertelange, meist kriegerische Geschichte. Die germanische Art zu kämpfen geht bei den Feinden in die Geschichte ein – als Furor Teutonicus, die teutonische Raserei. Nach vielen Schlachten gipfelt der Machtkampf beider Völker in der berühmten Varusschlacht. Die Germanen bringen den Römern im Jahr neun nach Christus ihre traumatischste Niederlage bei. Am Ende können sich die Germanen gegen das Imperium Romanum durchsetzen und den Feind immer weiter zurückdrängen. Dabei waren die Germanen keine tumben Urwald-Barbaren, keine heroischen Wagnergestalten und erst recht nicht die Vorläufer einer rassistischen Weltanschauung. So unterschiedlich die einzelnen Stämme auch waren, die Germanen stehen für eine reiche Kultur. Ihnen verdanken wir viele Brauchtümer, die aus ihrer heidnischen Glaubensvorstellung entstanden sind. Auch zahlreiche Sagengestalten, die heute noch in Fantasy-Romanen, Kinoproduktionen und Computerspielen Millionen begeistern, haben einst Germanen erfunden. Und nicht zuletzt sind noch immer viele germanische Sprachelemente in deutschen Dialekten und im hochdeutschen Alltagsvokabular wiederzufinden. Heute sprechen rund 500 Millionen Menschen Sprachen, die auf germanische Wurzeln zurückgehen. Legendär ist der Frankenkönig Chlodwig I., der mit der Lex Salica eine bedeutende Gesetzessammlung hinterlässt, sich vom heidnischen Glauben abwendet und zum Christentum bekennt. Mit Wort und Waffe beginnt er einen Kampf gegen die germanischen Stämme und für ein geeintes Reich. Dieser frühe und mit fragwürdigen Mitteln erkämpfte Europagedanke erreicht seinen Höhepunkt mit dem bekanntesten Franken: Karl der Große. So waren es die Germanen Chlodwig und Karl der Große, die schon vor Jahrhunderten den Grundstein für ein gemeinsames Deutschland und Europa gelegt haben. In den deutschen Bundesländern leben die germanischen Sippen, wie die der Sachsen, Bajuwaren, Sueben oder Chatten bis heute weiter. Und viele europäische Staaten sind aus germanischen Königreichen hervorkommen. In Folge der Völkerwanderung gründen unterschiedliche Stämme ab dem vierten Jahrhundert nach Christus Reiche in Frankreich, England, Spanien, Deutschland, Italien, Skandinavien und sogar in Nordafrika. Wie die Griechen und Römer gehören auch die Germanen zu den Ahnen Europas. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 22.10.2016 ZDFneo Große Völker: 6. Die Araber
50 Min.Als Förderer der Wissenschaften haben die Araber Europa im ausgehenden Mittelalter entscheidend verändert. Ihre Errungenschaften stehen im Mittelpunkt dieser Folge „Große Völker“. Ab dem 8. Jahrhundert gelangt das Wissen der Antike und des Alten Orients nach Europa. Ob in der Heilkunst, der Mathematik, der Astronomie oder der Philosophie die arabischen Gelehrten sind ihrer Zeit weit voraus und prägen unsere Welt bis heute. „Araber“ werden im 9. Jahrhundert vor Christus erstmals die Stämme genannt, die schon seit jeher die arabische Halbinsel bewohnen.Das Wort ist vermutlich von „abara“ abgeleitet, was im Arabischen und Hebräischen „umherwandern“ bedeutet. Tatsächlich sind damals viele Menschen Nomaden. Andere dagegen sind sesshaft geworden – wie im legendären Königreich von Saba, das durch die Einnahmen aus dem Handel mit Weihrauch und Myrrhe zu Reichtum und Macht gelangt. Trotzdem spielen die Araber auf der großen Weltbühne lange keine Rolle. Sie sind zerstritten, außer ihrer Sprache verbindet sie wenig. Kein gemeinsamer Staat oder Führer eint sie. Noch um 600 nach Christus, als in Deutschland Mönche und Bauern leben und die Könige der Merowinger über die Franken herrschen, spricht kaum ein Mensch von den Arabern. Das ändert sich erst mit dem Religionsgründer Mohammed. Nach Visionen in der Wüste bekehrt er in Mekka und Medina tausende Menschen, schafft die Vielgötterei ab und eint alle arabischen Stämme im Glauben an den einen Gott: Allah. Mohammeds Nachfolger erobern in nur einem Jahrhundert ein Reich, das von Indien über ganz Nordafrika bis nach Spanien reicht. Bald sind etwa 60 Millionen Menschen ihre Untertanen. Aus Wüstennomaden sind Weltherrscher geworden. Und die Kalifen wissen: Wenn sie diese Rolle ausfüllen wollen, müssen sie sich das Wissen der Welt aneignen. Sie brauchen Mathematiker, um ihre Verwaltung zusammenzuhalten und gewaltige Bauten zu konstruieren. Mediziner, um Leben zu retten und ihre Eliten gesund zu halten. Techniker, Mechaniker und Landwirtschaftsexperten. Wer viel weiß, sind sie überzeugt, wird Erfolg haben. So beginnt von Bagdad bis Córdoba die Blütezeit der arabischen Wissenschaft. Kalifen füllen ihre Bibliotheken mit dem Wissen der Inder, Perser, Griechen und Römer. Sie nehmen Philosophen, Übersetzer, Mediziner, Astronomen, Dichter und Sänger in ihre Dienste. Ob im „Haus der Weisheit“ in Bagdad oder an den Medizinschulen Córdobas – oft arbeiten Christen und Juden, Perser, Turkmenen und Nordafrikaner gemeinsam. Es ist eine Zeit der intensiven Forschung, der Innovationen und Sammlerleidenschaft. Die Gemeinschafssprache, die alle Gelehrten nutzen, ist nun nicht mehr Griechisch oder Latein, sondern Arabisch. Doch dieses goldene Zeitalter endet schon bald. Äußere Feinde und innere Streitigkeiten zerrütten das arabische Reich. Die Weltoffenheit des jungen Islam wird abgelöst von einer Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln und eine konservative Auslegung des Glaubens. Nach der Rückeroberung Spaniens durch die Christen geschieht in Andalusien etwas Einzigartiges: Die Wissensschätze der Araber werden ins Lateinische übersetzt und in ganz Europa verbreitet. Die Menschen beginnen, die indischen Zahlen zu benutzen, die wir heute „arabische“ nennen. Sie lernen eine fortschrittliche Medizin und nicht zuletzt die antiken Klassiker kennen – von Aristoteles bis Pythagoras. Europa erfährt einen Quantensprung des Wissens, der die rege Forschungstätigkeit der Renaissance maßgeblich beeinflusst. Heute ist der Graben zwischen islamischer und westlicher Welt tiefer denn je. Es scheint, als driften diese Kulturen immer weiter auseinander. Umso mehr sollten wir uns daran erinnern, dass unsere Kultur neben den griechisch-römischen und jüdisch-christlichen Wurzeln noch eine dritte Wurzel hat: die arabische Kultur. Und hoffentlich werden auch in der arabisch-islamischen Welt wieder Stimmen lauter, die daran erinnern, dass es ihre Vorfahren waren, die einst die „Globale Forschung“ gefördert haben – den freien Austausch von Ideen über politische und religiöse Grenzen hinweg. Für ein Wissen, das allen Menschen dient. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 22.10.2016 ZDFneo Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand
60 Min.Die nächtliche Aura des Eiffelturms wurde durch die Installation von Scheinwerfern weiter verstärkt. Kein Wunder, dass seine spektakuläre Präsenz in der Pariser Nacht ihn zum Sinnbild der Stadt der Liebe machte.Bild: ZDF und SETE, Helene HuygheDer Eiffelturm gilt heute als Ikone der Architektur und Geniestreich moderner Ingenieurskunst. Doch wie gelang es Gustave Eiffel damals, die Menschen für seine Stahlkonstruktion zu begeistern? Als risikofreudiger Visionär, ein „Steve Jobs der Industrialisierung“, schuf Eiffel mit seiner Stahlkonstruktion von 300 Metern Höhe das damals höchste Bauwerk der Welt. Fast ebenso wichtig waren jedoch seine Fähigkeiten als Geschäftsmann und Marketingstratege. Paris 1889. Gustave Eiffel befindet sich auf dem Höhepunkt seines Ruhmes.Für die Weltausstellung hat er gerade den Traum aller Ingenieure verwirklicht: den höchsten Turm der Welt im Herzen der französischen Hauptstadt zu errichten. „Große Dinge entstehen nur durch Menschen mit erheblicher Risikobereitschaft, Erfindungsreichtum und Ausdauer. Eiffel war die perfekte Kombination von Ingenieur und Unternehmer. Das hat ihn groß gemacht“, sagt Ursula Muscheler, Architektin und Autorin des Buches „Die Nutzlosigkeit des Eiffelturms“. Gustave Eiffel verstand es, die klügsten Köpfe seiner Zeit für sich zu gewinnen. In seinem Pariser Ingenieursbüro arbeiteten große Talente, die er geschickt seine Visionen umsetzen ließ oder deren Visionen er für sein Unternehmen vereinnahmte. So entstanden von Beginn an bahnbrechende Eisenkonstruktionen, die neue Maßstäbe setzten. Aber ein eiserner Turm, der mitten in Paris ohne Sinn und Zweck einfach so in die Höhe ragte, das galt vielen Kritikern als monströse, ja sogar lebensgefährliche Idee. Anwohner aus der Nachbarschaft der Baustelle verklagten den Unternehmer, da sie Angst hatten, die Konstruktion würde auf ihre Häuser stürzen und sie unter den Trümmern begraben. Führende Intellektuelle, wie der Schriftsteller Guy de Maupassant oder der Erbauer der berühmten Pariser Oper, Charles Garnier, veröffentlichten einen Brandbrief, in dem sie den Turm eine „Schande für Paris“ nannten. Doch Eiffel ließ sich nicht beirren. Er übernahm einen nicht unwesentlichen Teil der Kosten und das gesamte Risiko und baute seinen Turm – in nur zwei Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen. Und dann wendete sich das Blatt: Troja-Entdecker Heinrich Schliemann war einer der wenigen deutschen Prominenten, die wahrscheinlich sogar von Eiffel persönlich in luftige Höhen geführt wurden. Er dankte es ihm mit Begeisterung und schrieb, der Eiffelturm sei ein Meisterwerk des technischen Fortschritts und ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Und die Menschen strömten zu Tausenden zum Turm, um zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Stadt von oben betrachten zu können. Warum der Eiffelturm trotzdem 20 Jahre nach seiner Errichtung fast dem Erdboden gleichgemacht wurde, welchen wissenschaftlichen Wert er bis heute hat und warum ein 10.000 Tonnen schweres, überwiegend funktionales Eisenbauwerk ausgerechnet zum globalen Symbol der Liebe geworden ist, schlüsseln führende Experten auf. Aufwendige 3-D-Grafiken erklären die bahnbrechenden Techniken, die diesem ikonischen Bauwerk zugrunde liegen. Hochwertige Animationen lassen die Emotionen wieder aufleben, die sich damals bei den Bauherren und anderen Beteiligten Bahn brachen. Das abenteuerliche Auf und Ab des Unternehmers Gustave Eiffel und das Ringen des Ingenieurs mit seinen Hauptgegnern, dem Wind und der konservativen Öffentlichkeit, machen diese Dokumentation zu einem packenden Stück Zeit- und Ingenieursgeschichte. Bis heute strahlt der Eiffelturm eine riesige Sogwirkung auf Menschen aus aller Welt aus. Dieses „Menschheitsbauwerk“ hat nichts von seiner Strahlkraft verloren. Es gilt als eine der meistbesuchten Attraktionen weltweit. Zeit also, zum 100. Todestag von Gustave Eiffel die vielen unbekannten Geschichten und Geheimnisse rund um die Entstehung seines Meisterwerks zu erzählen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 20.12.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Mo. 25.12.2023 ZDF Der Hai – Magie eines Monsters
Haie und Rochen vor den Objektiven modernster Kamerasysteme: In allen Weltmeeren war das Kamerateam unterwegs und filmte dabei noch nie beobachtetes Verhalten der Meeresräuber. Gigantische Walhaie, über Land krabbelnde Epaulettenhaie, fliegende Rochen, rasend schnelle Makos und sogar leuchtende Haie alles, was in der Hai-Society Rang und Namen hat, gibt Einblick in eine faszinierende Welt. So hat man Haie und Rochen noch nie gesehen. In aufwändigen Dreharbeiten an Dutzenden von Schauplätzen rund um den Globus gelangen den Teams Aufnahmen von dramatischen Situationen und faszinierendem Verhalten in bestechender Bildqualität.Dabei kamen die eindrucksvollsten Mitglieder der Hai-Society und der mit ihnen eng verwandten Rochen vor die Objektive modernster Kamerasysteme. Zeitlupen- und von Helikoptern aus geschossene Cineflex-Aufnahmen machen kaum bekannte Eigenschaften, Fähigkeiten und überraschendes Verhalten des Knorpelfisch-Clans sichtbar. Unter dem arktischen Eis fristet der steinalte Grönlandhai sein Dasein, in den Weiten der tropischen See jagt der pfeilschnelle Makohai seiner Beute nach, am Grund flacher Korallenmeere lauert bis zur Unsichtbarkeit getarnt ein Teppichhai und schlägt blitzartig zu. Rochen fliegen in Schwärmen über den Wellen und vollführen spektakuläre Sprünge. Paarungswillige Mantas, Wal- und Hammerhaie versammeln sich in Massen, um einen Partner zu finden. Zitronenhaie gebären lebende Junge, die in Kinderhorten zwischen Mangroven vor Feinden sicher aufwachsen. Der Film zeigt in grandiosen Bildern viele erstaunliche wie geniale Anpassungen an die unterschiedlichen Lebenswelten der Knorpelfische. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 14.08.2016 ZDF Hannibal – der Feind Roms
Hannibal – der Name kommt einem Markenzeichen gleich. Er steht für einen der prominentesten Feldherren des Altertums – und eine strategische Großtat, die in der Geschichte der kriegerischen Auseinandersetzungen als beispiellos gilt. Sein legendärer Zug über die Alpen: Himmelfahrtskommando und Geniestreich zugleich. Doch wer war dieser Hannibal wirklich – jener Mann, der Rom das Fürchten lehrte? (Text: ZDF)Die Hannibal-Expedition
Hannibals Alpenüberquerung ist legendär, über welchen Pass er sein gigantisches Heer führte, ein Rätsel. Jetzt glauben Forscher, die Route anhand von Pferdemist beweisen zu können. Der Geomorphologe William Mahaney von der Universität Toronto und sein Team sind davon überzeugt, dass der Karthager sein Heer über den 3000 Meter hohen Col de la Traversette geführt hat. Bodenanalysen weisen darauf hin. Die Leistung Hannibals war schon zu seinen Lebzeiten Legende. Immerhin marschierten 218 vor Christus laut Überlieferung Zigtausende Soldaten, mehrere Tausend Pferde und Maultiere sowie 37 Elefanten in fünf Monaten rund 1500 Kilometer zu Fuß von der Iberischen Halbinsel über die Alpen bis nach Italien, um die Weltmacht Rom anzugreifen.Aufsehen erregten vor allem die Kriegselefanten – solche Tiere hatte man in dieser Gegend noch nicht gesehen. Die Karthager – damals eine der Supermächte am Mittelmeer – nutzten die Tiere allerdings schon länger für den Kriegseinsatz. In einem aufwändigen Experiment wird im Film mit Hilfe von Flößen nachgestellt, wie Hannibal seine Elefanten auf dem Weg ins Gebirge über die Rhone schaffen konnte. Experten erklären, wie gelenkig Elefanten sind und wie sie mit unwegsamem Gelände und Kälte umgehen. Die Frage, welche Route Hannibal durch die Alpen nahm, fasziniert Abenteurer und Wissenschaftler seit Jahrhunderten. Eine Forschergruppe glaubt, jetzt beweisen zu können, dass Hannibal den Weg über den fast 3000 Meter hohen Col de la Traversette nahm. „Nur von hier aus konnte Hannibal in die Po-Ebene blicken“, sagt der Geomorphologe William Mahaney, und in den Quellen sei dieser Blick beschrieben. Der Kanadier und sein Team, darunter der Mikrobiologe Chris Allen von der Universität Belfast, haben Bodenproben von der französischen Seite des Passes ausgewertet. Die darin gefundenen Darmbakterien haben ergeben, dass zahlreiche Pferde zu Hannibals Zeiten hier durchgezogen sein müssen. Auf einer Expedition im Sommer 2017 haben sie nun auch Proben von der italienischen Seite des Passes genommen. Sie hoffen, dass die Ergebnisse ihre These untermauern. Welchen Weg der Karthager auch genommen hat – der Marsch auf Rom war eine taktische und logistische Meisterleistung. Um die kühnste militärische Operation der Weltgeschichte ins Bild zu setzen, wurden die dokumentarischen Sequenzen unter anderem in den Alpen, an der Donau und in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, während die Spielszenen von Regisseur Carsten Gutschmidt in Bulgarien in Szene gesetzt wurden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 07.07.2018 ZDFmediathek (ab 19:30 Uhr) Deutsche TV-Premiere So. 08.07.2018 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail