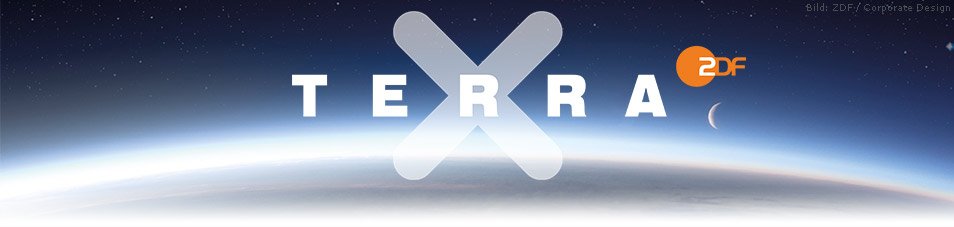1524 Folgen erfasst (Seite 54)
Troja ist überall: 1. Rivalen im Mayareich
45 Min.Die Archäologie, von Johann Joachim Winckelmann im 18. Jahrhundert begründet, von Heinrich Schliemann 100 Jahre später quasi per Urknall ins öffentliche Bewusstsein katapultiert und schließlich Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Entdeckungen in Ägypten und Südamerika endgültig in die wissenschaftlichen Königsdisziplinen aufgenommen, ist ihrer Natur nach eigentlich völlig ungeeignet, Aufmerksamkeit oder gar Aufregung zu erzielen und einen Platz im Populären zu finden. Die unscheinbare Altertumswissenschaft, auf Ruinen und Trümmer gegründet, hat aber durch ihre Fähigkeit, Träume zu produzieren und Triumphe zu ermöglichen, ihr Aschenputtel-Dasein schnell hinter sich gelassen und einen unnachahmlichen Siegeszug angetreten. Mit einem Dreiteiler zum Auftakt einer auf Fortsetzung angelegten Dokumentarreihe möchte das ZDF wichtige Stationen dieses Siegeszuges nachzeichnen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 04.11.2007 ZDF Troja ist überall: 2. Auferstehung am Vesuv
45 Min.Die Katastrophe dauerte rund 20 Stunden, danach hatte der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 nach Christus die Städte Herculaneum und Pompeji unter einer 20 Meter hohen Asche- und Lavaschicht begraben. Es war eine der großen Tragödien der Menschheit – und ein Glücksfall für die Wissenschaft: der Untergang von Herculaneum und Pompeji. Vor rund 300 Jahren sind die verschütteten Städte am Vesuv entdeckt worden, zwei der wichtigsten Schatzkammern aus der Antike, die noch immer erforscht werden, inzwischen mit den modernsten Methoden. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 11.11.2007 ZDF Troja ist überall: 3. Das Versteck der Pharaonen
45 Min.In der Mitte des 19. Jahrhundert waren es vor allem Abenteurer, die auszogen, um das Gold und die Kunstschätze des Alten Ägypten zu rauben. Sie sprengten sich ihren Weg in die Gräber der Pharaonen mit Dynamit frei und verließen das Nilland mit reich gefüllten Schatzkisten. Bis aus den intellektuellen Zentren Europas ein neuer Geist Ägypten erreichte, und mit ihm die Methoden einer neuen Generation von Forschern, für die der wissenschaftliche Schatz weit bedeutender war als das Gold der Pharaonen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 18.11.2007 ZDF Troja ist überall: 4. Das Rätsel von Machu Picchu
45 Min.Der Morgen des 24. Juli 1911: Nebel verschlechtert die Sicht, und nur wenig Licht scheint durch das dichte Gewächs. Ein junger Amerikaner kämpft sich einen unwegsamen Andenpass hinauf. Immer wieder rutscht der Mann ab, Blattwerk peitscht ihm ins Gesicht, Gestrüpp auf dem Boden fesselt ihn. Seine Gesichtszüge sind verzerrt, vor Anstrengung und Schmerz. Als er endlich oben ankommt, macht er die spektakulärste Entdeckung in der Geschichte der Inkaforschung. Vergessen im nahezu unzugänglichen Gebirge Perus und dem dichten Nebel des Regenwaldes thront die atemberaubende Festung Machu Picchu, auf einem Felssporn hoch über dem Urubambatal. Es soll der wichtigste Tag im Leben des amerikanischen Forschers Hiram Bingham werden. Er selbst misst dem Fund zunächst allerdings nur wenig Bedeutung bei, da er in den Schriften spanischer Chronisten keinen Hinweis auf den Ort findet. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 18.05.2008 ZDF Troja ist überall: 5. Der falsche Schatz des Priamos
45 Min.Die berühmteste Grabung deutscher Archäologen: Ein Hügel im Nordwesten der Türkei, nur wenige Kilometer von der Meerenge der Dardanellen entfernt, gelegen an der Grenze zwischen Europa und Asien. Die Anhöhe trägt den Namen Hissarlik (türkisch: „mit Burg versehen“) und war über drei Jahrtausende bevölkert. Wie eine Zwiebel Schicht für Schicht, Siedlung um Siedlung war er in die Höhe gewachsen. In das Zentrum der Weltöffentlichkeit rückt der Ort am 5. August 1873 durch eine Nachricht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung: Heinrich Schliemann findet nach jahrelanger Suche auf dem Hissarlik einen Goldschatz, den er König Priamos zuschreibt und der somit die Existenz der legendären Stadt Troja beweise. Doch die Thesen, die Schliemann berühmt machen, entsprechen nicht der wahren Geschichte. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 25.05.2008 ZDF Troja ist überall: 6. Das Wunder am Indus
45 Min.London, 20. September 1924: An diesem Tag erfährt die Öffentlichkeit von der Entdeckung einer versunkenen Zivilisation, nach der niemand gesucht hatte und für die es bis dahin in keinem antiken Text auch nur das kleinste Indiz gegeben hat. Die Illustrated London News berichtet über eine vergessene, versunkene Zivilisation am Indus, eine bronzezeitliche Hochkultur auf dem indischen Subkontinent. Das Glück, dieses Wunder, diese spektakuläre Entdeckung wird einem britischen Forscher zuteil, der heute gerne als Sherlock Holmes der Archäologie bezeichnet wird: John Hubert Marshall. Jahrelang hatte er zunächst unscheinbare Fundstücke analysiert, rätselhafte Werkzeuge, Figuren und Siegel, die entlang des großen Flusses Indus aufgetaucht waren.Bis er plötzlich verstand, dass sie alle zusammenhingen, dass sie von einer großen, bisher nicht bekannten Zivilisation stammen mussten. Vom Meisterdetektiv unterscheidet er sich kaum in der Methode, wohl aber in der ihm eigenen Bescheidenheit, die dazu geführt haben mag, dass von Marshall keine umfassende Biografie existiert. „Troja ist überall“ ist die erste Sendereihe, die seiner dramatischen Indizienjagd eine Prime-Time-Dokumentation widmet. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 01.06.2008 ZDF Das Trojanische Pferd: Auf der Spur eines Mythos
45 Min.„Terra X – Das Trojanische Pferd – Auf der Spur eines Mythos“ betrachtet in eindrucksvollen Bildern neueste Fakten und Interpretationen rund um die berühmte Sage.Bild: Gruppe 5 / Scope VFXDie Geschichte des Trojanischen Pferdes gehört zu den berühmtesten Mythen. Aber hat es sich so zugetragen? Oder muss die Geschichte des Pferdes umgeschrieben werden? Davon ist der italienische Unterwasserarchäologe Francesco Tiboni überzeugt. Der aufwendig gedrehte Film begleitet Tiboni auf seiner Spurensuche. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen betrachten neueste Fakten und Interpretationen rund um das Trojanische Pferd. Der griechische Dichter Homer ist es, der die Geschichte des Trojanischen Krieges aufschreibt.Ein zermürbender Krieg, der zehn Jahre dauert. Griechen kämpfen gegen Trojaner. Die mächtige Stadt Troja bleibt standhaft, ihre Mauern scheinen undurchdringlich. Bis eine List den Trojanischen Krieg beendet: Ein gigantisches Holzpferd wird den Trojanern als Geschenk präsentiert. Doch im Bauch des Holzpferdes sitzen die besten Krieger der Griechen. Nichts ahnend ziehen die Trojaner das Pferd in ihre Stadt. Im Schutz der Dunkelheit schlüpfen die Griechen aus dem Pferd und öffnen ihren Kameraden die Tore. Das mächtige Troja geht in Flammen auf. Homers Epos über den Fall Trojas ist erst viele Jahrhunderte nach dem tatsächlichen Untergang der Stadt geschrieben worden. Die Frage, welche Rolle der Autor bei der ursprünglichen Interpretation und Entstehung des Mythos hat, ist also zulässig. Wann ist die Idee vom Trojanischen Pferd als Symbol für den griechischen Sieg tatsächlich entstanden? Handelt es sich hier um Fantasie, Verwechslung oder gar um antike Geschichtsfälschung? Francesco Tiboni bringt archäologische Erkenntnisse zutage, die dabei helfen könnten, das 3000 Jahre alte Rätsel zu lösen. Die historischen Funde und Darstellungen sind ihm zu uneinheitlich, um zueinander zu passen. Tiboni bereist archäologische Schauplätze, beleuchtet konkurrierende Theorien über die Kriegslist der Griechen und das berühmt gewordene Ende des Trojanischen Krieges. Die Filmemacher tauchen mit ihm in die Tiefen des Mittelmeeres, wo er schließlich Hinweise findet, die ihn veranlassen, den 3000 Jahre alten Mythos neu zu deuten. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 24.03.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 28.03.2021 ZDF Tropenfieber: 1. Die Eroberung des Amazonas
45 Min.Deutsche TV-Premiere So. 07.09.2003 ZDF Tropenfieber: 2. Mission Südland
45 Min.Als Louis-Antoine de Bougainville 1766 von Nantes in Frankreich mit dem Expeditionsschiff „La Boudeuse“ aufbrach, hatte der gelernte Mathematiker und Diplomat den festen Vorsatz, als einer der ersten Menschen die Welt zu umsegeln. Noch immer war nicht überall akzeptiert, dass die Welt eine Kugel sei. Als Bougainville am 5. April 1768 Tahiti entdeckte, war dies die Rettung vor dem sicheren Tod. Und für den schöngeistigen Bougainville ein Wendepunkt in seinem Denken. Tahiti war für Bougainville und seine ausgehungerten Männer nichts weniger als das wieder entdeckte Paradies auf Erden.Das Schlaraffenland von Tahiti und Freizügigkeit der Sexualität im immerwährenden Sommer der Südsee verdrehte dem Franzosen den Kopf. Erst als der Häuptling der Tahitianer den Gästen verständlich machte, dass seine Gastfreundschaft nicht auf Dauer gelte, kehrte Bougainville zu europäischem Pflichtbewusstsein zurück. Die Weiterreise durch die völlig unbekannten Atolle, Riffe und Untiefen der Südsee freilich schickte Bougainville und seine Mannschaft erneut in höchste Gefahren. Unter gleißender Sonne quälten Hunger und Skorbut die Franzosen. Und stündlich mussten sie auf den unberechenbaren, gänzlich unbekannten Korallenriffs mit dem Leckschlagen ihres Schiffes rechnen. Am Great Barrier Reef drehte Bougainville entnervt nach Norden ab – er wäre sonst als Entdecker Australiens in die Geschichte eingegangen. So aber blieb Bougainville nur der sanfte Nachruhm, einer der beliebtesten Blumen, den Boungainvilleen, seinen Namen gegeben zu haben. Im Jahr 2003 verdient der Franzose Teva Sylvain, geboren in Papeete, der geschäftigen Hauptstadt von Tahiti, sein Geld mit Fotos von halbnackten Insulanerinnen vor Postkartenkulisse. Sylvains Fotos sind überall, an jedem Kiosk und auf jedem Zuckerwürfel im Café. Seit die französischen Truppen aus Polynesien weitgehend abgezogen sind, gehen die Geschäfte mit den harmlosen Fotos im Evakostüm nicht mehr so gut, aber das Leben im Paradies ist Sylvain geblieben. Auf der Insel Bougainville, die nach dem Entdecker benannt ist und die Papua-Neuguinea gehört, herrschte dagegen mehr als zehn Jahre Bürgerkrieg. Noch immer ist der Ausnahmezustand verhängt. Der Streit um die gigantische Gold- und Kupfermine Panguna hat die Zentralregierung, einheimische Landbesitzer, Tagelöhner und die ausländischen Minen-Betreiber in eine blutige Auseinandersetzung getrieben, bei der mindestens 10000 Menschen getötet wurden – zehn Prozent der Inselbevölkerung. Viele Tausende mussten fliehen. So auch Surei Stevenson. Die Kamera begleitet sie bei ihrer Rückkehr in die einstige Kolonie Bougainville, die nach 15 Jahren des wirtschaftlichen Stillstands fast überall in einen paradiesischen Zustand zurückversetzt scheint. Außer dort, wo die Guerillas ihr Territorium zäh verteidigen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 14.09.2003 ZDF Tropenfieber: 3. Im Land der Kopfjäger
45 Min.Deutsche TV-Premiere So. 21.09.2003 ZDF Tropenfieber: 4. Logbuch Bounty – Das Rätsel der Meuterei
45 Min.1787 startet die „HMS Bounty“ auf eine Reise, die bis heute zu den berühmtesten in der Geschichte der Seefahrt zählt. Captain William Bligh, 33 Jahre alt, hat sich zuvor als Navigator unter dem berühmten Entdecker James Cook einen Namen gemacht. Sein jetziger Auftrag klingt zunächst wenig aufregend: Die Bounty soll auf Tahiti Brotfruchtpflanzen sammeln und in die Karibik befördern. Die britische Krone will die Pflanze als billiges Nahrungsmittel für die dortigen Sklaven einsetzen. Tatsächlich erfüllt die Mannschaft der Bounty ihre Aufgabe zunächst reibungslos, der monatelange Aufenthalt auf Tahiti hat für die Matrosen fast paradiesische Züge.Doch auf der Weiterfahrt kommt es am 28. April 1789 zur Katastrophe. Unter Führung Fletcher Christians meutert die Mannschaft und setzt den Kapitän mit wenigen Getreuen in einem Beiboot aus. In einer nie da gewesenen nautischen Meisterleistung navigiert der Kapitän die Schaluppe über 5800 Kilometer nach Timor im heutigen Indonesien. Einen Großteil der Meuterer verschlägt es nach einer Irrfahrt auf die Insel Pitcairn, wo sie das Schiff versenken. Ihre Nachfahren leben noch heute dort. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 09.09.2007 ZDF Tropenfieber: 5. Vorstoß am Orinoco – Humboldts Entdeckungen in Südamerika
45 Min.1799 startet der junge Alexander von Humboldt zu einer Reise ins Ungewisse. Von Humboldt will gemeinsam mit seinem französischen Freund Aimé Bonpland den Orinoco im damals noch fast unerforschten Regenwald von Südamerika bereisen und nachweisen, dass es eine Verbindung zwischen dem Orinoco und dem Amazonassystem gibt. Die Genehmigung dazu holt er sich von der spanischen Krone. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 16.09.2007 ZDF Tropenfieber: 6. Wagnis im Dschungel: Mary Kingsley unter Kannibalen
45 Min.1895 trifft die behütete viktorianische Lady Mary Kingsley einen folgenschweren Entschluss. Als ihr Vater, ein Arzt und Teilzeit-Völkerkundler, stirbt und auch die Mutter wenige Wochen später begraben wird, steht Mary mit 32 Jahren allein da. Zu alt, um auf dem Heiratsmarkt noch wirkliche Chancen zu haben. Sie beschließt, das Erbe ihres Vaters anzutreten und dessen ethnologisches Lebenswerk zu vollenden. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 23.09.2007 ZDF Tsunami – Die Todeswelle
Tsunami – Eine Welle erschüttert die Welt
Tulpenfieber – Faszination einer Pflanze
Die Schönheit der Tulpe verzauberte Herrscher und Händler, trieb Kaufleute in den Bankrott und Blumenzüchter in die Verzweiflung. (Text: Phoenix)Tutanchamun: Der Junge hinter der Goldmaske
45 Min.Der plötzliche Tod von Tutanchamun im Alter von nur 19 Jahren gibt immer noch Rätsel auf.Bild: ZDF und Adnane KorchyouTutanchamun ist die Ikone des Alten Ägypten. Der „Terra X“-Moderator Mirko Drotschmann reist ins Land am Nil, erklärt die neueste Forschung und nähert sich dem Jungen hinter der Goldmaske.Die Entdeckung seiner Mumie mit der Goldmaske machte Tutanchamun zum Superstar. Dabei zählt der Kindkönig nicht zu den großen Pharaonen der ägyptischen Geschichte. Doch das Bild muss revidiert werden, wie Mirko Drotschmann auf seiner Spurensuche herausfindet. Die goldene Totenmaske von Tutanchamun ist der berühmteste archäologische Fund Ägyptens. Vor allem die tiefschwarz schimmernden Augen aus Obsidian ziehen viele Menschen in den Bann. Sie scheinen wie ein Fenster in die Seele des jungen Pharao. Wer ist der Junge hinter der Goldmaske? Was haben Forscher über sein Leben und sein Wirken herausfinden können? Was geben die 5400 Grabbeigaben über ihn preis? „Terra X“-Moderator Mirko Drotschmann will das herausfinden. Er trifft prominente Experten, folgt Tutanchamuns Lebensstationen in Ägypten und erhält exklusiven Einblick in die Restaurierungswerkstätten und Labore der Archäologen. Im Ägyptischen Museum in Kairo ist der Moderator dem Rätsel um Tutanchamuns Mutter auf der Spur. Im Tempelbezirk von Karnak geht er der Frage nach, ob der Pharao nur eine Marionette seiner Berater war oder ob er nicht doch eigene Impulse gesetzt hat. Es gibt nur wenige Daten über Tutanchamun. Umso vielfältiger sind die Thesen und Rekonstruktionen um sein Leben und Sterben. 100 Jahre nach der Entdeckung seiner Grabanlage im Tal der Könige bringen Forscher mit neuen Untersuchungsmethoden Licht ins Dunkel seiner Geschichte. Die Ägyptologin Salima Ikram erklärt, warum Tutanchamun als einziger Pharao mit erigiertem Penis, aber ohne Herz bestattet wurde. Mit dem Mumienforscher Frank Rühli diskutiert Mirko Drotschmann anhand von CT-Aufnahmen, welche Krankheiten der Junge hatte und welche Gründe es für seinen frühen Tod geben könnte. Der Archäologe Philipp Stockhammer konnte anhand von Nahrungsrückständen herausfinden, welche Speisen am Hof von Tutanchamun, Echnaton und Nofretete serviert wurden – ein Menüplan voller Überraschungen. Auf der Basis von wissenschaftlichen Rekonstruktionen wird in Spielszenen gezeigt, wie Tutanchamun die religiöse Revolution seines Vaters Echnaton erlebte, wie er auf seine Rolle als Pharao vorbereitet wurde und wie seine Ehe mit seiner Halbschwester Anchesenamun war. Als Herrscher gilt Tutanchamun als eher unbedeutend. Erst die Entdeckung seiner Grabanlage im Tal der Könige im Februar 1922 durch den englischen Archäologen Howard Carter machte ihn zu einem Superstar. Das Grab KV62 ist das einzige, das von Grabräubern nahezu verschont blieb. Howard Carter brauchte zehn Jahre, um die 5400 Objekte zu katalogisieren. Aufwendige 3-D-Animationen zeigen nicht nur die unterirdische Grabanlage, sondern auch, wie das Grab errichtet und ausgestattet wurde und warum es über mehr als drei Jahrtausende unentdeckt blieb. In der hochgelobten Wanderausstellung „Tutanchamun: Sein Grab und die Schätze“ entdeckt Mirko Drotschmann die aufwendige Rekonstruktion der Grabkammer mitsamt den Schätzen – darunter der Kinderthron von Tutanchamun, seine Sandalen, seine Gehstöcke und nicht zuletzt auch seine goldenen Streitwagen. Neuere Untersuchungen der Grabbeigaben beweisen, dass die Ägypter unter der Herrschaft des jungen Königs neue Ideen und Techniken entwickelt haben. Vom Erfindungsreichtum zeugt das erste Klappbett der Geschichte. Sensationell sind zwei Funde, die der Experte für antike Metalle, Christian Eckmann, untersucht hat: Mithilfe der Röntgenfluoreszenz-Analyse hat er nachgewiesen, dass der berühmte Eisendolch Tutanchamuns aus Meteor-Eisen besteht. Ebenso spektakulär sind die 100 Goldbleche mit prächtigen Motiven, die Eckmann mit seinem Team in jahrelanger Detailarbeit aus Fragmenten zusammengepuzzelt hat. Zum 100-jährigen Jubiläum der Entdeckung der Grabanlage steht die Einweihung des „Grand Egyptian Museum“ in Gizeh bevor. Erstmals sollen dort sämtliche Artefakte aus der Grabkammer präsentiert werden. Die Ausstellungskonzeption der 7500 Quadratmeter großen Museumsfläche kommt aus Stuttgart. Die Architektin Shirin Frangoul-Brückner stellt Mirko Drotschmann die „Tutanchamun Gallery“ vor, die als Publikumsmagnet Millionen Besucher anziehen soll. Ausgerechnet der Pharao, der von seinen Nachfolgern aus der Geschichte getilgt wurde und der in der Forschung lange als unbedeutender Herrscher galt, ist heute die Galionsfigur des Alten Ägypten. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 16.03.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 20.03.2022 ZDF Überleben!: 1. Unser Erbe
45 Min.Die Wissenschaftlerin Antje Boetius im Gespräch mit dem Paläoarchäologen Tom Higham der Uni Wien über die Erfolgsgeschichte des Homo Sapiens.Bild: ZDF und Esther HorvathWarum hat sich ausgerechnet der Homo sapiens durchgesetzt? In der „Terra X“-Reihe „Überleben!“ untersucht die Systemforscherin Antje Boetius das Geheimnis unserer Erfolgsgeschichte. Sie analysiert, mit welchen Strategien es unseren Vorfahren gelang, in allen Naturräumen des Planeten heimisch zu werden. Auf der abgelegensten Forschungsstation Grönlands erforscht sie die Klimageschichte unseres Planeten. Denn: Am Anfang unserer Überlebensgeschichte steht die Anpassung unseres genetischen Erbes an die Entwicklung des globalen Klimas. In Eiskernen sind klimatische Umschwünge und geologische Katastrophen wie Vulkanausbrüche festgehalten.Harte Bedingungen für die vielen Menschenarten, die es einst gab. Wie diese jahrtausendelange Anpassungsgeschichte zu einem Gen-Booster in unserer Frühgeschichte wurde, belegt ein Durchbruch der Paläoarchäologie. In einer sibirischen Höhle wurde eine bis dahin unbekannte Menschenart gefunden. Ihre Gene tragen wir immer noch in uns. „Terra X – Überleben“ verfolgt auch die Überlebensstrategien des Homo sapiens in den extremen Naturräumen. Neueste Arbeiten zeigen auf, wie weitreichend die Mensch-Tier-Kooperation wirklich war. In den Wüsten hingegen haben Menschen ganz andere Methoden entwickelt, um in Hitze und Dürre zu bestehen. Erfolgreiches Beispiel: das System Oase. Alle Oasen sind künstliche, von Menschen geschaffene Überlebensorte. Antje Boetius folgt dem Weg des Wassers im ältesten, durchgehend bewohnten Ort Arabiens, der Oase Balad Sayt im Oman. Der letzte Naturraum, den Menschen besiedelten, war der gigantische Pazifik. In den endlosen Weiten Inseln und Atolle zu finden, erforderte eine nautische Meisterleistung. Wie das Wissen der Seefahrt mit den Überlebensstrategien auf winzigen Atollen zusammenhängt, erforscht Antje Boetius auf den Cookinseln. In den Regenwäldern der Erde bringen neueste bildgebende Verfahren die wahren Dimensionen vergangener Metropolen zum Vorschein. Über Jahrhunderte haben diese urbanen Zentren mitten in Wäldern existiert, Hunderttausende Menschen lebten dort. Die Dokumentation zeigt auf, wie unsere Vorfahren sich einen beeindruckenden Schatz an Überlebenswissen erarbeitet haben, der uns heute noch helfen könnte. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.09.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 29.09.2024 ZDF Überleben!: 2. Unsere Chancen
45 Min.Antje Boetius (2.v.l.) erfährt vom einzigen Meeresbiologen der Cook Islands Teina Rango (r.), wie es gelingt, altes Wissen mit neuen Strategien zum Naturschutz zu kombinieren.Bild: ZDFWie kann der Mensch auch in Zukunft überleben, ohne die Natur weiter zu zerstören? Damit befasst sich die Wissenschaftlerin Antje Boetius in dieser Folge der „Terra X“-Reihe „Überleben!“ Um herauszufinden, welche Chancen in dem vielfältigen Erbe des globalen Wissens stecken, begleitet sie verschiedene Forschungsexpeditionen in extreme Naturräume: ins Eis, in die Wüste, auf die Ozeane und in die Regenwälder. Als Meeresforscherin war Antje Boetius auf mehr als 50 Expeditionen und hat erlebt, wie sich Naturräume radikal verändern. „Die große Beschleunigung“ nennen Wissenschaftler die sprunghafte Explosion aller Parameter, mit denen menschliches Leben auf diesem Planeten erfasst wird: Erderwärmung und Weltbevölkerung, Verstädterung und Ressourcenverbrauch, Biodiversitätsverlust.Der Mensch hat die Natur und die Erde aus dem natürlichen Gleichgewicht gebracht. Antje Boetius’ Erkenntnis: Der Blick auf die verschiedenen Netzwerke und Kreisläufe der Natur ist notwendig, um Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Die Brutstätten des Lebens im Ozean sind Riffe. Ihr Zustand ist dramatisch. Welche Riffe sterben, welche überleben? Wie hängen Riffe mit den Aktivitäten an Land zusammen? Und wie kann man sie schützen? Auf Rarotonga, der Hauptinsel der Cookinseln im Pazifik, kämpfen Forscher erfolgreich um das biologische Gleichgewicht der Insel. Ihre Strategie: eine Kombination aus altem Wissen und modernen technischen Möglichkeiten. Die Cookinseln haben mittlerweile das weltweit größte Meeresschutzgebiet, „Marae Moana“, geschaffen, eine Fläche fünfmal so groß wie Deutschland. Es basiert auf dem Konzept des Gemeinguts. Die Renaissance dieser weltweit bekannten Strategie fließt inzwischen auch in internationale Gesetzgebung ein. Mit dem Agrarökonomen Andreas Bürkert geht die Systemforscherin Antje Boetius den Auswirkungen der globalen Massenproduktion von Lebensmitteln am Beispiel der Banane nach. Die meistverzehrte Frucht der Welt ist akut vom Aussterben bedroht. In einer verlassenen Oase im Oman hat Bürkert Samen einer alten, äußerst resistenten Bananenpflanze konservieren können. Auf Sri Lanka werden im Rest des ursprünglichen Regenwaldes mit ungewöhnlichen Methoden Arten erfasst, die vom Aussterben massiv bedroht sind, aber noch gerettet werden können. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.09.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 06.10.2024 ZDF Das Uhrwerk des Lebens: 1. Geschichte der Kindheit
45 Min.Aus der Domschule von Regensburg ist der mittelalterliche Brauch des Kinderbischofs überliefert. Dabei darf ein Kind an einem Tag im Jahr die Rolle des amtierenden Bischofs übernehmen – sehr zum Ärger des Vatikan.Bild: THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Februar Film/Februar Film/Februar FilmWas ist Kindheit und wie sah sie in der Geschichte der Menschheit aus? „Terra X“ blickt zurück in die Vergangenheit und stellt Fragen zur Kindheit, die uns auch heute noch beschäftigen.Biologisch verläuft die Kindheit immer noch so wie vor Tausenden von Jahren. Doch die Umstände, unter denen Kinder aufwachsen, haben sich radikal verändert. In der westlichen Welt von heute haben Millionen von Kindern die Chance, zu lernen und sich frei zu entfalten. Für die einen ist sie die schönste Zeit ihres Lebens. Für andere ist sie unerträglich. Die Kindheit ist die Zeit, in der wir am meisten wachsen und lernen. Kinder sind neugierig, sie bewegen sich mit großen Augen durch die Welt. Was ist Kindheit? Wie sind Erwachsene mit Kindern umgegangen? Wer musste arbeiten, wer durfte spielen und wer lernen? Welchen Wert haben Kinder – und wie wurden sie wahrgenommen? Gab es schon immer auch für Kinder aus armen Verhältnissen eine Chance auf Bildung? In der Geschichte der Menschheit geht es Kindern längst nicht immer gut. Im antiken Griechenland wird Kindheit als Zeit menschlicher Unvollkommenheit missachtet. In Rom hängt es allein vom Vater ab, ob er den Säugling annimmt, aussetzt oder sogar töten lässt. In der Neuzeit müssen Kinder oft mit in den Krieg ziehen, manchmal sogar als Soldaten an die Front. In manchen Epochen sterben viele von ihnen noch vor der Pubertät an Krankheiten wie Pocken, Diphtherie oder dem schwarzen Tod. Erst die Sternstunden der Medizin, das bessere Wissen um Hygiene und die Kinderheilkunde schenken den meisten Kindern ein langes Leben – zumindest in der westlichen Welt. Auch die Vorstellung von einer gelungenen Erziehung wird erst durch eine revolutionäre Idee geformt: Mit der Aufklärung – besonders durch den Roman „Emile“ von Jean-Jacques Rousseau – ändert sich das Bild von einer glücklichen Kindheit grundlegend. Rousseau fordert, dass sich Kinder frei entwickeln und unbelastet ihren Neigungen nachgehen dürfen. Die Erwachsenen sollen sie dabei nur unterstützen. Mit Rousseaus Werk wird das Konzept der autoritären Erziehung erstmals grundlegend hinterfragt, führt aber zu einer lautstarken Gegenreaktion. Doch wie immer: Kinder aus ärmeren Familien müssen hart arbeiten. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts tritt ein Kinderschutzgesetz in Kraft, dass Arbeit in Gewerbebetrieben für Jungen und Mädchen unter 12 Jahren verbietet. Und seit 1919 gilt für ganz Deutschland die Schulpflicht. In weiten Teilen der Erde aber ist Kinderarbeit noch heute gang und gäbe – vor allem in Asien und Afrika. Ihnen wird ihre Kindheit genommen und das Recht, sich frei zu entwickeln. Die Dokumentation erzählt von der Geschichte der Kindheit – vom ältesten Spielzeug, das Archäologen gefunden haben, von der Pädagogik im antiken Griechenland und von Kindesaussetzungen im alten Rom. Der Film thematisiert auch kindliche Rollenspiele an ehrwürdigen Domschulen und Schreibfehler auf Tafeln, die mehrere tausend Jahre alt sind. Interviews mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen helfen, Erkenntnisse über die Kindheit zu entdecken und sie zu deuten. Dabei kommt die Dokumentation zu überraschenden Ergebnissen. Denn vieles in der Geschichte der Kindheit war ganz anders als bislang angenommen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 20.07.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 24.07.2022 ZDF Das Uhrwerk des Lebens: 2. Geschichte des Alters
45 Min.Um im antiken Athen ein Amt zu erhalten, mussten die Anwärter (Alexander Gerganov, M.) in der Vollversammlung schwören, dass sie sich gut um ihre Eltern kümmern.Bild: THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Februar Film/Februar Film/Februar FilmAlle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. „Terra X“ möchte wissen, wie wir altern und wie sich der Blick auf das Alter im Lauf der Jahrtausende verändert hat.Die durchschnittliche Lebenserwartung der Deutschen liegt bei etwa 80 Jahren, Tendenz steigend. Nie gab es mehr Hundertjährige als heute. Wenn Körper und Geist fit sind, genießen die Alten den Herbst des Lebens – fühlen sich jung. Manche verlieben sich sogar noch mal. Ein langes Leben ist ein kostbares Geschenk. Viele Alte sind klug und weise, können andere mit ihrem Erfahrungsschatz bereichern. Das Alter ist aber auch die Zeit, in der die Kraft nachlässt, die Gebrechen zunehmen. Deshalb sehnt sich der Mensch schon immer danach, den Alterungsprozess zu stoppen – der Jungbrunnen ist eine Menschheitsfantasie. In vielen Kulturen werden Alte besonders respektiert und geehrt – in manchen gilt das Alter sogar als idealer Lebensabschnitt. Alte Menschen haben aber auch Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren. Und oft müssen sie schuften bis an ihr Ende. Wie altern wir? Wann in der Menschheitsgeschichte galten Männer und Frauen als alt? Und wie sieht die heutige Vorstellung vom Herbst des Lebens aus? Bereits in dem ältesten Werk der Welt, dem Gilgameschepos, geht es um das Alter: Der sumerische König Gilgamesch ist auf der Suche nach dem ewigen Leben und nimmt dafür viele Risiken auf sich. Im antiken Athen ist das Verhältnis zu alten Menschen und dem Altern besonders widersprüchlich. In der griechischen Komödie werden Greise öffentlich verspottet, da ihre unförmigen Körper nicht mehr dem Ideal ihrer Zeit entsprechen. In Sparta wiederum genießen alte Leute Ansehen und Einfluss, da Lebenserfahrung mit Weisheit verbunden wird. Die Römer hingegen ehren ihre Alten – zumindest die alten Männer. Cicero rühmt sie in seinem Werk „De senectute“, in dem es einzig um das Thema Alter geht. Die Frauen hingegen spüren den Druck, dem gängigen Ideal „ewiger Jugend“ zu entsprechen, und greifen verzweifelt zu Salben, die aus einem alten Menschen einen jungen machen sollen. Im Mittelalter ist die Welt der Frauen klar geregelt: Wer jung ist und wer alt, erkennt man schon allein an der Kleidung. Und für Ritter gilt: Wer die Waffe nicht mehr sicher führen kann, ist alt und verliert an gesellschaftlichem Ansehen. Doch es gibt in der Menschheitsgeschichte auch Ausnahmen – wie Ramses II. oder den Dogen Enrico Dandolo, der noch mit 95 Jahren ein Heer von Kreuzrittern anführte. Mit der Christianisierung kommt im Mittelalter der Caritas-Gedanke auf, der sich in einer Institution manifestiert: dem Hospital. Es bietet alten Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein sorgenfreies Dasein bis zum Tod. Meistens jedoch müssen Menschen bis zum letzten Tag ihres Lebens arbeiten – bis der Körper nicht mehr kann. Erst mit der Rentengesetzgebung im ausgehenden 19. Jahrhundert tritt der Staat als Fürsorger für die Alten in Erscheinung. Er löst die Familie als Versorger ab und garantiert den Ruhestand. „Das Uhrwerk des Lebens: Geschichte des Alters“ thematisiert Errungenschaften, die das Leben der Alten grundlegend verändert haben. Die Dokumentation berichtet von neuen Erkenntnissen der Forschung über den körperlichen Alterungsprozess. Dabei tragen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Interviews dazu bei, Perspektiven und Herausforderungen des Alterns aufzuzeigen und einen neuen Zugang zum Alter zu finden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 20.07.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 18.09.2022 ZDF Deutsche TV-Premiere ursprünglich angekündigt für den 31.07.2022Umbruch im Outback – Australiens Tierwelt
Ungelöste Fälle der Archäologie: 10. Pyramiden
45 Min.Pyramiden zählen zu den ältesten Bauwerken der Menschheit. Die geometrische Form findet sich in vielen Kulturen weltweit. Harald Lesch erkundet die Geheimnisse hinter den Monumentalbauten. Weder die meisten, noch die größten Pyramiden stehen in Ägypten. Allein in der peruanischen Region Lambayeque erheben sich 260 dieser ungewöhnlichen Bauten. Anders als in Ägypten dienten sie nicht ausschließlich als Gräber der Herrscher, sondern als Palasttempel. Im Westen von Kairo erhebt sich das einzige noch erhaltene Weltwunder der Antike, die Cheopspyramide.Sie und ihre etwas kleineren Nachbarn zählen zu den bekanntesten Bauwerken der Welt. Seit Jahrtausenden ziehen die monumentalen Grabbauten der Pharaonen die Menschen in ihren Bann. Aber die faszinierende geometrische Form ist kein ägyptisches Monopol. Auch der Kaiser im fernen China wählte sie für sein Grabmal – und baute dafür ganze Landschaften um. Pyramiden gibt es rund um die Welt. Von den Maya in Mittelamerika bis in den heutigen Iran. Angeblich soll es sogar in Bosnien 30.000 Jahre alte Pyramiden geben. Wieso findet sich diese Form fast überall – bei weit sowohl zeitlich als auch räumlich entfernten Kulturen, die nichts voneinander wissen konnten? Forschende weltweit fanden heraus, dass jede Kultur ihren eigenen Verwendungszweck für die Pyramide hatte – die Bandbreite reicht vom Grabmal zum Tempel, vom Multifunktionsbau zur Sternwarte bis hin zur blutigen Opferstätte. In Nord-Peru erheben sich die gigantischen „Goldpyramiden von Sican“. Aus Millionen von Lehmziegeln errichtet, war ihr Bau eine enorme Gemeinschaftsleistung, vergleichbar mit den Arbeiten an den Pyramiden am Nil. Archäologen gehen davon aus, dass die Lehmziegel-Megabauten nicht nur für religiöse Zeremonien und als Grabstätte der Herrscher dienten. In der Blütezeit der Kultur nutzen die Herrschaftseliten die Pyramiden als repräsentative Wohngebäude. Und in Krisenzeiten waren sie wohl auch Schauplatz von Menschenopfern. Der erste Kaiser von China, Qin, ließ eine riesige Landschaft zu seiner Grabpyramide umformen. Chinesische Archäologen haben sie bisher nur zum Teil ausgegraben, denn angeblich droht im Inneren eine tödliche Gefahr. Flüsse aus Quecksilber sollen das Innere der Pyramide schützen, so steht es in alten Berichten. Und tatsächlich haben Forscher eine erhöhte Quecksilberkonzentration im Umfeld der Grabpyramide gemessen. Berühmt wurde das Grab bereits vor Jahrzehnten durch die Entdeckung der Terrakotta Armee. Sie ist eine den wenigen ausgegrabenen Grabbeigaben auf dem riesigen Areal von 56 Quadratkilometern rund um die Pyramide. Welche unermesslichen Schätze mögen Kaiser Qin mit ins Grab gegeben worden sein und dort noch unberührt schlummern? In Mexiko und Guatemala bescheren neue Technologien den Maya-Forschern sensationelle Entdeckungen. Mit dem LiDAR-Scan Verfahren lässt sich der Dschungel digital entlauben und zeigt, was der Boden unter dem Blätterdach verbirgt. Zigtausende bisher unbekannte Bauwerke, darunter etliche Pyramiden, wurden so enthüllt und geben Hinweise darauf, warum das große Maya Reich kollabierte. In Bosnien stehen die zurzeit wohl umstrittensten „Pyramiden“. Geologen sehen in einem pyramidenförmigen Berg nur eine Laune der Natur, andere ein 30.000 Jahre altes Bauwerk. Für viele Esoteriker ist die Bosnische Sonnenpyramide mittlerweile zu einem Pilgerort geworden. Sie sind davon überzeugt, dass an dem Berg kosmische Energien wirken. Harald Lesch sortiert die Argumente, die für oder gegen ein uraltes Bauwerk sprechen. Diese und weitere rätselhafte Bauten stellt Harald Lesch in der neuen Folge „Terra X – Ungelöste Fälle der Archäologie: Pyramiden“ vor. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 11.10.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 15.10.2023 ZDF Ungelöste Fälle der Archäologie: 11. Geheimnisvolle Kugeln
45 Min.Kugeln sind allgegenwärtig. Sie finden sich in Kulturen weltweit. Harald Lesch erkundet die unterschiedlichen Funktionen der wahrscheinlich weit verbreitetsten geometrischen Form. Überall finden sich kreisrunde Gebilde, die für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt werden. Die Bandbreite reicht dabei vom Geschoss, über den Ball bis hin zum wahrscheinlich ältesten Kugellager der Welt. Kugeln sind aus unserer Welt nicht wegzudenken. Schon unsere Ur-Ur-Ur-Ahnen waren von der Form fasziniert, wie Ausgrabungen auf verschiedenen Kontinenten zeigen. So fanden Archäologen etwa in Israel und Spanien bearbeitete Steinkugeln, deren Alter sie auf 1,3 Millionen Jahre schätzen.Sehr viel jünger sind die Kautschukbälle, mit denen in Mesoamerika seit dem 15. Jahrhundert vor Christus anscheinend auch um Leben und Tod gespielt wurde. Mehr als 1500 Ballspielplätze, die zum Teil auch in Tempelbezirken der Maya auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko liegen, hat man bisher dort gefunden, und wahrscheinlich existieren noch viele weitere, bisher unentdeckte im Urwald Mittelamerikas. Bis heute spielen die Nachfahren der indigenen mesoamerikanischen Kulturen Ulama oder Pok-ta-Pok, bei dem ein Ball nur mit Hüfte und Schultern durch kreisrunde Öffnungen geschossen werden muss. Bei den bisher gefundenen Ballspielplätzen befindet sich jeweils ein steinerner Ring an den Seitenmauern des Spielfeldes. Die Größe des Platzes, sowie die Form der Seitenmauern, wie auch die Höhe der Anbringung der steinernen Ringe können variieren. Reliefs an den Mauern legen nahe, dass auf einigen Plätzen auch Menschenopfer dargebracht wurden. Weniger tödlich, aber nicht weniger feierlich ging es wohl auf dem Nemisee zur Zeit des römischen Kaisers Caligula im ersten Jahrhundert nach Christus zu. Mithilfe des wohl ältesten bekannten Kugellagers, ließ der Imperator wahrscheinlich eine Statue der Göttin Diana „tanzen“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 22.02.2026 ZDF Ungelöste Fälle der Archäologie: 12. Magische Zeichen
45 Min.Schrift ist eine der genialsten Erfindungen der Menschheit. Durch sie lebt die Vergangenheit fort. Harald Lesch begibt sich auf die Spur geheimnisvoller Schriften weltweit. Schrift wurde an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten immer wieder neu erfunden. Um sie entziffern zu können, muss man mehr über die Sprache und Kultur der Menschen wissen, die sie erfanden. Manche Schriften gelten bis auf weiteres als unentzifferbar. Bei der Entstehung von Schrift stehen am Anfang oft einzelne Zeichen, die sich erst im Laufe der Zeit zu komplexen Systemen entwickeln.Einige Zeichen sind eigentlich Bilder des Dargestellten, andere stehen für Silben oder einzelne Laute. Und selbst wenn man die Schrift lesen kann, heißt das noch lange nicht, dass man sie auch versteht. So etwa bei der Linear-A-Schrift aus Kreta. Sie wurde von den Minoern entwickelt, der ersten Hochkultur in Europa. Anhand von Parallelen in einer späteren Schrift konnten Wissenschaftler den Zeichen Laute zuordnen. Es fehlt ihnen aber die Kenntnis der zugrunde liegenden Sprache. Deshalb konnten die Zeichen ihre magische Fähigkeit, das in ihnen gespeicherte Wissen zu vermitteln, noch nicht ausüben. Anders beim Rongorongo, der Schrift der Rapa Nui auf Rapa Nui (Osterinsel). Linguisten sind davon überzeugt, dass die zugrunde liegende Sprache nur die der Einwohner der Osterinsel sein kann, die diese bis heute sprechen, wenn auch in einer späteren Sprachstufe. Und dennoch haben die 600 bekannten Schriftzeichen ihr Geheimnis noch nicht preisgegeben. Nur so viel scheint sicher, dass die auf Holztafeln überlieferten Texte sehr wahrscheinlich in einer Art Wechselgesang vorgetragen wurden. Sie könnten wichtige Hinweise zur Kultur der Rapa Nui und ihrer geheimnisvollen Moai-Skulpturen enthalten. Mehr Erfolg hatte ein Team von Wissenschaftlern um die Sprachwissenschaftlerin Svenja Bonmann. Ihnen gelang der Durchbruch bei der Entzifferung der Kuschana-Schrift, einer Schrift und Sprache, die wohl nur von einer kleinen Minderheit in dem ehemaligen zentralasiatischen Großreich gesprochen wurde. Zuhilfe kam ihnen dabei eine sogenannten Bilingue, die auf einem Felsen in Tadschikistan in 3000 Meter Höhe eingemeißelt wurde. Hier wurde derselbe Text einmal in Baktrisch und einmal in Kuschana aufgeschrieben. Der Vergleich mit der lesbaren baktrischen Inschrift erlaubte es den Forschern anhand von Wortwiederholungen auch Zeichen und Wörter in der Kuschana-Inschrift zu identifizieren. So wie sie haben es sich Wissenschaftler weltweit zur Aufgabe gemacht, noch unbekannte Schriften zu entziffern und damit Türen in die Vergangenheit aufzustoßen, die bislang verschlossen blieben. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 01.03.2026 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail