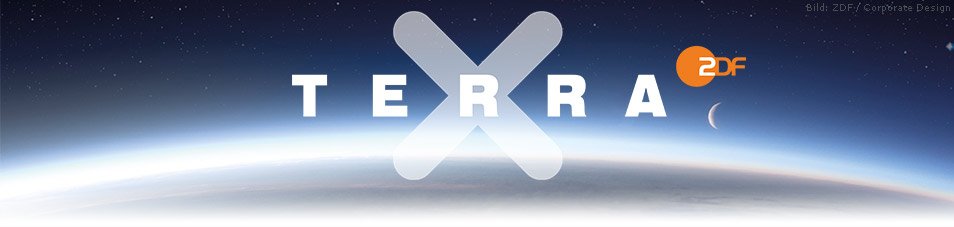1524 Folgen erfasst (Seite 18)
Faszination Universum: 02. Die ganz andere Welt
45 Min.Es gibt eigentlich keinen Zweifel daran, dass der Raum und die Zeit unverrückbar sind und von jedem gleich erlebt werden. Aber, die modernen Naturwissen-schaften zeigen wieder einmal einen überraschenden Aspekt der Welt, in der wir leben. In Flugzeugen, Raumstationen und Satelliten vergehen die Zeiten unterschiedlich schnell und das müssen die Techniker bei ihren Entwicklungen zum Beispiel dem GPS-System – berücksichtigen. Wir können auch die Zeit für uns schneller oder langsamer laufen lassen, so dass wir anders als gewohnt altern. Wie dieser Trick funktioniert, zeigt Joachim Bublath in dieser Folge der Sendereihe „Faszination Universum“.Eine spannende Frage ist zudem, wie jeder einzelne von uns die Zeit erlebt und wie unser Gehirn ein Gefühl für den Ablauf der Zeit erzeugt. Dabei kommt es zu skurrilen Situationen, die jeder von uns schon erfahren hat. Zum Beispiel glaubt man, in bestimmten Situationen etwas schon erlebt zu haben, das gerade erst jetzt passiert. Oder man täuscht sich – je nach Umgebung – in der Schnelligkeit, mit der die Zeit abläuft. Woran das liegt, wird in dieser Folge mit erstaunlichen Experimenten erklärt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 30.11.2003 ZDF Faszination Universum: 03. Der Tod der Sterne
45 Min.Nichts im Universum ist ewig. Der Blick in den ruhigen Nachthimmel täuscht uns über die wahren Abläufe in der Tiefe des Weltalls hinweg. Auf einer Reise durch das Universum begegnen uns explodierende Sterne, „weiße Zwerge“ als Überreste von „roten Riesen“, quirlende Plasmaströme eine Fahrt, wie in einer kosmischen Geisterbahn. Zudem dehnt sich das Universum immer weiter aus, und wir können dadurch immer tiefer in seine Entwicklungsgeschichte blicken. Warum das alles so ist und welche Überraschungen sich überall im Universum finden, zeigt Joachim Bublath in dieser Folge auf seiner spannenden Reise durch Raum und Zeit. „Der Tod der Sterne“ betrifft uns auf der Erde in besonderer Weise, denn auch die Sonne ist ja nur ein Stern und von diesem gleißenden Gasball können wir viel über den Lebenszyklus der anderen für uns unerreichbaren Sterne lernen.Unsere Milchstraße wird so die deprimierenden Voraussagen der Astronomen letztendlich alleine im Universum sein, umgeben von der Einsamkeit des dunklen Weltalls. Einsam zieht diese Galaxie dann ihre Bahn durch das kalte Nichts. Dunkle Energien und dunkle Materie verändern das Schicksal des Universums auf dramatische Weise. Wie aufregend diese Geschichte unseres Seins ist, das demonstriert Joachim Bublath in dieser Folge der Reihe „Faszination Universum“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 07.12.2003 ZDF Faszination Universum: 04. Das riskante Leben
45 Min.Die Bedrohung durch Asteroiden ist so lange für das bloße Auge unsichtbar bis es zu spät ist. Sie sind eine ständige Gefahr für unseren Planeten und könnten jederzeit das Leben auf der Erde auslöschen. In der Geschichte unseres Planetensystems wäre ein solches Ereignis jedoch nur eine kleine unbedeutende Episode. Denn die Planeten selbst sind aus der Asche eines explodierenden Sterns entstanden. Inmitten Milliarden von Gesteinsbrocken bildeten sich über Jahrmillionen die einzelnen Planeten, ständig den Einschlägen von Asteroiden ausgesetzt. Heute scheint der Raum in unserem System weitgehend staub- und gesteinsfrei zu sein, doch der Eindruck ist trügerisch. Zwischen Mars und Jupiter hat sich ein Ring aus Materiebrocken gebildet. Dort könnte sich jederzeit ein gewaltiger Felsen lösen und auf Kollisionskurs mit der Erde gehen. Weiter entfernt existieren Gürtel aus Gesteins- und Eisbrocken, die für unsere Erde noch gefährlich werden könnten.Doch der Mensch fügt sich nicht einfach diesem Schicksal. Erstmalig in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten beginnen Versuche, sich einer solchen Bedrohung zu erwehren. Forscher arbeiten fieberhaft an einer Abwehrstrategie. Der erste Schritt ist, diese gefährlichen Brocken im All überhaupt aufzuspüren. Dann müssen Techniken zur Verfügung stehen, die für uns gefährlichen Asteroiden zu zerstören oder von ihrem Weg zur Erde abzubringen. Experimente zeigen, dass man sie nicht einfach mit Raketen pulverisieren kann. Intelligente Konzepte gehen auf die komplizierten Zusammenhänge im Asteroidengürtel ein und in Zukunft könnte sogar die Kraft der Sonne als Waffe gegen Asteroiden eingesetzt werden. Heute wären die Menschen allerdings der Gefahr eines Asteroideneinschlags hilflos ausgeliefert. Aber das Wettrennen mit der Bedrohung aus dem All ist in vollem Gang. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 28.11.2004 ZDF Faszination Universum: 05. Katastrophen als Hoffnung
45 Min.Angesichts der gewaltigen Ausdehnung des Universums erscheint unsere Erde darin nur als ein unbedeutendes Staubkorn. Selbst in unserem Sonnensystem ist sie nur ein Planet unter vielen. Immer größer wird das Interesse an unseren nächsten Nachbarn im Sonnensystem. Die Eigenarten der verschiedenen Planeten wie Saturn, Mars und Jupiter lassen auch unsere Erde in einem völlig neuen Licht erscheinen. Eine spannende Frage ist, wie diese Insel des Lebens inmitten einer feindlichen Umwelt überhaupt entstehen konnte. Im Vergleich zu den anderen Planeten taucht die wilde Ursprungszeit der Erde wieder aus dem Dunklen der Vergangenheit auf. Katastrophen waren damals an der Tagesordnung: Asteroideneinschläge und Vulkanausbrüche wechselten einander ab und machten die Erde zu einem lebensfeindlichen Planeten. Bis heute scheint es fast unvorstellbar, dass in einer solchen Umgebung überhaupt Leben entstehen konnte.Joachim Bublath führt die Zuschauer in diese bewegte Zeit und untersucht die neuesten Theorien und Überlegungen zu der Frage, wie das Leben auf der Erde Fuß fassen konnte. Kam der Urkeim möglicherweise sogar aus dem All? Spektakuläre Funde von Meteoriten aus der Urzeit scheinen solche Theorien zu stützen, denn dort finden sich Spuren, die auch von außerirdischem Leben stammen könnten. Sicher ist nur, dass sich Leben auf der Erde entwickelt hat und trotz aller Katastrophen und Desaster bis heute überdauern konnte. Forscher meinen sogar, dass die Katastrophen wichtig für die Entwicklung des Lebens waren. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Massensterben von Tieren und Pflanzen, die durch globale Katastrophen ausgelöst wurden. Die Dinosaurier waren ihre prominentesten Opfer. Aber jedem Ende wohnt auch ein Neuanfang inne. Das Verschwinden einiger Arten schafft Platz für die Entwicklung ganz neuer Lebensformen. Und die Überraschung ist, dass auch die Dinosaurier ihrerseits nie entstanden wären, wenn nicht zuvor die größte Katastrophe der Erdgeschichte nahezu sämtliches Leben auf der Erde ausgelöscht hätte. Eindrucksvolle Computeranimationen zeigen, wie diese weitgehend unbekannte Katastrophe das Leben auf der Erde erschütterte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 05.12.2004 ZDF Faszination Universum: 06. Das wilde Universum
45 Min.Seit seiner Entstehung ändert sich das Antlitz des Universums ständig. In dieser Folge reist der Zuschauer bis zu den Anfängen der wilden Geschichte des Weltalls. Mit einem großen Knall soll alles begonnen haben und die Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen. Auf der Suche nach Erkenntnissen über den Weltraum entdeckten Forscher wie neue Galaxien entstehen können. Sterne sterben und werden geboren. Gefräßige schwarze Löcher verschlingen alles um sich herum und Sonnen explodieren. Vor allem die Theorien von Einstein haben unsere Vorstellung über das frühe Universum entscheidend verändert. Wie wäre es sonst vorstellbar, dass Materie aus dem Nichts entstehen kann oder der Raum durch Materie verändert wird? Joachim Bublath gibt in verblüffenden Experimenten einige Kostproben aus Einsteins Welt.Angesichts der überwältigenden Kräfte, die im Universum wirken, stellt sich die Frage, wie sicher wir hier auf der Erde sind. Was würde passieren, wenn die Erde in den Mahlsturm der kosmischen Kräfte gezogen wird? Wie kann die Menschheit dieser Katastrophe entgehen? In atemberaubenden Bildern wird gezeigt, wie ein Exodus der Menschen aussehen könnte, falls das Leben auf der Erde nicht mehr möglich sein sollte. Wie realistisch sind solche Szenarien? Gibt es eine Chance, auf anderen Planeten zu existieren? Mit der fortschreitenden Erforschung des Mars sind solche Spekulationen immer weiter genährt worden. Doch die Verwirklichung einer Marskolonie scheint auch in ferner Zukunft eher Wunsch als Wirklichkeit zu bleiben. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 12.12.2004 ZDF Faszination Universum: 07. Tödliche Begegnung
45 Min.Mag manchmal der Eindruck entstehen, dass die Erde ziemlich einsam durch das Universum schwebt, steht dennoch fest, dass sie vom übrigen Geschehen im Weltall keineswegs abgekoppelt ist. Und so kann es hin und wieder passieren, dass ein Gesteinsbrocken sich lautlos nähert und auf die Erde trifft – mit katastrophalen Folgen. Wie groß die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis ist, kann keiner sagen. Doch in der Vergangenheit hat es in einigen Fällen einen solchen Asteroiden-Einschlag auf der Erde gegeben.Heute scheint die nähere Umgebung der Erde weitgehend staub- und gesteinsfrei zu sein, doch der Eindruck ist trügerisch. Zwischen Mars und Jupiter hat sich ein Ring aus Materiebrocken gebildet. Dort könnte sich jederzeit ein gewaltiger Felsen lösen und auf Kollisionskurs mit der Erde gehen. Weiter entfernt existieren Gürtel aus Gesteins- und Eisbrocken, die ebenfalls für die Erde noch gefährlich werden könnten. Zudem besteht das Problem, dass ein Asteroid, der sich der Erde nähert, erst dann entdeckt werden kann, wenn es schon zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen. Die nächste wichtige Frage ist, wie man überhaupt einen solchen Asteroiden abwehren könnte. Ende November dieses Jahres erfolgt dazu ein wichtiger Schritt: Die japanische Raumsonde Hayabusa trifft nach einer zweieinhalbjährigen Flugreise auf einen Asteroiden, wird ihm etwas Materie entreißen und dann diese Proben zur Erde zurückbringen. Die Forscher erhoffen sich dadurch Aufschluss zu erhalten über die Zusammensetzung der Asteroiden – eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Abwehrmethoden gegen die tödlichen Geschosse aus dem All. Die Europäer planen zudem zur Zeit die Mission „Don Quijote“, die zum Ziel hat, Asteroiden aus ihrer gefährlichen Bahn auf die Erde abzulenken. Erste Erfolge mit einer direkten Begegnung eines solchen Vagabunden des Weltalls hatte man vor kurzem mit der Raumsonde „Temple 1“ und einem Kometen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 27.11.2005 ZDF Faszination Universum: 08. Exotische Welten
45 Min.Wie ist das Universum überhaupt entstanden? Naturwissenschaftler meinen, dass sich alles letztendlich aus einem „Nichts“ aufgebläht hat. Eine Vorstellung, die nicht unbedingt mit den täglichen Erfahrungen zu vereinbaren ist. Denn das hieße ja, dass Materie aus dem Nichts entstehen könnte. Joachim Bublath zeigt im Studio, wie so etwas wirklich geschehen kann. Dieser Trick ist ein wichtiger Bestandteil der Einsteinschen Relativitätstheorie, deren 100-jähriger Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Doch nicht nur im Universum kann sich Materie auf ungewöhnliche Weise bilden, auch auf der Erde ist dies möglich – die Umkehrung allerdings auch: Materie kann man auch wieder verschwinden lassen. Riesige Energiemengen werden dabei frei, die ausreichen, Berge zu versetzen.Joachim Bublath unternimmt noch weitere Versuche, um auch andere verblüffende Folgerungen aus Einsteins Relativitätstheorie dem Zuschauer näher zu bringen. Um dem Motto: „Jeder spricht von Einstein, aber kaum einer versteht ihn“ zu begegnen, werden in spektakulären Studioexperimenten die Grundpfeiler der Relativitätstheorie plausibel gemacht. Interessant ist, welche Konsequenzen das alles hat: Der Mensch sieht das Universum nicht so, wie es eigentlich ist – die Zeit verläuft je nach Aufenthaltsort unterschiedlich und der Raum krümmt sich. Mit diesem Wissen taucht der Zuschauer ein in eine völlig verrückte Welt, in der plötzlich alles ungewohnt und skurril erscheint. Die Folge „Exotische Welten“ eröffnet dem Zuschauer die Möglichkeit, seiner Fantasie auf naturwissenschaftlich gesicherten Bahnen freien Lauf zu lassen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 04.12.2005 ZDF Faszination Universum: 09. Das Ende der Zeit
45 Min.Einstein ist in aller Munde, aber wer versteht wirklich etwas von seinen Relativitätstheorien, die in diesem Jahr ihren 100-jährigen Geburtstag feiern? Joachim Bublath versucht, in dieser Folge die wichtigsten Folgerungen daraus verständlich zu machen. So gibt es eigentlich keinen Zweifel daran, dass der Raum und die Zeit unverrückbar sind und von jedem gleich erlebt werden. Doch die modernen Naturwissenschaften können das widerlegen. Sie zeigen einen überraschenden Aspekt der Welt, in der wir leben. So ist es durchaus möglich, dass jemand schwören könnte, zwei Raketen gleichzeitig starten zu sehen, während ein anderer behauptet, den Start als hintereinander erfolgend beobachtet zu haben. Beide haben Recht – und damit wird das Geschehen in unserer Umwelt äußerst verwirrend. Die Zeit scheint je nach Situation unterschiedlich abzulaufen. Das ist nicht etwa nur eine leicht aufzulösende Täuschung, sondern Realität im Universum.Zudem ist die neue Erkenntnis: In Flugzeugen, Raumstationen und Satelliten vergehen die Zeiten unterschiedlich schnell. Das müssen die Techniker bei ihren Entwicklungen, zum Beispiel dem GPS-System, berücksichtigen. Möglich ist es auch, die Zeit für uns Menschen schneller oder langsamer laufen zu lassen, so dass wir anders als gewohnt altern. Wie dieser Trick funktioniert, zeigt Joachim Bublath in der Folge „Das Ende der Zeit“ mit spektakulären Studioexperimenten. Auch der Raum bleibt nicht unveränderlich. Längen können sich verkürzen und zwei Beobachter zu völlig unterschiedlichen Messungen kommen – ganz objektiv selbstverständlich. Wir Menschen müssen plötzlich erkennen, dass uns das Universum eine bizarre Lebensumgebung bietet, in der seltsame Dinge geschehen: Gegenstände werden kürzer, die Zeit vergeht plötzlich schneller oder langsamer. Wo liegen die Ursachen dafür? Sind diese Erschütterungen in unserem Weltbild auf mystische Abläufe zurückzuführen oder gibt es dafür Erklärungen innerhalb der Naturwissenschaften? Die dritte Folge von „Faszination Universum“ geht solchen Rätseln des Universums nach. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 11.12.2005 ZDF Faszination Universum: 10. Im Bann des Sonnenfeuers
45 Min.Harald Lesch widmet den Auftakt der ZDF-Sendereihe „Faszination Universum“ unserer Sonne. Im Mittelpunkt der Sendung „Im Bann des Sonnenfeuers“ steht unser Muttergestirn. Denn um die Sonne kreisen nicht nur alle Planeten, auch viele Kulturen haben in ihrer Mythologie der Sonne eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. So fanden schon in der Steinzeit Erkenntnis und Glaube, Ängste und Hoffnung in der Sonne ihren Fluchtpunkt.Eines der größten Rätsel der Frühgeschichte der Menschheit ist Stonehenge. Die Ausrichtung der kreisförmigen Anlage lässt einen Bezug auf die Sonne erkennen. Dank neuester Ausgrabungen und eines geheimnisvollen Skelettfundes wurden große Teile der Geschichte Stonehenges in den letzten Jahren neu geschrieben. Hinweise für die zentrale Bedeutung der Sonne für diese frühgeschichtlichen Kulturen kommen auch aus der Mitte Deutschlands: In Sachsen-Anhalt haben die Menschen schon 2000 Jahre vor Stonehenge die Sonne beobachtet; sie kannten den für Ackerbauern wichtigen Zeitpunkt der Wintersonnwende bis auf wenige Tage genau. Dass hier die Grundlagen für Stonehenge geschaffen wurden, erscheint mittlerweile vielen Archäologen als wahrscheinlich und lässt die Leistung der Menschen damals in neuem Licht erscheinen. „Im Bann des Sonnenfeuers“ forschten auch große Geister der Geschichte: Kopernikus, Kepler und Galilei wagten das Undenkbare und rückten die Sonne in den Mittelpunkt des bekannten Universums; die Erde war nur ein Planet neben anderen, der um das Muttergestirn kreist. Eine wissenschaftliche Revolution, die über Isaak Newton bis zu Albert Einstein reicht. Die Sonne ist nicht nur Mittelpunkt unseres Sonnensystems, ihre Masse bestimmt auch die Bahnen der Planeten. Die Sendung zeigt, wie die Beobachtung der Erscheinungen am Himmel Weltbilder zum Einsturz brachte. Bis heute gibt uns unser Sonnensystem – trotz aller Exakt-heit der Messungen und allen Fortschritts in der Technik – bis heute Rätsel auf. Das „Sonnenfeuer“, die Energie der Sonne auf die Erde zu bringen, ist das Ziel von Forschung. Die Kernfusion, das Prinzip nach dem die Sonne strahlt, wurde in der Wasserstoffbombe schon Wirklichkeit. In Zukunft jedoch soll die kontrollierte Fusion alle Energieprobleme lösen. Wo steht die Wissenschaft? Sind die Hoffnungen berechtigt? Die Sonnenforschung hat in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Nicht nur Raumsonden beobachten jede Regung unseres Muttergestirns. Auch auf der Erde ist man mit aufwändigen Teilchendetektoren dem Geheimnis des Sonneninneren auf die Spur gekommen. Die Erkenntnis dabei ist: Unser Stern, die Sonne, ist in ihrer Größe und Strahlkraft eher durchschnittlich. Doch genau in dieser Durchschnittlichkeit liegt das Besondere; denn nur so wurde Leben in diesem Winkel des Universums überhaupt erst möglich. Ein Blick auf unsere Nachbarplaneten Venus und Mars zeigt, wie schnell der Stern des Lebens sich zum Todesstern wandeln kann. So geht Harald Lesch auch der Frage nach, wie die Sonne unser Klima beeinflusst und welche Rolle sie bei der Entstehung des Lebens spielte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 03.05.2009 ZDF Faszination Universum: 11. Die Macht der Sterne
45 Min.Seit Urzeiten erforschen die Menschen den Himmel, beobachten die Sterne und sind fasziniert davon, mehr über das herauszufinden, was uns im Universum umgibt.Schon in der Steinzeit zog der nächtliche Himmel die Menschen in seinen Bann. In den weltbekannten Höhlen von Lascaux machten Forscher eine erstaunliche Entdeckung. Sie erkannten zwischen den Tierdarstellungen deutlich sechs dunkle Punkte und sahen in ihnen das Sternbild der Plejaden. Mit einem Alter von 17 000 Jahren wäre das eine der ältesten Sternskizzen überhaupt. Was wussten die Menschen damals von den Himmelsgestirnen? Welche Bedeutung wurde den Sternbildern beigemessen? Und: Wie konnten sie die Bilder in die Höhlen über-tragen? Die regelmäßigen Bewegungen der Sterne zu entschlüsseln war das Bestreben vieler früher Kulturen. So bekommt der Stern Sirius bei den Ägyptern eine zentrale Bedeutung: Denn in jedem Frühling herrscht Dürre, und das Erscheinen des Sirius am Sternenhimmel kündet die rettende Nilflut an. Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang? Was wussten die Ägypter von den regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheinungen? Auch in China haben Astronomen schon vor mehr als tausend Jahren den Himmel studiert. Entdeckten sie einen Kometen oder einen Blitz, mussten sie die Erscheinung vor dem Kaiser interpretieren. So gehörten seit Tausenden von Jahren in China Astronomie und Astrologie eng zusammen. Was lässt sich tatsächlich aus den Sternen lesen? Große Entdecker, Seeleute, ließen sich durch die Sterne leiten. Vor 1000 Jahren schon wiesen sie ihnen den Weg über das Meer. England, Spanien und Portugal hüteten Baupläne von Schiffen und Navigationsregeln wie Staatsgeheimnisse. Auf der anderen Seite des Globus verstand man sich aufs Navigieren nach den Sternen schon 500 Jahre früher. Die Polynesier waren geniale Seefahrer. Sie brauchten keinen ohne Kompass oder besondere Aufzeichnungen. Sie segelten mit einer Sternkarte im Kopf. Eine Leistung, die heute noch staunen macht. Und was verraten uns die Sterne über die Zukunft? Aus den Himmelsbeobachtungen lässt sich zumindest etwas über die künftige Entwicklung des Universums lesen. Harald Lesch begibt sich dazu auf die Reise zum Ursprung der Sterne. Er erzählt die Geschichte ihres Entstehens und ihres Vergehens. Der Blick in den Sternenhimmel ist ein Blick in die ferne Vergangenheit. Immer wieder werden neue Techniken entwickelt, um noch tiefer ins All zu schauen und die Vorgänge dort draußen besser zu verstehen. Da gibt es kleine weiße Zwerge, schnell rotierende Neutronensterne und alles in sich hineinziehenden Schwarze Löcher. Am Ende ihres Lebens geben große Sterne in gewaltigen Supernovaexplosionen die in ihnen erzeugten Elemente ans Universum zurück. So sind die Sterne die Quellen des großen Materiekreislaufs der gesamten Galaxis. Letztlich ist somit Sternenstaub der Ursprung aller Materie. Mit dem größten Experiment der Welt, mit dem „Large Hadron Collider“ (LHC) in CERN wollen Forscher das letzte Rätsel des Aufbaus der Materie lösen. Die Wissenschaftler haben eine Modellvorstellung davon. Doch der letzte Nachweis, dass sie auch zutrifft, fehlt noch. Es fehlt der Nachweis für das so genannte Higgs-Teilchen. Wann er gelingen wird, „steht in den Sternen“. Für moderne Entdecker sind inzwischen die Sterne selbst Ziel ihrer Erkundungen. Eine Frage strahlt besondere Faszination aus: Sind wir allein im Universum? Ist das Erfolgsgespann Erde-Sonne einmalig oder gibt es Orte im Universum mit ähnlich paradiesischen Bedingungen für Leben? Welche Bedingungen müssten gegeben sein, und wie lassen sie sich im All finden? Harald Lesch ist in der Sendereihe „Faszination Universum“ diesen Fragen auf der Spur. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 10.05.2009 ZDF Faszination Universum: 12. Zeit – Reise in die vierte Dimension
45 Min.„Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es aber einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht!“ So sprach der berühmte Philosoph und Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert – und meinte das Mysterium der Zeit. Mehr als anderthalb Jahrtausende später wissen die Forscher und Philosophen kaum Erhellenderes zu berichten. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Do. 13.05.2010 ZDF Faszination Universum: 13. Urkräfte – Vorstoß zu den Elementen der Schöpfung
45 Min.Woraus besteht die Welt? Über diese hochaktuelle Frage zerbrachen sich schon die Denker der griechischen Antike ihre Köpfe. Dabei entwickelten sie ein klares Konzept: Erde, Feuer, Wasser und Luft – aus jenen vier Elementen sollten sich alles Irdische und selbst die Gestirne formen. Eine Vorstellung, die bis heute wirkt: Von der Urgewalt der Elemente spricht man, wenn Stürme toben, reißende Ströme über die Ufer treten und Feuersbrünste wüten. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 16.05.2010 ZDF Faszination Universum: 14. Das Maß aller Dinge
45 Min.Harald Lesch begibt sich auf die Spuren von Menschen, die es genau wissen wollen. Dabei begegnet er revolutionären Umwälzungen und dramatischen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, die zu lebensgefährlichen Expeditionen führen. Er verfolgt die Geschichten derer, die den Himmel und die Erde vermessen wollten, die die Sterne kartierten und die Weiten der Ozeane erkundeten. Beim Ausloten der Grenzen stellt sich die Frage: Wie genau ist eigentlich genau? Weshalb muss man alles so exakt wissen und messen? Wo ist unser Platz im Universum? Und: Was ist das Maß aller Dinge? (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 12.06.2011 ZDF Faszination Universum: 15. Die Zähmung des ewigen Feuers
45 Min.Das Feuer der Sonne, die Quelle der Energie, von der alles auf der Erde lebt, erscheint uns ewig. Die Erde ist dieser Macht ausgeliefert und hängt gleichzeitig von ihr ab. Doch: Was ist überhaupt Energie? Und wie ist diese janusköpfige Kraft in den Griff zu bekommen? Harald Lesch begibt sich auf Entdeckungsreise ins Universum. Er nimmt die Zuschauer von der Erde aus mit zu strahlenden Sternen bis in die dunkelsten Ecken des Universums. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Mo. 13.06.2011 ZDF Faszination Universum: 16. Das Phantom der Wirklichkeit
45 Min.Auf der Erde gibt es nichts mehr neu zu entdecken, so scheint es. Auf jeden Flecken haben Abenteurer und Entdecker schon ihren Fuß gesetzt, alles vermessen und kartiert. Blicken wir jedoch in die großen Dimensionen, ins Universum, oder in die kleinsten Dimensionen, in den Mikrokosmos, so ist noch überraschend viel ungeklärt. Und selbst manche Alltagserscheinung lässt Forscher seit Jahrtausenden rätseln. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 30.09.2012 ZDF Faszination Universum: 17. Die Entdeckung der Zukunft
45 Min.Vor 2000 Jahren bedeutete Zukunft: Ein Krieg wird gewonnen, ein Herrscher stirbt, ein Reich zerfällt. Der Rest war ewig: Berge, Tiere, das Meer, die Sterne. Heute trauen wir uns dagegen erstaunliche Aussagen: In 50 000 Jahren kommt eine neue Eiszeit. Doppelt so lang, und kein Sternbild wird am Himmel wiederzuerkennen sein. In 100 Millionen Jahren müssen wir Brehms Tierleben weitgehend neu schreiben. In 2,3 Milliarden Jahren erkaltet der Erdkern – es wird keine Vulkanausbrüche mehr geben. In 5,4 Milliarden Jahren herrscht Abendrot den ganzen Tag, die Sonne bläht sich zum roten Riesen auf. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 07.10.2012 ZDF Faszination Universum: 18. Das Rätsel der Harmonie
45 Min.Überall in der Natur treffen wir auf rätselhafte, geradezu unheimliche Strukturen: Säulen, die wie gemeißelte Sechsecke in die Höhe ragen. Riesige Dünen, wie mit dem Kamm gezogen. Perfekte Kristalle, so groß wie ein Mehrfamilienhaus. Selbst am Himmel scheint ein unsichtbares Räderwerk für ewige Ordnung zu sorgen. Was bedeutet diese erstaunliche Harmonie im Universum? Strebt die Natur nach Vollkommenheit? Gibt es eine Erklärung? Regelmäßige Sechsecke finden sich in überraschender Vielfalt in der Natur. Die unterschiedlichsten Kristalle, sogar Schneeflocken, scheinen diese Form zu bevorzugen.Bienen bauen ihre Waben nicht etwa röhrenförmig, sondern sechseckig – aus gutem Grund. Auf unterschiedlichen Kontinenten findet man sechseckige Basaltsäulen, beispielsweise an Irlands Küste. Hier wollte ein Riese einen Damm nach Schottland bauen, so die Legende. Kleinste Objekte fügen sich zu überraschenden Strukturen und Formen: Der Sand in der Namibwüste formt gleichmäßige Sicheldünen – ganz so, als wüsste jedes Körnchen genau, wo es hingehört. Natürlich ist der Wind die gestaltende Kraft, aber warum verteilt er den Sand nicht gleichmäßig in der Ebene? Auch auf dem Mars haben Sonden inzwischen Bilder von faszinierenden Dünenlandschaften geliefert. Wie ist das möglich in einer Atmosphäre, 150 Mal dünner als die der Erde? Und dort entstehen sogar noch viel höhere Dünen, die regelmäßig aufgeschichtet faszinierende Landschaften bilden. Schon Urvölker haben das Rätsel der Harmonie studiert und auf ihre Weise gelöst: Sternzeichen, die zu bestimmten Jahreszeiten immer wieder auftauchen, wurden in den Kosmos der Legenden integriert. So sahen zum Beispiel die Blackfoot-Indianer Nordamerikas in den Plejaden sechs Waisenkinder, denen man einst wärmende Büffelfelle verwehrt hatte. Nun nahmen die Kinder jedes Jahr die Büffel mit sich, wenn sie unter dem Horizont verschwanden. Ein Mythos mit einer entscheidenden Bedeutung für die aufwändige Treibjagd, bevor es auf dem Kontinent Pferde und Gewehre gab. Zu Beginn der Neuzeit verlieren in Europa die Sagen hinter den Sternzeichen an Bedeutung. Der Himmel gilt als ewig und unveränderlich. Doch 1572 entdeckt der dänische Astronom Tycho Brahe einen neuen, hellen Stern. Das Ende der himmlischen Harmonie? Was damals das Bild vom Himmel revolutionierte, war jedoch nicht die Geburt, sondern der Untergang eines Sterns. Sein Ende bedeutet gleichzeitig einen neuen Anfang: ein Kreislauf, in dem neue Materie entsteht, der neue Sterne und Planeten hervorbringt. Die Harmonie, die uns beim Blick in die Natur staunen lässt, findet sich aber auch in uns selbst. Als der griechische Mathematiker und Philosoph Pythagoras den Klang der Hämmer einer Schmiede hörte, begann er zu studieren, was einen harmonischen Klang ausmacht. Ihm wird der Satz zugeschrieben: „Das Wesen des Kosmos ist die Zahl.“ Damit legte er den Grundstein der Harmonielehre. Heute wissen wir, dass unser Klangempfinden auch etwas mit der Entwicklung unserer Sinne zu tun hat. Und das gilt offensichtlich nicht nur für das Hören. Menschen aller Kulturen empfinden bestimmte Proportionen als „schön“ oder „harmonisch“. In der Renaissance machten sich berühmte Künstler daran, als harmonisch empfundene Proportionen zu erforschen. Leonardo da Vinci und Michelangelo begaben sich dazu sogar in einen Wettstreit. Die Wahrheit in der Natur zu ergründen, war ihnen ein Anliegen. Und sie stießen damit auf ein harmonisches Prinzip, das bis heute Gültigkeit hat. Prof. Harald Lesch deckt die Rätsel der Harmonie im Universum auf, er ergründet, wie es dazu kam und welche Bedeutung das Harmonische, das Regelmäßige, das Schöne für uns hat. Und wir erfahren, warum das junge Universum ein Milliardstel Disharmonie brauchte, um all das überhaupt entstehen zu lassen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 29.09.2013 ZDF Faszination Universum: 19. Die Macht des Schicksals
45 Min.Kann man seinem Schicksal entrinnen? Einst kündeten Orakel, Wahrsager und Sterndeuter von der Vorsehung. So hatten etwa die Helden der Antike kaum eine Wahl, sie mussten sich der Macht des Schicksals beugen. Und auch heute glauben viele an einen vorbestimmten Weg. Wo führt er hin, was bringt die Zukunft? Wenn man nur die Zeichen des Schicksals lesen könnte. Astrologie im Weißen Haus: Sterndeuter sollen die Entscheidungen des einst mächtigsten Mannes der Welt beeinflusst haben, Ronald Reagan. Seine Ehefrau, so heißt es, ließ ihren Mann keinen Termin wahrnehmen, ohne zuvor ihre Astrologin befragt zu haben.Damit fügte sich der ehemalige US-Präsident in eine lange Tradition. Seit jeher hatten die Mächtigen der Welt Berater, die Himmelserscheinungen deuteten und damit politische Entscheidungen beeinflussten. Bei den Chinesen galten zum Beispiel Sonnenfinsternisse als Zeichen göttlicher Vorsehung. Wer diese Zeichen vorhersagen konnte, besaß Ansehen und Macht. Der Wettstreit der frühen Astrologen um die Deutungshoheit hatte weitreichende Folgen für die Entwicklung der modernen Astronomie. Ungewöhnliche Himmelserscheinungen galten noch im Mittelalter als göttliche Schicksalsboten. Von deren Bedeutung erzählt ein Teppich, der Ende des 11. Jahrhunderts gestickt wurde: der Teppich von Bayeux. Eines der Motive: ein Komet, der von den Menschen bewundert wird. Der Teppich von Bayeux erzählt die Geschichte einer der berühmtesten Schlachten Englands: Bei Hastings fordert Herzog Wilhelm von der Normandie den englischen König Harold Godwinson heraus – und besiegelt damit das Schicksal des englischen Königshauses. Der Komet spielt dabei eine zentrale Rolle. Bis heute faszinieren uns diese wie aus dem Nichts kommenden Himmelserscheinungen. Kometen sind nur wenige Tage lang sichtbar und können heller leuchten als der Vollmond. Im November erwarten Astronomen einen besonders hellen Kometen an unserem Nachthimmel. Den Menschen des Mittelalters waren solche Erscheinungen ein Rätsel. Nach dem damaligen Glauben galten die äußeren Himmelssphären als unveränderlich. Kometen mussten demnach wie Wolken Teil der Atmosphäre sein, so die Interpretation. Doch schon damals gab es Forscher, die an einen kosmischen Ursprung dieser Erscheinungen glaubten. Ihre technischen Mittel waren beschränkt, und doch kamen sie dem Phänomen auf die Spur. Wie war es ihnen möglich, zu beweisen, dass Kometen Besucher aus den Tiefen des Kosmos sind? Auch wenn Himmelskörper keine Boten göttlicher Vorsehung sind, können sie für uns auf ganz direkte Weise schicksalhaft sein. Erst im Februar dieses Jahres erhellte ein Asteroid den Himmel über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk. Die Druckwelle der Explosion des Asteroiden beschädigte fast 4000 Gebäude, mehr als 1000 Menschen wurden verletzt. Doch für die Wissenschaft ist dieses Ereignis ein Glücksfall. Denn es hilft, ein uraltes Rätsel zu lösen: 1908 zerstörte eine plötzliche Explosion weite Landstriche in Sibirien nahe des Flusses Tunguska. Könnte ein Asteroid die Ursache gewesen sein? Der Himmel über uns verrät nichts über unsere persönliche Zukunft. Und doch können Astronomen aus der Himmelsbeobachtung tatsächlich etwas über das Schicksal lernen: über das Schicksal unserer Welt. Der scheinbar friedliche und unveränderliche Himmel über uns birgt kosmische Gefahren: explodierende Sterne, gefährliche Strahlungsquellen und vagabundierende Schwarze Löcher. Für unsere Heimat-Galaxie – die Milchstraße – ist eine Gefahr real, und das Ereignis nähert sich unaufhaltsam: eine Kollision von galaktischem Ausmaß. In nur vier Milliarden Jahren, lange bevor unsere Sonne erlischt, wird unsere Nachbargalaxie Andromeda mit der Milchstraße kollidieren. Was das für unser Sonnensystem und unseren Planeten bedeutet, steht tatsächlich in den Sternen. Unser Schicksal könnte allerdings schon viel früher besiegelt werden. Schon in 300 Millionen Jahren wird unsere Erde nicht mehr so sein wie wir sie kennen. Die Triebkraft aus dem Erdinnern verschiebt die Kontinente stetig aufeinander zu. Ein Riesenkontinent wird einmal das Aussehen unseres Planeten beherrschen – mit gravierenden Folgen für alle Ökosysteme. Würde dann ein außerirdischer Besucher überhaupt noch Menschen antreffen? Für jeden einzelnen ist eine Frage von besonderer Bedeutung: Was ist mein persönliches Schicksal? Manch einer glaubt, die Zukunft offenbare sich in seinen Träumen. Schon in der Bibel wird die prophetische Bedeutung von Träumen beschrieben. Als der ägyptische Pharao von sieben dürren und sieben saftigen Ähren träumte, deutete Josef das als Botschaft: Auf sieben erntereiche Jahre werden sieben magere Jahre folgen. Der Pharao solle für die Zukunft vorsorgen, so Josefs Rat. In der biblischen Geschichte bewahrheitet sich das Geträumte. Doch was bedeuten Träume wirklich? Sind sie, wie Sigmund Freud glaubte, nur unbewusster Ausdruck unserer verdrängten Wünsche? Die aktuelle Traumforschung kommt zu neuen Schlussfolgerungen. Vor dem Hintergrund der Jahrtausende langen Bestrebungen, etwas über die Zukunft zu erfahren, stellt sich die entscheidende Frage: Gibt es überhaupt ein Schicksal? Anfang des 19. Jahrhunderts, als die modernen Wissenschaften ihren Siegeszug antreten, entwickelt ein Mann eine fast beängstigende Theorie: Ausgehend vom bisherigen Erfolg der mathematischen Beschreibung der Welt glaubt der französische Astronom Pierre-Simon de Laplace, alles sei – prinzipiell – berechenbar. Wenn es nur einen Geist oder einen Automaten gäbe, der in der Lage wäre, alle Naturgesetzte zu verstehen und alles bis ins Kleinste vermessen zu können, dann müsste dieser in der Lage sein, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft richtig zu berechnen. Die Natur – und damit auch der Mensch – wäre dann nur Sklave der mathematisch-naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Könnten unsere modernen „Automaten“ mit ihrer stetig wachsenden Rechen- und Speicherkapazität vielleicht schon in naher Zukunft unser „Schicksal“ berechnen? Harald Lesch begibt sich auf die Suche nach den Beziehungen zwischen himmlischen Mächten und irdischem Schicksal. Eine Reise, die ihn zum Anbeginn der Zeit und bis zu den Grenzen unseres Wissens trägt und von den kleinsten Bausteinen unserer Welt bis weit über die Grenzen unserer Galaxis hinaus bringt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 06.10.2013 ZDF Faszination Universum: 20. Sind wir allein?
45 Min.Sind wir allein im Universum? Diese Frage stellt sich Professor Harald Lesch und macht sich auf zu einer abenteuerlichen Reise. Eine Reise, die ihn durch unsere Milchstraße führt, auf der Suche nach fremdem Leben. Dabei begegnet er manchen kosmischen Katastrophen: Ereignisse, bei denen die Zukunft der Erde auf Messers Schneide stand. Ob ein anderer Planet im Universum eine ähnlich glückliche Entwicklung genommen haben könnte, ist eine Frage, die nicht nur Harald Lesch fasziniert. Bisher haben Forscher schon etwa 1800 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt.Doch auf welchem könnte der Lebensfunke gezündet und intelligente Lebensformen hervorgebracht haben? Auf der Suche nach erfolgversprechenden Kandidaten hilft der Blick auf unseren Heimatplaneten. Er liefert den Kompass bei der Suche nach einer zweiten Erde. Erst das Zusammenspiel mit dem Mond hat auf unserem Planeten zu einem stabilen Klima geführt. Dabei ist der Mond das Ergebnis einer Katastrophe, die um ein Haar zur Vernichtung unseres Heimatplaneten geführt hätte. Und noch eine weitere kosmische Katastrophe war Geburtshelfer für die Vielfalt des Lebens auf der Erde: Ein großer durch das All vagabundierender Stern muss die Planeten in unserem Sonnensystem einst auseinander getrieben haben. Eine phantastische Geschichte. Aber nur so lässt sich erklären, dass ausgerechnet die Erde im „grünen Bereich“ um die Sonne gelandet ist: genau dort, wo die Temperaturverhältnisse optimal sind und es flüssiges Wasser gibt. Ohne diesen Zwischenfall, der über vier Milliarden Jahre zurückliegt, wäre die Erde wohl von einem Riesen wie Jupiter verschluckt worden. Viele Milliarden Jahre hat es gedauert, bis das erste Leben entstand. Voraussetzung: eine Sonne, die lange genug brennt und die nötige Energie liefert. Unsere Sonne ist besonders alt, vielleicht ist sie sogar die älteste Sonne mit Planeten in der Milchstraße, und sie wird noch zirka weitere fünf Milliarden Jahre brennen. Die Frage, wo in unserer Galaxie es vergleichbare Bedingungen gibt, führt auf eine spannende Spur. Schon seit der Mensch in den Sternenhimmel schaut, stellt er sich die Frage: Wo sind wir? Erst moderne Technik kann darüber Aufschluss geben. Seitdem Forscher mit Teleskopen auch oberhalb der Atmosphäre weit entfernte Sterne anpeilen können, wissen sie etwas über die genaue Position der Erde in der Milchstraße: Unser Planetensystem hat eine „Toplage“. Näher am Zentrum unserer Galaxie gibt es viel mehr Sterne, die durch ihr Entstehen und Vergehen lebensgefährliche Strahlen ins Weltall senden. Weiter draußen am Rand der Milchstraße hätte Leben vermutlich gar nicht erst entstehen können. Schließlich bestehen wir zu 92 Prozent aus Sternenstaub. Und dort draußen gibt es zu wenig Sterne, die die Bausteine der Materie erbrüten. Kann es ähnlich günstige Bedingungen noch einmal geben, oder ist die Erde ein einmaliger Glücksfall – ein Unikat? Im Universum gibt es Milliarden von Sternen und Planeten. Dass es darunter eine zweite Erde gibt, auf der noch andere intelligente Wesen leben, kann niemand ausschließen. Deshalb versuchen Forscher, sich ein Bild davon zu machen, wie außerirdisches Leben aussehen könnte. Der Phantasie sind zwar keine Grenzen gesetzt. Doch es spricht manches dafür, dass der Außerirdische „auch nur ein Mensch“ ist. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 21.09.2014 ZDF Faszination Universum: 21. Der kosmische Code
45 Min.Der Blick in die Natur offenbart eine wunderbare Vielfalt von Mustern und Regelmäßigkeiten. Um Ordnung in die verwirrende Komplexität der Erscheinungen zu bringen, macht sich Harald Lesch auf die Suche nach dem Code des Kosmos. „Alles ist Zahl“ – für den griechischen Philosophen Pythagoras hatten Zahlen die Macht über unser Universum. Bis heute scheint diese Macht ungebrochen: Viele Menschen sind überzeugt von ihrer mystischen Bedeutung. Könnte die Macht der Zahlen soweit reichen, dass ein geheimer Code uns und unsere Welt beherrscht? Die Zahl 13 löst bei vielen Menschen Unbehagen aus.Woher kommt die geheime Macht dieser Zahl? Wissenschaftler haben sich auf die Suche nach dem Ursprung gemacht. Schon von vor 4000 Jahren gibt es Hinweise auf das gespaltene Verhältnis zur 13. Astronomen studierten den Himmel und beschrieben 13 Tierkreiszeichen. Weshalb das 13. Sternzeichen jedoch keine Zukunft hatte und wir heute nur noch zwölf kennen, ist eine Geschichte, die einen tiefen Einblick in die Bedeutung und Macht der Zahlen eröffnet. Wie kamen überhaupt die Zahlen in die Welt? Sie sind uns nicht „in die Wiege gelegt“. Bis heute gibt es Völker, die keine Worte für Zahlen in ihrer Sprache haben, die nicht zählen. Die Welt der Zahlen fehlt ihnen nicht. Doch vor etwa 6000 Jahren begannen die Zahlen ihren Siegeszug: Als Siedlungen größer wurden und Gesellschaften sich immer arbeitsteiliger entwickelten, wurde das Zählen und Rechnen zu einem unschätzbaren Vorteil. Im antiken Griechenland entwickelte sich das Rechnen zur reinen Wissenschaft. Über der Aufgabe, die „Quadratur des Kreises“ zu bewerkstelligen, verzweifelten viele, einer ließ dafür sogar sein Leben. Die Aufgabe steht bis heute sprichwörtlich für eine unlösbare Aufgabe. Und das ist sie tatsächlich. Trotz solcher Krisen entwickelte sich die Mathematik zu einem immer mächtigeren Instrument. Sie war das Werkzeug, das über Jahrhunderte geltende Weltbilder stürzen ließ. So trat gegen Ende des 16. Jahrhunderts der junge Johannes Kepler den Kampf gegen das vorherrschende Bild vom Lauf der Sterne und Planeten an. Seine einzige Waffe: die Mathematik. Schließlich formulierte er drei Gesetze der Planetenbewegung und trotzte dem Kosmos damit einen Teil seines Codes ab. Bis heute haben die Keplerschen Gesetze Gültigkeit. Die Mathematik erwies sich als eine Sprache des Universums. Aber ist sie damit auch die Universal-Sprache schlechthin? In der Insektenwelt wollen Forscher Indizien dafür gefunden haben. Sie entdeckten bei Tieren tatsächlich eine Art Zahlenverständnis. Ein Hinweis, dass auch Lebensformen auf anderen Planeten, dass auch Außerirdische Mathematik verstehen könnten? Genau das glauben Astronomen, die in den 1970er Jahren zwei Weltraumsonden eine verschlüsselte Botschaft mitgaben: eine Wegbeschreibung zu unserem Heimatplaneten. Die Botschaft hat inzwischen unser Sonnensystem verlassen. Nun heißt es: warten. Auf der Erde machen sich Wissenschaftler daran, den vollständigen Code der Natur zu entziffern: Viele natürliche Strukturen wie etwa die Symmetrie von Blattadern, von Pfauenfedern oder der harmonische Aufbau von Blüten lassen einen allgemein gültigen Code vermuten. Einerseits. Andererseits scheinen die Vorgänge in der Natur zu komplex und chaotisch, um sich in mathematischen Gesetzten fassen zu lassen. Mancher ist allerdings der Überzeugung, einem alles umfassenden Code auf der Spur zu sein. Im Computer lässt sich die Natur mit recht einfachen Regeln schon erstaunlich gut nachempfinden. Eine Annäherung. Doch was die Natur tatsächlich preisgeben wird, bleibt ihr Geheimnis. Harald Lesch zeigt, wo die Macht der Zahlen endet und die Berechenbarkeit des Kosmos an Grenzen stößt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 28.09.2014 ZDF Faszination Universum: 22. Im Bann des Lichts
45 Min.Das Leben auf der Erde hängt am Licht unserer Sonne. Doch könnten wir dank moderner Technik auch ohne unseren guten Stern überleben? Harald Lesch versucht, diese Frage zu ergründen. Wie lebenswichtig die Sonne ist, zeigt sich, wenn sie fehlt. Vulkanausbrüche und Kometeneinschläge haben die Sonne schon mehrfach in der Geschichte mit Staub verhüllt und so ganze Arten ausgelöscht. Könnte der Mensch das Fehlen der Sonne meistern und gar ihr Ende überleben? Fast alle Kulturen der Welt verehrten die Sonne aufgrund ihrer Bedeutung für das Leben.Sonnenfinsternisse galten als göttliche Zeichen. Doch schon in der Steinzeit gab es Bemühungen, den Lauf der Sonne und den Rhythmus ihrer Finsternisse zu entschlüsseln. Denn wer das Schwinden des Sonnenlichts vorhersagen konnte, erlangte Macht. Das Verständnis der Himmelsmechanik erreichte im antiken Griechenland einen Höhepunkt. Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts sollte ein ungewöhnlicher Fund am Meeresgrund unsere Vorstellung von den Fertigkeiten der alten Griechen revolutionieren. Spätestens die moderne Astronomie hat die Sonne endgültig von ihrem göttlichen Thron gestürzt. Doch noch immer gebietet unser Zentralgestirn Ehrfurcht. Denn die Sonne ist ein feuerspuckender Gigant aus glühend heißem Plasma. Sie macht es den sonnennahen Planeten beliebig schwer, eine lebensfreundliche Atmosphäre zu schaffen. Nur die Erde hat diese Aufgabe gemeistert. Denn sie schlägt die Sonne mit ihren eigenen Waffen. Die Tiefsee, in die nie ein Sonnenstrahl vordringt, sei ein lebensfeindlicher Ort – so glaubte man lange. Doch moderne Expeditionen enthüllten eine Welt voller Leben. Einige Tiefseewesen haben das scheinbar Unmögliche gemeistert: Sie haben eine alternative Energiequelle gefunden. Und das fehlende Licht machen sie einfach selbst. Die Tiefseewesen nutzen Chemolumineszenz, um Licht ins Dunkel zu bringen. Der Mensch hat einen anderen Weg gewählt: Elektrizität. Ihre Erforschung hat manche Wissenschaftler in Lebensgefahr gebracht. Andere haben alles daran gesetzt, Profit aus ihren Entdeckungen zu ziehen. Unter ihnen Thomas Edison. Anders als viele glauben, ist er nicht der wahre Erfinder der Glühbirne. Und doch ist sein Ruhm nicht unbegründet. Dank Elektrizität muss sich der Mensch heute nicht mehr nach dem Lauf der Sonne richten. Auf ihre Energie sind wir aber nach wie vor angewiesen. Doch selbst diese Abhängigkeit soll eines Tages überwunden werden: indem wir die Sonne auf die Erde holen. Die Grundlagen für dieses Projekt wurden schon vor 100 Jahren von Albert Einstein gelegt. Das Zauberwort: Kernfusion. Doch kann der Mensch die titanischen Kräfte, die in der Sonne wirken, tatsächlich bändigen? Auch wenn die Bemühungen des Menschen angesichts der Übermacht der Sonne müßig scheinen, eines Tages könnten sie das Überleben der Menschheit sichern. Denn schon in einer Milliarde Jahre beginnt die Sonne ihren Todeskampf – auf der Erde wird es dann ungemütlich. Die einzige Überlebenschance: die Flucht ins All. Doch um die Herausforderungen interplanetarer Raumfahrt zu meistern und andere Himmelskörper zu besiedeln, werden wir all die Erfahrungen benötigen, die wir beim Versuch, uns von der Sonne zu emanzipieren, gewonnen haben. Nur als Meister des Sonnenlichts können wir das Universum erobern. Harald Lesch zeigt, welche Facetten des Sonnenlichts der Mensch bereits gemeistert hat und welche Herausforderungen ihm noch bevorstehen. Teil 2, „Terra X: Faszination Universum – Das Geheimnis der Finsternis“, wird am Sonntag, 11. Oktober 2015, 19:30 Uhr, ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 04.10.2015 ZDF Faszination Universum: 23. Das Geheimnis der Finsternis
45 Min.Dunkelheit ist mehr als nur fehlendes Licht: Mit ihrer Hilfe können wir so manches klarer sehen. Und gerade in der Dunkelheit des Universums entdecken wir seine größten Geheimnisse. Newton entschlüsselte in einem dunklen Zimmer die Natur des Lichts und der Farben des Regenbogens. Nur in der Dunkelheit einer Sonnenfinsternis konnte es gelingen, Einsteins größte Theorie zu beweisen. Die Inka sahen im Dunkel des Himmels ihre Götter wandern. Wir finden in ihr den Stoff, der die Welt zusammenhält. Viele Kinder haben Angst vor der Dunkelheit, und auch Erwachsenen bereitet sie oft noch Unbehagen.Kein Wunder, ist es doch gar nicht lange her, da war der Mensch ihr ausgeliefert und musste jede Nacht erneut darauf vertrauen, dass die Sonne wiederkehrt. Mit dieser Urangst des Menschen haben die Pharaonen im Alten Ägypten so geschickt gespielt, bis sie zur wichtigsten Säule ihrer Macht wurde. Die selbst ernannten Söhne des Sonnengottes regierten mithilfe der Nacht. Auch die ewige Dunkelheit von Höhlen füllten die Menschen seit jeher mit ihrer Phantasie: als Eingang zur Unterwelt oder gar zur Hölle, als Rückzugsort von Drachen und anderen düsteren Fabelwesen. Dennoch traut sich der Mensch immer tiefer in Höhlen hinein und findet tatsächlich bizarre Kreaturen, angepasst an das Leben ohne Licht. Und manchmal zeigen sich ihre Spuren auch in unserer Welt, wenn die Wesen aus der Dunkelheit der Höhlen die Nacht erobern. Das Geheimnis der Farben sollte erst gelöst werden, als sich Forscher im Dunkeln mit der Natur des Lichts befassten. Isaac Newton, den viele für den größten Physiker der Neuzeit halten, erforschte in Selbstversuchen und mit akribisch durchgeführten Experimenten die Eigenschaft von Farben. Neuere Forschungen zeichnen ein ganz anderes Bild von Newton: als letzter Magier des Mittelalters. Tatsächlich soll er die meiste Zeit seines Lebens der dunklen Magie gewidmet haben. Und gerade deshalb soll er zu bahnbrechenden Erkenntnissen gekommen sein. Auch Einstein brauchte die Dunkelheit: Nur mithilfe einer Sonnenfinsternis konnte ein britischer Zeitgenosse zeigen, dass Einsteins Formeln zur Allgemeinen Relativitätstheorie richtig waren. Sir Arthur Eddington gelang es ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs, das entscheidende Foto bei einer Sonnenfinsternis einzufangen. Während die Inka in der Dunkelheit des Himmels etwas Göttliches sahen, fragte man sich in Europa, was wohl zu entdecken wäre, blickte man nur mit immer besseren Instrumenten ins Dunkel. Die Griechen vermuteten irgendwo am Ende eine Wand, hinter die man nicht schauen könne. 2000 Jahre später finden wir wirklich eine für unsere Teleskope undurchdringliche Grenze – die allerdings ganz anders aussieht, als Generationen von Forschern sie sich vorgestellt hatten. Harald Lesch enthüllt auf seiner Reise in die Finsternis, dass der größte Teil unserer Welt unsichtbar ist, sich in der Dunkelheit versteckt: die sogenannte Dunkle Materie. Sie zu ergründen ist eine der spannendsten Fragen der Astronomie unserer Zeit. Welche Geheimnisse sich noch im „Dunkeln“ verbergen, vermag noch niemand zu sagen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 11.10.2015 ZDF Faszination Universum: 24. Asteroiden – Die letzte Chance
Eine unterschätzte Gefahr: Asteroiden auf Kollisionskurs. Harald Lesch reist in einem virtuellen Raumschiff ins Sonnensystem, um herauszufinden, wie wir der Gefahr begegnen können. Millionen von Asteroiden vagabundieren durch unser Sonnensystem. Täglich fallen mehrere Tonnen Asteroidenstaub zur Erde. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns ein großer Brocken gefährlich wird. Doch trotz des Risikos sind Abwehrmaßnahmen bisher reine Theorie. Im Morgengrauen des 15. Februar 2013 erhellt ein Feuerball den Himmel über der russischen Kleinstadt Tscheljabinsk.Seine Druckwelle beschädigt tausende Gebäude. Spätere Auswertungen zeigen: Hier war ein Asteroid von etwa 20 Metern Durchmesser beim Durchgang durch die Atmosphäre explodiert. Er war völlig unbemerkt auf Kollisionskurs gelangt, denn selbst die besten Teleskope können Asteroiden nur unter bestimmten Bedingungen erspähen. Die meisten Asteroiden im Sonnensystem ziehen ihre Bahnen weit entfernt von der Erde, im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort sind sie für uns keine Gefahr. Allerdings reicht schon ein kleiner Anlass, um das labile Gleichgewicht zu stören. Es ist vor allem Jupiter, der regelmäßig für gefährliche Unruhe sorgt, obwohl er 300 Millionen Kilometer vom Asteroidengürtel entfernt ist. Wann der nächste Asteroideneinschlag droht, kann niemand mit Sicherheit vorhersagen. Klar ist nur: Er wird kommen. Vorkehrungen für den Ernstfall sind bisher reine Theorie. Vielen scheint vor allem eine Lösung denkbar: den Asteroiden mit Hilfe eines Raumschiffs aus seiner Bahn lenken. Allerdings ist diese Methode nur bei kleinen oder noch weit entfernten Asteroiden wirkungsvoll. Bei akuter Gefahr bleibt nur, den potenziellen Killer mit Sprengungen aus seiner Bahn zu katapultieren oder ganz zu zerstören. Doch auch eine Sprengung birgt Risiken, denn Asteroid ist nicht gleich Asteroid. Je nach Beschaffenheit und Größe müsste ein Sprengsatz punktgenau platziert werden, um den Erfolg der Mission zu garantieren. Solche Manöver im Weltraum sind jedoch eine Herausforderung, wie die Bruchlandung des Philae-Landers auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko im November 2015 gezeigt hat. Im Zweifel bleibt nur eine Chance: eine bemannte Mission, deren Crew die richtige Platzierung des Sprengsatzes sicherstellen kann. Das Problem: Zurzeit existiert jedoch keine geeignete Rakete, die Menschen auch nur bis zum Mond bringen könnte. Was den Ingenieuren in den 1960er Jahren gelang, scheint heute in weiter Ferne. Die immerwährende Gefahr eines Asteroideneinschlages sollte genügen, um die Weltgemeinschaft zur Entwicklung geeigneter Triebwerke zusammenzuschweißen. Doch die unberechenbare Gefahr, die in weiter Ferne scheint, genügt offensichtlich nicht für eine internationale Anstrengung. Die nötige Motivation könnte nun von unerwarteter Seite kommen: Privatunternehmen wie Planetary Resources oder Deep Space Industries wollen schon in etwa zehn Jahren Metalle wie Gold und Platin auf Asteroiden abbauen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Verlockung von Reichtümern die Entwicklung neuer Technologien beflügelt. Doch es bleibt die Frage: Wem gehört das Weltall? Die Nagelprobe wird der erste wirtschaftlich verlockende und erreichbare Himmelskörper sein. Ein Lehrstück internationaler Interessenkonflikte und des Kampfes um neue Ressourcen findet sich auf der Erde: die Antarktis. Dennoch braucht es eine globale Anstrengung, um im Ernstfall für eine Asteroidenabwehr die nötige Technologie zur Hand zu haben. Vielleicht bietet eine Vision dazu den Anlass: der bemannte Flug zum Mars. Vor mehr als 50 Jahren hatte der Traum vom ersten Menschen auf dem Mond Politiker wie Ingenieure beflügelt. Heute ist es der Traum vom Mars, der für den nötigen technologischen Schub sorgen und so die Menschheit vor einer kosmischen Bombe bewahren könnte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 02.10.2016 ZDF Faszination Universum: 25. Aliens – Der erste Kontakt
Unfassbar viele Sterne, unzählige Möglichkeiten: durchaus denkbar, dass es irgendwo da draußen Aliens gibt. Wie können wir sie finden – und sie uns? Oder gab es schon einen ersten Kontakt? 1990 ist Belgien im UFO-Fieber. Unbekannte Flugobjekte werden vom Radar erfasst, und tausende Augenzeugenberichte rufen selbst das Militär auf den Plan. Rätselhafte Signale werden als Botschaften Außerirdischer gedeutet. Forscher verfolgen die Spuren bis ins All. Manchmal trifft es sogar Profis: Als 1969 die Besatzung von Apollo 10 den Mond umrundete, hatte sie ein Erlebnis der besonderen Art.Ihre Mutmaßung, Botschaften von Außerirdischen empfangen zu haben, blieb viele Jahre in den NASA-Archiven unter Verschluss. Aber auch seriöse Wissenschaftler halten Aliens für möglich. Schließlich gibt es allein in der Milchstraße über 100 Milliarden Sterne, die meisten umgeben von Planeten. Doch es ist unmöglich, jeden möglichen Kandidaten zu untersuchen. Vermeintliche Hinweise auf Außerirdische sind daher Zufallsfunde. So auch ein Signal, das 1977 mit einem Radioteleskop in Ohio aufgefangen wurde. Auf dem Computerausdruck, der das auffällige Signal dokumentiert, notierte der Forscher „Wow!“. Noch heute grübeln Forscher darüber, ob das sogenannte „Wow-Signal“ eine Botschaft Außerirdischer war. Es war nicht das erste Mal, dass ein Forscher glaubte, das Signal einer außerirdischen Intelligenz empfangen zu haben. Nikolai Tesla, ein genialer Wissenschaftler, war schon lange zuvor überzeugt, Kontakt mit Marsianern zu haben. Tatsächlich hatte er außerirdische Signale aufgefangen, nur – wie man inzwischen weiß – kamen sie nicht vom Mars. Mit Außerirdischen in Kontakt zu treten, ist ein alter Menschheitstraum. Der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß machte sich bereits vor etwa 200 Jahren konkrete Gedanken dazu. Er setzte darauf, dass die Mathematik die universelle Sprache im Weltall sei und außerirdische Intelligenzen entsprechende Botschaften verstünden, wenn man sie nur in geeigneter Weise übermittelte. Mit Hilfe von Raumsonden, wie den Voyager-Sonden, schickte man später ausgefeilte Nachrichten ins All. Tatsächlich sendet die Erde bereits einige Millionen Jahre ohne menschliches Zutun eine entscheidende Nachricht ins Universum: Auf diesem Planeten gibt es höher entwickeltes Leben. Der Hinweis findet sich versteckt im Sonnenlicht, das unsere Atmosphäre durchdringt. Wurde die Nachricht schon von Aliens entdeckt? Manch einer ist der Überzeugung, dass Außerirdische der Erde schon längst einen Besuch abgestattet haben. Hinweise auf solche Besucher sollen sich im Geheimwissen von Urvölkern wie den Dogon in Mali finden. Und schließlich: Was ist dran an den unzähligen UFO-Meldungen aus der jüngeren Vergangenheit? Mithilfe der Wissenschaft lassen sich selbst Berichte von Entführungen durch Außerirdische analysieren. Harald Lesch untersucht den UFO-Glauben mit wissenschaftlichem Blick. Und er stößt dabei auf einen Kontakt, der vielleicht tatsächlich stattgefunden hat. Auch wenn dieser anders ausgesehen haben dürfte, als es die meisten Science-Fiction-Filme nahelegen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 09.10.2016 ZDF Faszination Universum: 26. Eine Frage der Zeit
Die Zeit-Skalen des Universums sprengen unsere Vorstellungskraft. Harald Lesch blickt zurück auf 13,8 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Wir erfassen nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit, am unteren Ende der Zeit-Skala versagen unsere Sinne: Schnelle Vorgänge entziehen sich unserer Wahrnehmung. Und doch waren gerade Zeiträume außerhalb unseres Zeithorizonts für unsere Entstehung entscheidend. Bei Zirkusvorstellungen geraten wir ins Staunen. Die Bewegungen der Artisten sind oft so schnell, dass das Auge nicht folgen kann.Doch auch die Artisten selbst haben keine Supersinne. Wie schaffen sie es, die Kunststücke zu koordinieren? Modernste Kameratechnik hilft, die Bewegungen zu entschlüsseln. In der Natur gibt es Wesen mit echten Supersinnen. Schon eine Stubenfliege ist uns bei der Wahrnehmung von Bewegungen weit überlegen. Der Mensch erfasst nur etwa 20 Bilder pro Sekunde, eine Fliege 200 – sie sieht wie in Zeitlupe. Diese unterschiedlichen Sinnesleistungen wurden über die Jahrtausende von der Evolution geformt. Zeiträume zu erfassen, die über unsere Lebensspanne hinausgehen, war für unser Überleben nicht wichtig. Und doch versuchen wir heute, uns das Unvorstellbare vorstellbar zu machen. Stellt man die kosmische Geschichte in einem Jahr dar, ergibt sich ein erstaunliches Bild: Verortet man den Urknall in der Silvesternacht um Mitternacht, dann formte sich im Laufe des Frühlings unsere Milchstraße. Unsere Sonne und mit ihr die Erde entstanden Anfang September. Und der Mensch betrat erst am 31. Dezember die Bühne. Warum hat das so lange gedauert? Ein Blick auf die Bausteine des Lebens verrät, warum Milliarden von Jahren vergehen mussten, bis Leben möglich wurde. Es ist noch gar nicht lange her, dass solch astronomische Zeiträume undenkbar schienen. Noch im 17. Jahrhundert glaubte man, die Erde könne höchstens 6000 Jahre alt sein – dieser Zeitraum ließ sich aus der biblischen Stammtafel herauslesen. Doch ein Mann sollte den Blick auf viel größere Zeiträume eröffnen: Robert Hooke. Der Universalgelehrte war einer der Ersten, der das gerade erfundene Mikroskop dazu nutze, einen genauen Blick auf das Leben zu richten. Seine Betrachtung von Ammoniten führte ihn auf die Spur einer geologischen Vergangenheit, die alle biblischen Zeit-Skalen sprengte. Doch es sollte noch weitere zwei Jahrhunderte dauern, bis eine Methode entdeckt wurde, die die genaue Bestimmung geologischer Zeitalter ermöglichte: die radiometrische Datierung. Dank dieser Methode wissen wir heute, wann etwa das Leben entstand: Spuren im Gestein in Nordkanada deuten darauf hin, dass die ersten Bakterien vor bereits vier Milliarden Jahren die Erde eroberten. Doch bis aus diesen Bakterien eine Vielfalt an Leben entstand, wie wir sie heute sehen, dauerte es noch drei weitere Milliarden Jahre. Was hat die Entwicklung verzögert? Forscher haben den Stoff in Verdacht, den wir atmen. Heute versuchen wir, immer mehr in immer kürzere Zeiträume zu pressen. Die Erfindung der modernen Mobilität, die automatisierte Fließbandarbeit und die digitale Revolution haben tatsächlich viele Dinge beschleunigt. Doch die Natur tickt auch heute noch auf den gleichen Zeit-Skalen wie vor Milliarden von Jahren – der Takt des Lebens lässt sich nicht beschleunigen. Im Großen Refraktor auf dem Potsdamer Telegrafenberg geht Harald Lesch den Fragen der Zeit nach. Das historische Gebäude beherbergt die erste speziell für Astrophysik errichtete Sternwarte und gehört zum Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 01.10.2017 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail