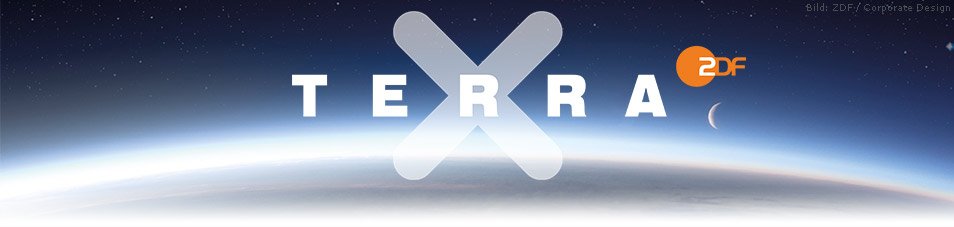1524 Folgen erfasst (Seite 51)
Supertiere: 09. Zwerge
45 Min.Wenig Platz macht erfinderisch: Auf einer 4,3 Quadratmeter großen Insel vor Panama leben kleinwüchsige Faultiere, auf Borneo gibt es Zwergelefanten, und die Rentiere auf Spitzbergen sind fast nur halb so groß wie ihre Verwandten auf dem Festland. Sie alle haben sich ihrem kleinen Lebensraum über Generationen angepasst. „Inselverzwergung“ nennt das die Wissenschaft: Wenn eine Insel deutlich kleiner ist als der vorherige Lebensraum, dann schrumpfen die Bewohner – manchmal sogar drastisch. Aber haben die Zwerge im Tierreich, die mit weniger Nahrung und Platz auskommen, gleichzeitig einen Überlebensvorteil? Was das kleinste aller Lebewesen betrifft offensichtlich schon.Das erst kürzlich entdeckte Bakterium Nanoarchaeum Equitans – zu Deutsch „Reitender Urzwerg“ – misst nur ein 400 Millionstel Millimeter, existiert aber offensichtlich schon seit der Anfangszeit des Lebens. Vielleicht gerade weil es so klein ist. Viele Winzlinge haben sich an ihre ökologische Nische und das Nahrungsangebot perfekt angepasst. So auch der kleinste Vogel, der Kolibri. Er ernährt sich ausschließlich von Blütennektar, und sein Schirrflug ermöglicht ihm den optimalen Zugriff darauf – ohne, dass er landen muss. Für manch anderen Mini ist es schwieriger, in der großen, gefährlichen Welt zu überleben. Um das eigene Leben zu verlängern und Fressfeinde auszutricksen, haben sie beeindruckende Kniffe entwickelt. Unsichtbar machen ist einer davon – die Stabschrecke oder Schmetterlinge wie der Birken-Gabelschwanz sehen aus wie die Pflanze, auf der sie sitzen. Andere imitieren gefährlichere oder giftige Arten und erhöhen auf diese Weise ihre Überlebenschancen. Hierzulande macht zum Beispiel die zierliche Schwebfliege gerne einen auf dicke Wespe oder Biene und verhindert so, von Vögeln verzehrt zu werden, denen die wehrhaften Insekten nicht schmecken. Doch nicht nur Verwandlungskünstler, auch wahre Leistungsgiganten finden sich unter den Kleinsten der Kleinen – dazu zählen vor allem Insekten, die in kooperativen Kolonien leben. Bienen gehören zu den wichtigsten Bestäubern weltweit. Und Ameisen gelten als wahre Naturschützer. Mit ihren Gängen lockern sie Böden und in Wäldern sind sie effiziente Schädlingsbekämpfer. Es kommt eben nicht nur auf Größe und Stärke an, auch eine zarte Statur und Anpassungsfähigkeit sichern dem Winzling Standortvorteile. Ob XXS und XXL – im Tierreich haben alle Arten ihren ganz eigenen Platz. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 07.09.2013 ZDFneo Supertiere: 10. Die Hartnäckigen
Dirk Steffens setzt die „Terra X“-Reihe „Supertiere“ fort und präsentiert Wissenswertes, Erstaunliches und Skurriles aus der Welt der Tiere.Die Folge „Die Hartnäckigen“ zeigt tierische Superhelden, die besonders harte und extreme Lebensbedingungen meistern. Mal ist es die geschickte Anpassung, mal das richtige Outfit, die ein Überleben in Eiseskälte oder Höllenhitze ermöglichen.Da ist zum Beispiel das Kamel, ein geborener Schnelltrinker und eingefleischter Wüstenprofi. Es kann nicht nur innerhalb von zehn Minuten 100 Liter Wasser zu sich nehmen, sondern auch extreme Temperaturschwankungen locker wegstecken.Als wahre Hitzehelden präsentieren sich auch manche Chamäleons. Je nach Temperatur ändern sie ihr Schuppenkleid – von schwarz bis ganz weiß. Der Otter dagegen liebt es kalt, sein dichtes Fellkleid hilft ihm dabei: Auf einem Quadratzentimeter wachsen rund 100 000 Haare. Das sind so viele, wie wir Menschen durchschnittlich auf dem gesamten Kopf haben. Zwischen ihre vielen Haare pusten Otter zudem kleine Luftbläschen, die für zusätzliche Kälteisolierung und einen gewissen Wasserschutz sorgen. Damit ist selbst ein Eisbad kein Problem.Auch für die neue Ausgabe der „Terra X“-Reihe „Supertiere“ war Moderator Dirk Steffens wieder im nächtlichen Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main unterwegs. Angelehnt an den Hollywood-Blockbuster „Nachts im Museum“ begegnen ihm in dieser Folge nicht nur durch Animation zu neuem Leben erweckte Museumstiere wie der uralte T-Rex, sondern auch lebendige Tiere: So geben sich ein Uhu und zwei Gürteltiere ein Stelldichein und zeigen ihre beeindruckenden Fähigkeiten. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 19.09.2015 ZDFneo Supertiere: 11. Die Trickreichen
Mit einem neuen Zweiteiler setzt Dirk Steffens die erfolgreiche „Terra X“-Reihe „Supertiere“ fort und präsentiert Wissenswertes, Erstaunliches und Skurriles aus der Welt der Tiere. Die zweite Folge, „Die Trickreichen“, stellt tierische Spezialisten vor, die besonders ausgebufft durchs Leben gehen. Raffinesse ist im Tierreich unerlässlich, um lästigen Konkurrenten ein Schnippchen zu schlagen und widrige Lebensbedingungen leichter zu meistern. Geradezu ein echter Trickbetrüger ist der Kuckuck: Um mit seinem Nachwuchs nicht zu viel Arbeit zu haben, stiehlt er aus einem fremden Nest ein Ei und legt an dessen Stelle sein eigenes hinein. Damit der Schwindel nicht auffällt, passt der Kuckuck seine Eier denen der Zieheltern an.Brut und Aufzucht überlässt er den unfreiwilligen Pflegeeltern. Ganz schön gewieft! Das gilt auch für das Erdhörnchen, einen Verwandten des Eichhörnchens. Die Erdhörnchen reiben sich – aus Gründen der Verteidigung – mit zerkauter Klapperschlangenhaut ein und halten so ihre ärgsten Feinde auf Abstand. Auch für die neue Ausgabe der „Terra X“- Reihe „Supertiere“ war Moderator Dirk Steffens wieder im nächtlichen Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main unterwegs. Angelehnt an den Hollywood-Blockbuster „Nachts im Museum“ begegnen ihm in der zweiten Folge nicht nur durch Animation zu neuem Leben erweckte Museumstiere wie der uralte T-Rex, sondern auch lebendige Tiere: Eine Würgeschlange, Glühwürmchen und zwei kleine Igel waren dieses Mal dabei. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 27.09.2015 ZDF Supertiere des Wassers: 1. Tiefe See
45 Min.Das offene Meer ist der größte Lebensraum der Erde. An der Oberfläche wimmelt es von Fischen und anderen Meerestieren. In größeren Tiefen streifen sonderbare Kreaturen in der Dunkelheit umher und warten darauf, dass ihnen eine Mahlzeit über den Weg schwimmt. In der ersten Folge des neuen Zweiteilers „Supertiere des Wassers – Tiefe See“ erzählt Dirk Steffens wie es ist, im tiefen Ozean zu leben und welche besonderen Anforderungen dieser Lebensraum an seine Bewohner stellt. In der Tiefsee ist es stockdunkel, eiskalt, und das Wasser übt einen Druck aus, der selbst U-Boote zerquetschen würde wie eine Dampfwalze eine Getränke-Dose.Leckere Happen sind rar, und das knappe Nahrungsangebot macht erfinderisch: Es gibt Tiefseefische mit extrem dehnbaren Mägen und ausklappbaren Kiefern. Damit können sie Beute fangen, die größer ist als sie selbst und so für die Zeit bis zum nächsten Fang vorsorgen. Oft verleihen derartige Eigenschaften den Fischen ein geradezu groteskes Aussehen: Der Pelikanaal zum Beispiel erinnert mit einem riesigen Maul an einen Staubsaugerbeutel. Geistermuräne, Anglerfisch, Schleimaal und der Blobfisch, der aussieht wie ein glitschiger Fußball, könnten wohl jeden Hässlichkeits-Wettbewerb gewinne. In den Ozeanen hat Mutter Natur nicht alle mit einem gutem Aussehen gesegnet. Dafür haben die Tiere andere Qualitäten: Sie sind Geschwindigkeitsrekordhalter wie der Segelfisch, oder sie können eine komplette Stunde lang die Luft anhalten wie der Pottwal. Der Tintenfisch ist Meister des optischen Tarnens und Täuschens. Er teilt seiner Umwelt über das Farbenspiel seiner Haut mit, wie er drauf ist. Und das, obwohl er selbst eigentlich farbenblind ist. Andere Meeresbewohner kommunizieren akustisch. Da wird geknurrt, gefiepst und gepupst was das Zeug hält, um den anderen gründlich die Meinung zu sagen. Den tierischen Grand Prix de la Chanson würden sicherlich die Buckelwale gewinnen. Die männlichen Tiere geben regelrechte Konzerte, bei denen sie bis zu zehn Stunden lang abwechselnd singen. Ihre Gesänge haben eine klare Struktur: Sie bestehen aus Versen, Strophen und Liedern. Ihr Erfindungsreichtum führt dazu, dass das Walkonzert jedes Jahr ein bisschen anders klingt. Zwar gibt es bei ihnen Oldies, also Lieder die über viele Jahre erhalten bleiben, andere Sommerhits sind schon im nächsten Jahr vergessen. Das alles dient nur dem einen Zweck: die eigenen Gene weiterzugeben. Dirk Steffens präsentiert in „Terra X: Supertiere des Wassers – Tiefe See“ familiengerecht aufbereitet Wissenswertes und Skurriles aus dem Leben unter Wasser. Im Ozeaneum in Stralsund begegnen ihm computeranimierte Pinguine, die die Handlung augenzwinkernd begleiten. Auch tierische Assistenten wie ein Fangschreckenkrebs mit den besten Augen der Weltmeere und eine Prachtsepie, die mit einem Feuerwerk von Farben überrascht, unterstützen Dirk Steffens dabei, den Zuschauern dieses faszinierende Universum etwas näher zu bringen. Der zweite Teil „Terra X: Supertiere des Wassers – Land in Sicht“ wird am Sonntag, 14. September 2014, 19:30 Uhr, ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 07.09.2014 ZDF Supertiere des Wassers: 2. Land in Sicht
45 Min.Eine Reise unter die Wasseroberfläche bringt uns in eine ganz besondere Welt. Vieles ist neu, merkwürdig, unbegreiflich. Man trifft dort Fische, die auf Händen laufen, Seekühe, die frieren, oder Nilpferde, die die Luft anhalten. In der Dokumentation „Supertiere des Wassers – Land in Sicht“ erzählt Dirk Steffens, wie Tiere, die in Flüssen oder in Küstennähe leben, mit den Herausforderungen zurecht kommen. Denn die Gesetze der Natur sind an Land nicht dieselben wie unter Wasser. Fortbewegung, Futtersuche, Atmen, Schlafen, Jagen und die Aufzucht der Jungen – alles ist anders.Manche Tiere können sich noch nicht entscheiden, welches Medium sie bevorzugen, und leben zwischen den Welten. Flusspferde etwa gehen zwar zum Grasen an Land, die meiste Zeit aber halten sie sich im Wasser auf. Schwimmen können sie nicht so gut, dafür können sie – auch mit Hilfe von Schwimmhäuten zwischen den Zehen – prima unter Wasser laufen. Schnabeltiere dagegen sind gute Schwimmer. Sie leben ausschließlich in Australien und sind ein biologisches Kuriosum: Sie haben den Schnabel einer Ente, den Schwanz wie ein Biber, einen Giftstachel wie ein Reptil. Und als wäre das nicht schon genug Wundersames legen diese Säugetiere auch noch Eier. Sie haben, als sich aus Reptilien die Säugetiere entwickelten, eine eigenwillige Abzweigung genommen. Es gibt viele Tiere, deren Evolution Umwege geht. Die Wirbeltiere zum Beispiel gingen vor 360 Millionen Jahren an Land. Dann stellten einige von ihnen fest, dass es im Wasser doch schöner ist – und kehrten in ihr Ursprungselement zurück. Der Film erzählt, wie sich Pinguine, Seelöwen, Seeotter und andere „Rückkehrer“ an das Leben im Wasser anpassen. Letzterer ist besonders originell: Er kann Muscheln mit Hilfe von Werkzeug aufknacken und wickelt sich zum Schlafen in Seetang ein. Der Umgang mit dem salzigen Meerwasser ist übrigens nicht nur für Säugetiere ein Problem: Auch Fische müssen ständig trinken, um nicht zu verdursten. Die Meerechsen auf Galapagos niesen einfach, wenn sie überschüssiges Salz loswerden wollen. Um die „Supertiere des Wassers – Land in Sicht“ vorzustellen ist Dirk Steffens ins Ozeaneum nach Stralsund gegangen. Müssen Fische schlafen? Warum haben Seeotter so dichtes Fell? Was ist eine Discomuschel und wie viele tausend Kilometer wandern Aale? Diese und ähnliche Fragen beantwortet der Moderator mit der Unterstützung von „echten“ tierischen Helfern wie Zwergotter „Nemo“, einem Axolotl und einem Goldfisch und begleitet von zwei frechen animierten Pinguinen. Es ist eine Reise durch ein faszinierendes Universum, das viele Überraschungen bietet. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 14.09.2014 ZDF Der Super-Wall – Chinas Große Mauer (1): Das Erwachen des steinernen Drachen
45 Min.Sie ist Stein gewordener Zeuge der Macht Chinas, Schauplatz von Mythen und Quelle unzähliger Legenden: die Große Mauer. In der Liste der Weltwunder sucht man sie vergeblich und doch ist sie eines der großen Wunderwerke der Menschheit. Die Geschichte der Chinesischen Mauer beginnt weit vor unserer Zeitrechnung und ist bis heute nicht zu Ende geschrieben. Erstaunlich, wie wenig Verlässliches über dieses Monument bekannt ist. Niemand hat es je vermessen, sein Alter ist ungewiss, seine Erbauer sind so gut wie unbekannt.Und doch wurde die Große Mauer zum Mythos, zum Sinnbild für die turbulenten Beziehungen Chinas zu seinen nördlichen Nachbarn und dem Rest der Welt. Die Mauer ist der Schlüssel zum Verständnis chinesischer Kultur und Geschichte schlechthin. Doch eins ist heute gewiss: die Große Mauer als einheitliche Verteidigungsanlage existiert nicht. Chinas Superwall ist eine Vielzahl von Mauern und Bollwerken, errichtet in verschiedenen Epochen und zum Teil funktionslos. Zwei wichtige Bauphasen stehen für die friedlichen und feindlichen Auswirkungen des Mauerbaus: die Anfänge der Hanzeit (202 vor Christus bis 8 nach Christus) und die der Ming-Dynastie (1368 bis 1644), in der die Mauer das Gesicht bekam, das wir kennen. Abenteuer Große Mauer: Im März 1907 kämpft sich der britische Forscher und Abenteurer Aurel Stein mit einer Kamelkarawane durch die Wüste Taklamakan. Plötzlich fesseln gewaltige Lehmruinen seine Aufmerksamkeit: Es ist das Jadetor, Yumenguan, der westlichste Punkt eines über 2000 Jahre alten Verbindungswalls. Zum Teil sind die Mauern, die aus Stroh und Lehm erbaut wurden, als solche kaum noch erkennbar. Doch die Festung, ein wuchtiger Lehmklotz, muss einmal von großer Bedeutung gewesen sein. Schon Aurel Stein wusste, dass hier die berühmte Seidenstraße entlang führte. Was oder wen sollten die Mauern in dieser Einöde einst schützen? In den Jahren um 160 vor Christus überfallen schon seit Jahrhunderten kriegerische Nomaden aus dem Norden chinesische Siedlungen, plündern und rauben. Chinas „Beschwichtigungspolitik“, die „Barbaren“ mit Geschenken fernzuhalten, war teuer und fruchtete nicht. Außerdem gefährdete sie die Stabilität des Reiches und brachte die Herrschaft der Han-Kaiser selbst in Gefahr. Der Unterschied konnte zudem größer nicht sein. Dort wilde, umherschweifende Reiter, hier eine sesshafte Bevölkerung, deren Leben detailliert geregelt war. China war das Zentrum der Zivilisation. Kaiser Wudi beschloss nach einem Feldzug gegen die „brüllenden Barbaren“, den Rat eines seiner Generäle anzunehmen und gegen die Feinde eine Mauer zu bauen. Man begann an jener Stelle, an der Aurel Stein fast 2000 Jahre später die Ruinen des Jadetores fand. Tausende von Zwangsarbeitern wurden in Chinas Nordwesten geschickt, Tausende mussten ihr Leben lassen. Niemand kennt ihre Namen. Der Bauer Zheng Bao steht im Film stellvertretend für sie alle. Das Bauwerk der Han zerfiel zu Staub, nachfolgende Dynastien errichteten ihre eigenen Wälle – bis zur Errichtung der steinernen Mauer, die zur Ikone Chinas wurde. Durch die enge Kooperation mit CCTV, Beijing, wurden faszinierende Aufnahmen in Regionen möglich, die normalerweise nicht zugänglich sind. Spielszenen geben Einblicke in das Leben in China vor 2000 Jahren. Aufwändige Computeranimationen veranschaulichen die Techniken des Mauerbaus, Archäologen und Wissenschaftler berichten von den neuesten Erkenntnissen über ein Bauwerk, das heute zur Touristenattraktion geworden ist. Teil 2 von „Der Super-Wall: Chinas Große Mauer“ zeigt ZDFneo direkt im Anschluss um 20:15 Uhr. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 20.05.2007 ZDF Der Super-Wall – Chinas Große Mauer (2): Ansturm aus dem Norden
45 Min.Im September des Jahres 1792 entsandte König Georg III. die erste britische Handelsmission nach China, eine 700-köpfige Delegation, zu der neben Diplomaten auch Maler, Musiker und ein Heißluftballon-Pilot gehörten. Auf drei großen Schiffen brachten sie die modernsten Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts mit. Sie wollten den chinesischen Kaiser Qianlong überzeugen, dass er sein Land dem Handel mit dem Westen öffnet. Die Briten, angeführt von Lord Macartney, ertrugen stoisch monatelang die chinesische Hinhaltetaktik und nutzten die Zeit zu touristischen Unternehmungen.Zwei Tagesreisen von Peking entfernt, am Gubeiko-Pass, erwartete die Engländer ein Anblick, der bislang nur ganz wenigen Europäern vergönnt war: die Große Mauer. Ein Monument aus Stein, das sich über Berggipfel, durch Täler und grüne Flächen schlängelte. Macartneys Urteil: „Es ist das erstaunlichste von Menschenhand geschaffene Werk.“ Dieses Bild der „Großen Mauer“ sollte bis heute bestehen. Damals wurde der Mythos geboren, der eigentlich zwei Mauern meint: die physische und die mentale. Seit der Ming-Dynastie (1368 bis 1644) war China bestrebt, sich ganz in sich selbst zurückzuziehen. Die Verbotene Stadt wurde zum Gefängnis für seine kaiserlichen Bewohner. Das Land war vor allem im Norden durch riesige Mauern abgegrenzt, doch nach wie vor fanden Mongolen und später die Mandschu Schlupflöcher. Als ein besonders hartnäckiger Gegner erwies sich Altan Khan (16. Jahrhundert), der sogar den Mut hatte, Peking zu belagern. Für die Chinesen eine große Demütigung, erwiesen sich doch all ihre großartigen Mauern als trügerischer Schutz. Als Folge daraus wurde fieberhaft an der Mauer weitergebaut, Festungen und Garnisonen errichtet. Schließlich war das Meer erreicht. Fachleute waren gefragt: Ingenieure, Statiker und Ziegelbrenner. Anstelle der Fronarbeiter kamen Soldaten, die unter erbärmlichsten Bedingungen bauten und das Land schützten. Die Mauer schloss das eigene, chinesische Universum ein und grenzte für die Zukunft alles Fremde aus. Eine Weltsicht, die der Ming-Dynastie schließlich zum Verhängnis wurde. 1644 übernahm ein Rebell, ein Mandschu, den Drachenthron. Macartneys Mission (Ende des 18. Jahrhundert) war ein Fiasko, doch sein Blick auf die Große Mauer blieb in den westlichen Köpfen. Dieser Mythos liegt bis heute über der wahren Mauergeschichte. Sie war niemals ein Symbol nationaler Stärke. Sie ist das Denkmal einer Kultur, die sich selbst genug sein wollte. Neben faszinierenden, ungewöhnlichen Originalschauplätzen und Ansichten der Großen Mauer – zu verschiedenen Jahreszeiten – zeichnen auch hier behutsame Inszenierungen, Computeranimationen und neueste Erkenntnisse ein farbenprächtiges Bild einer der wichtigsten Phasen des Mauerbaus. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 27.05.2007 ZDF Tabu: 1. Verbotene Orte
45 Min.Das sagenumwobene North Sentinel Island im Indischen Ozean, Namibias Diamantensperrgebiet und eine äthiopische Kapelle gehören zu den wenigen Orten, die bis heute kaum jemand betreten darf. „Terra X“ begibt sich auf Expedition zu wehrhaften Inselbewohnern, die seit Jahrtausenden ihr Eiland verteidigen. Im geheimnisvollen Diamantensperrgebiet dreht sich alles um die glitzernden Steine, und schließlich fahndet das Team in Äthiopien nach der Bundeslade. Die Insel North Sentinel Island im Indischen Ozean ist für jeden Fremden tabu.Sogar tödlich kann ein Zusammentreffen mit den Bewohnern dieses abgelegenen Eilandes enden, die bislang jeden Kontakt zur Zivilisation verweigern. Erst 2018 wurde der junge Amerikaner John Allen Chau bei dem Versuch, die Sentinelesen zu missionieren, getötet. Obwohl bereits seit 1996 rund um die Insel ein streng bewachtes Sperrgebiet ausgewiesen wurde, das sowohl die Ureinwohner als auch mögliche Besucher schützen soll, kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. „Terra X“ spricht mit den ersten beiden Forschern, die je friedlichen Kontakt zu dem rätselhaften Inselvolk herstellen konnten, und versucht, die Situation eines der letzten unkontaktierten Völker der Welt besser zu verstehen. Außerdem besucht das „Terra X“-Team das legendäre Diamantensperrgebiet im Südwesten Namibias. Hier wurden einst aus Glücksrittern Millionäre. Ein Bahnbeamter aus Thüringen, August Stauch, löste in der damaligen deutschen Kolonie im Jahr 1908 einen wahren Diamantenrausch aus, der bis heute anhält. Namibia gehört zu den zehn größten Diamantproduzenten der Welt. „Terra X“ sucht den Enkel von August Stauch auf, taucht ein in die spannende Geschichte der Diamantenjäger in Namibia und erklärt, woher die Diamanten kommen und wie sie in der Wüste gelandet sind. Seit über 100 Jahren ist die Gegend ein streng bewachtes Sperrgebiet. Welche Geheimnisse sind noch immer jenseits des Stacheldrahtes verborgen? Ein weiteres Tabu birgt eines der größten Menschheitsgeheimnisse überhaupt. In einer schlichten Kapelle in der kleinen äthiopischen Stadt Axum soll nach dem Glauben der Äthiopier die Bundeslade aufbewahrt werden. Nur ein auf Lebenszeit gewählter Wächter-Mönch soll Zugang zu ihr haben. Seit der ehemalige Patriarch der Kirche von Äthiopien, Abuna Pauolos, 2009 während eines Papstbesuchs verkündete: „Sie befindet sich bei uns in Axum. Äthiopien ist der Thron der Bundeslade, seit Hunderten von Jahren schon“, rückt Axum immer wieder ins Blickfeld von Wissenschaftlern und Abenteurern. Existiert die Bundeslade überhaupt – und wenn ja, befindet sie sich tatsächlich in Äthiopien? „Terra X“ begibt sich auf Spurensuche. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.06.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 16.06.2019 ZDF Tabu: 2. Geheimnisvolle Orte
45 Min.Hartnäckig halten sich Gerüchte über abgestürzte UFOs und Aliens, die auf der Area 51 untersucht werden.Bild: ZDF und Richard SakoWas geht auf dem geheimnisumwitterten Militärgelände „Area 51 vor“? Warum ist das Naturparadies Grönland bedroht? Wem gehört der sagenumwobene Schatz im Wrack der versunkenen „San José“? „Terra X“ erzählt die Geschichte dreier außergewöhnlicher Orte, die aus ganz unterschiedlichen Gründen „tabu“ sind, also nicht betreten werden dürfen. Außerdem stellt die Dokumentation Menschen vor, die in besonderer Weise mit diesen Orten verbunden sind. Die „Area 51“ in der Wüste von Nevada ist ein streng bewachtes militärisches Testgelände.Darüber hinaus ist sie Projektionsfläche für Visionen, Utopien und Verschwörungstheorien, ein Mekka der Ufo-Gläubigen und Alienfans. Auch der Deutsche Jörg Arnu, der 1995 in die USA auswanderte, beschäftigt sich seit 1998 mit diesem sagenumwobenen Ort. Er war so fasziniert, dass er bis heute geblieben ist. „Für die Leute, die sich jetzt hier mit der ‚Area 51‘ beschäftigen, ist klar, dass es ein totales Tabu ist, in die ‚Area 51‘ eindringen zu wollen. Das hat auch keiner von uns vor. Wir wollen mit legalen Mitteln rausfinden, was da eigentlich so vor sich geht“, sagt Arnu. Einer, der tatsächlich weiß, was im Sperrgebiet geschieht, ist der ehemalige CIA-Mitarbeiter T.D. Barnes. Er enthüllt völlig neue Details über die Historie dieses verbotenen Ortes und erläutert die Entstehungsgeschichte der vielen modernen Mythen, die sich um die „Area 51“ ranken. Wie an kaum einem anderen Ort prallen auf der Insel Grönland die Konflikte der modernen Welt aufeinander. Auf der einen Seite gibt es noch immer die archaische Schönheit unberührter Natur, auf der anderen Seite droht die Zerstörung durch vielfältige Einflüsse: Globalisierung und Ressourcenhunger, Erderwärmung und Naturzerstörung, die Spätfolgen des Kolonialismus und die Verdrängung indigener Kultur. Dabei könnte ein zentrales Tabu dieser Kultur auch heute noch eine sinnvolle Entscheidungshilfe sein. Die grönländische Sage über Sassuma Arnaa, die Mutter des Meeres, warnt seit Jahrhunderten vor dem Raubbau an natürlichen Ressourcen. „Sie lehrt uns, wie wir unsere Umwelt behandeln sollen. Es ist uns verboten, mehr zu jagen und zu fangen, als wir zum Leben brauchen“, erklärt die grönländische Künstlerin und Aktivistin Paninnguaq Lind Jensen. Die Gier der Welt nach Bodenschätzen ist die offensichtlichste Einflussnahme auf das nordische Inselparadies, aber Grönland ist auch besonders stark vom Klimawandel betroffen. Die globale Erwärmung ist dort deutlicher zu spüren als irgendwo sonst auf der Welt. Nicolas Stoll, Glaziologe am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, ist Teil des internationalen „East Greenland Ice-Core Project“. Gemeinsam mit seinen Kollegen bohrt er einen Eiskern durch den nordostgrönländischen Eisstrom. Die Wissenschaftler hoffen, durch das mehrjährige Bohrprojekt den Eisstrom im Kontext des Klimawandels besser verstehen zu können. Sie wollen erfahren, wie das Eis fließt und wie die Eismassen zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen. „Es ist sehr sicher, dass es diverse Kipppunkte auf unserem Planeten gibt – unter anderem das Abschmelzen der Eisschilde“, erklärt Stoll. „Wenn solche Kipppunkte überschritten sind, lässt sich eine bestimmte Entwicklung nicht mehr umkehren.“ In Grönland steht also eine Menge auf dem Spiel. Das Wrack der spanischen Galeone „San José“ vor der Küste Kolumbiens: Jahrzehntelang suchten Forscher und Schatzjäger nach dem legendären Schiff mit seiner Ladung, die aus Gold und Edelsteinen bestehen soll, deren Wert auf rund 17 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. 1708 ging das spanische Schiff beim Angriff durch die britische Flotte unter. Da das Wrack in großer Tiefe lag und damit unerreichbar, blieb der Schatz ein Tabuthema unter den involvierten Staaten. Doch als moderne Technik es 2015 schließlich einem US-Bergungsteam im Auftrag der kolumbianischen Regierung ermöglichte, das Wrack zu lokalisieren, entbrannte ein erbitterter Streit. Ein anderes U-Boot-Team behauptet, das Wrack schon in den 1980ern entdeckt zu haben. Damit nicht genug: Auch auf politischer Ebene ist die Situation ungeklärt. Wer hat Anrecht auf den Schatz? Kolumbien, vor dessen Küste das Schiff gesunken ist? Spanien, dessen Galeone den Schatz transportierte? Oder doch die indigenen Bewohner der Regionen, aus deren Minen das Gold und die Edelsteine ursprünglich geraubt wurden? (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 29.03.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 02.04.2023 ZDF Tabu: 3. Betreten verboten!
45 Min.Seit 2019 ist das Besteigen des Uluru, des heiligen Berges der Aboriginal People, verboten. Zuvor kletterten jährlich zehntausende Touristen auf das australische Wahrzeichen und hinterließen Müll und Fäkalien.Bild: ZDF und Pond 5Mit einem Tabu sind viele rätselhafte Orte belegt. Manche gelten als heilig wie der Uluru, andere sind gefährlich wie die Schlangeninsel und wieder andere brauchen Schutz wie die Antarktis. Die Dokumentation „Tabu – Betreten verboten!“ erzählt die Geschichten von solchen verbotenen Orten und lüftet einige ihrer Geheimnisse. Dabei stehen auch immer die Menschen im Vordergrund, deren Schicksal mit solchen Angst- oder Sehnsuchtsorten verknüpft ist. Der Uluru ist eine der Hauptattraktionen des fünften Kontinents.Seit 2019 steht der heilige Felsen der Aboriginal People allerdings unter besonderem Schutz: Ihn zu besteigen, ist ein Tabu. Der Uluru hat für die australischen Ureinwohner eine zentrale Bedeutung als heiligster Ort ihrer jahrtausendealten Kultur. Er ist die Heimstätte ihrer Ahnen, die in den vielfältigen Formen des Berges und der umliegenden Landschaft ihren Seelenabdruck hinterlassen haben. Der Film begleitet die junge Aktivistin Talia Liddle, die entschlossen für die Rechte der indigenen Bevölkerung kämpft. Die kleine brasilianische Insel Queimada Grande fehlt in keiner Top-Ten-Liste der gefährlichsten Tabu-Orte der Welt. Eine Legende besagt, dass sich hier ein sagenhafter Inka-Schatz befindet, der bis heute nicht entdeckt wurde. Was man aber auf jeden Fall auf dem nur 44 Hektar großen Eiland finden kann, sind Exemplare der extrem giftigen Insel-Lanzenotter, einer Schlangenart aus der Familie der Vipern, die nur auf Queimada Grande lebt. Tausende sollen es sein. Deshalb trägt die Insel auch den Beinamen Schlangeninsel oder auch „Tödlichste Insel der Welt“. Der Schlangenforscher Bryan Fry wagt sich auf die sagenumwobene, für gewöhnliche Menschen nicht zugängliche Insel und geht den Gerüchten und Geschichten rund um die tödlichen Schlangen nach. Die Antarktis, wie man den Kontinent Antarktika und das ihn umgebende Südpolarmeer nennt, hat entscheidenden Einfluss auf das Weltklima und die Meeresökosysteme. Außerdem gilt die Region als Archiv für die Naturgeschichte der Erde. Eine militärische und industrielle Nutzung ist laut Antarktisvertrag von 1961 tabu. Doch die Herausforderungen für die eisigen Weiten haben sich seither verändert: gestiegenes Forschungsinteresse konkurrierender Nationen, immer mehr Touristen, dazu der Klimawandel. Die Dokumentation begleitet die Meereisphysikerin Stefanie Arndt bei der Erforschung des fast menschenleeren Kontinents und lotet mögliche Konsequenzen der zu erwartenden Veränderungen aus. Neue, vertraglich geregelte Schutzzonen könnten die Antarktis in ihrer Einmaligkeit bewahren. Gibt es Hoffnung auf eine Ausweitung des Antarktis-Vertrags? (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.12.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 29.12.2024 ZDF Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218
51 Min.Heute ist die Burg Münzenberg nur noch eine Ruine. Im Mittelalter war sie ein einflussreiches Verwaltungszentrum in der hessischen Wetterau.Bild: The History Channel / ZDF und Arsenij Gusev./Arsenij Gusev/Arsenij Gusev„Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218“ führt in eine Zeit voller Gewalt und Konflikte in der hessischen Wetterau. Der Burgverwalter hat alle Hände voll zu tun, um die Region zu schützen. Der „Terra X“-Film begleitet einen Tag lang Eberhard von Münzenberg. Der Kastellan ist Manager, Steuereintreiber und Chef der Burgwache. Anhand der fiktiven Biografie zeigt die Dokumentation, wie turbulent der Alltag eines Burgverwalters im Mittelalter war. Es ist der 1. Oktober 1218. Das Heilige Römische Reich steht unter der Regentschaft des legendären Stauferkönigs Friedrich II.Seine Herrschaft ist keineswegs gefestigt: Im Süden des Reiches rebellieren die Lombarden. Im Norden versuchen mächtige Fürsten, den Einfluss des jungen Königs zu schmälern. Zur Durchsetzung seiner Macht lässt Friedrich zahlreiche Burgen errichten. In einer Zeit ohne Hauptstadt, ohne einheitliche Reichsgesetze oder Polizei sind Burgen Machtzentren und Gerichtsstandorte zugleich. In der Wetterau ist der Schutz der umliegenden Ortschaften besonders wichtig. Die Region gehört zu den großen Kornkammern des Reiches. Die Burg Münzenberg soll die fruchtbare Talebene, die umliegenden Dörfer und auch die Stadt Münzenberg verwalten und absichern. Dass die Burg sämtliche Aufgaben erfüllen kann, hängt vor allem von Eberhard von Münzenberg ab. Er ist der Kastellan der Burg – so etwas wie ein Verwalter. Der eigentliche Burgherr ist sein Halbbruder Ulrich I. von Münzenberg. Er reist oft im Gefolge des Kaisers und überlässt Eberhard die Geschäfte auf der Feste. Ein anstrengender Job – Eberhard ist Manager, Steuereintreiber und Chef der Burgwache zugleich. Dabei wandelt er zwischen den Welten der Herrscher und der Beherrschten. Allerdings haftet an Eberhard ein Makel, der ihn bisher um sein persönliches Glück gebracht hat. Eberhard ist ein uneheliches Kind, ein Bastard. Im Mittelalter zwar keine Seltenheit, aber doch der Grund, warum Eberhard mit Anfang zwanzig noch immer ledig ist. Die Hochzeit mit einer jungen Adligen soll den Weg frei machen für Eberhards Zukunft und gleichzeitig für eine nützliche Allianz sorgen. Die potenzielle Braut sowie ihre Eltern haben sich angekündigt, um den Hochzeitsbedingungen final zu verhandeln und vertraglich zu fixieren. Denn wie im Mittelalter üblich, spielen finanzielle und machtpolitische Interessen eine gewichtige Rolle bei der Eheschließung. Eberhards Gedanken kreisen um seine Zukünftige und das anstehende Bankett, als ihn schlechte Nachrichten ereilen. Seine Bauern wurden überfallen und können ihre Abgaben nicht leisten. Eine gefährliche Situation für Eberhard, denn im Mittelalter sind Bauern keine Sklaven. Wenn sie nicht geschützt werden, können sie ihm schnell die Unterstützungen versagen, und die Burg verliert ihre wichtigste Einnahmequelle. Eberhard muss all sein Geschick aufbieten, um die Lage zu beruhigen und sich die Gefolgschaft der Bauern zu sichern. Schnell erkennt er, was der Grund für den Überfall ist. Die benachbarte Adelsfamilie von Grüningen will eine ertragreiche Mühle der Münzenberger in ihren Besitz bringen und hat deshalb unter einem Vorwand den von Münzenberg die Fehde erklärt. Eine übliche Form der Konfliktlösung im Mittelalter, die schnell zu einem Kleinkrieg eskalieren kann. Die Fehde bedeutet eine große Bedrohung für die Zukunft der Burg und damit auch für die ganze Region. Eberhard organisiert den Schutz der Burg und der umliegenden Dörfer und kümmert sich zunächst weiter um sein Tagesgeschäft. Denn die Anlage soll einen zweiten Wehrturm erhalten und es gibt jede Menge Probleme: Plötzliche Mehrkosten und Verzögerungen sind nicht nur ein Problem moderner Bauvorhaben. Beim abendlichen Bankett scheint alles gut zu werden. Die Details des Ehevertrages sind geklärt, und die zukünftige Braut findet an ihrem Bräutigam Gefallen. Doch plötzlich erfährt Eberhard, dass sich die Fehdeführer vor dem Stadttor versammelt haben. Der Kastellan muss sich den Angreifern stellen und ein Blutbad verhindern. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 29.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 16.01.2022 ZDF Ein Tag im alten Rom
- Alternativtitel: Ein Tag in ... (1): Ein Tag im alten Rom
50 Min.Der „Terra X“-Dreiteiler „Ein Tag in …“ ist eine ebenso ungewöhnliche wie spannende Zeitreise in den Alltag vergangener Epochen. Das Leben von Kaisern und Königen ist umfassend erforscht und dokumentiert. Der Alltag von ganz normalen Menschen hingegen ist weit weniger bekannt. Er steckt voller Überraschungen und eröffnet einen neuen, verblüffenden Blick auf unsere Geschichte. Die „Terra X“-Reihe „Ein Tag in …“ beantwortet die Frage, die sich Menschen heute stellen, wenn sie an Geschichte denken: Wie wäre es gewesen, in Berlin zur Kaiserzeit zu leben, im Frankfurt des Mittelalters oder im alten Rom.Davon berichtet die erste Folge. Der Film erzählt einen Tag im Leben des römischen Feuerwehrmanns Quintus Pompeius Naso im Jahr 80 nach Christus vom Morgenappell bis zum nächtlichen Brandeinsatz. Quintus’ Geschichte ist erfunden, und dennoch ist sie wahr, recherchiert und verdichtet aus historischen Biografien und neuesten Erkenntnissen der Forschung. Mit Hilfe von Wissenschaftlern rekonstruiert die Dokumentation das Alltagsleben im alten Rom, die Figur von Quintus macht es erlebbar. Im Jahr 80 nach Christus erstrahlt Rom im Glanz neuer Monumentalbauten. Das Kolosseum wird von Kaiser Titus in 100-tägigen Spielen eröffnet. Der Alltag in der Hauptstadt aber ist für die meisten Römer wenig glanzvoll. Mehr als eine Million Menschen drängeln sich auf geschätzten 13 Quadratkilometern Fläche. Damit geht es damals 29 Mal enger zu als im heutigen Köln. Dicht an dicht stehen die antiken Mietskasernen, die Insulae. Verheerende Brände sind an der Tagesordnung. Seit den Tagen des Kaisers Augustus gibt es zwar eine militärisch straff organisierte Feuerwehr, und ausgerechnet der als Brandstifter berüchtigte Kaiser Nero hat eine ganze Reihe von Brandschutzvorschriften erlassen. Dennoch brennt es in der Stadt rund 100 Mal am Tag. Die Mitglieder der Feuerwehr haben einen Knochenjob. Kein Wunder, dass die meisten der 3500 „Vigiles“ so wie Quintus Freigelassene sind ehemalige Sklaven, die nach ihrer Dienstzeit sämtliche Bürgerrechte und damit bessere Karriereaussichten erhalten können. Sie müssen nicht nur Brände löschen, sondern sie auf ihren Inspektionsrundgängen in den Hochhausschluchten auch möglichst verhindern. Auf dem Weg durch Rom erlebt Quintus die Tücken des Alltags. Abgesehen von der Zahnpflege mit Salbei und Bimsstein findet aus Platzmangel alles auf der Straße statt: die Rasur, das Frühstück mit verdünntem Wein, sogar der Gang zur Latrine ist öffentlich und nicht einmal nach Geschlechtern getrennt. Als Toilettenpapier dienen in Essigwasser getauchte Schwämme, die man sich kurzerhand teilt. Mit Hilfe von Funden aus antiken Abwasserkanälen rekonstruiert der Film das Leben auf der Straße, das durch Quintus’ Augen erlebbar wird, darunter der ewige Aufruhr bei der Verteilung des staatlich subventionierten Brots an die armen „Proles“, die Proletarier Roms. Auch die Lebensbedingungen in den häufig illegal gebauten Hochhaussiedlungen können Wissenschaftler heute sehr genau nachvollziehen: Sie waren teuer, eng und wegen offener Feuer und leicht brennbarer Baumaterialien buchstäblich brandgefährlich. Als Quintus in einer Insula massiven Baupfusch aufdeckt, gerät er in das gefährliche Intrigenspiel römischer Immobilienspekulanten, die ihre Rivalität vor Gericht austragen. Und mit Quintus erlebt der Zuschauer einen Nachmittag im Kolosseum, dessen Hauptattraktionen nicht nur Gladiatorenkämpfe, sondern auch die kaiserlichen Lotterien sind. Er nimmt am abendlichen Vereinsleben teil, bis schließlich ein handfester Feuerwehreinsatz mit darüber entscheidet, ob Quintus’ heiß ersehnter Wunsch erfüllt wird nämlich zu einem vollwertigen Bürger Roms aufzusteigen. Die Teile zwei und drei der „Terra X“-Dokumentation, „Ein Tag im Mittelalter“ und „Ein Tag in der Kaiserzeit“, werden am Sonntag, 11. Dezember, und am Sonntag, 18. Dezember, jeweils um 19:30 Uhr ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 04.12.2016 ZDF Ein Tag im Mittelalter
- Alternativtitel: Ein Tag in ... (2): Ein Tag im Mittelalter
45 Min.Der „Terra X“-Dreiteiler „Ein Tag in …“ ist eine ebenso ungewöhnliche wie spannende Zeitreise in den Alltag vergangener Epochen. Diese Folge führt ins mittelalterliche Frankfurt am Main. Das Leben von Kaisern und Königen ist umfassend erforscht und dokumentiert. Der Alltag von ganz normalen Menschen hingegen ist wenig bekannt, steckt aber voller Überraschungen und eröffnet einen neuen, verblüffenden Blick auf unsere Geschichte. Die zweite Folge der „Terra X“-Reihe „Ein Tag in …“ erzählt, wie es gewesen wäre, im mittelalterlichen Frankfurt am Main zu leben.Der Film erzählt einen Tag im Leben des Wundarztes Jakob Althaus im Die zweite Folge der „Terra X“-Reihe „Ein Tag in …“ erzählt, wie es gewesen wäre, im mittelalterlichen Frankfurt am Main zu leben. Der Film erzählt einen Tag im Leben des Wundarztes Jakob Althaus im Jahr 1454. Er beginnt mit einem frühmorgendlichen Notfall und endet mit einem nächtlichen Kneipenbesuch. Jakobs Geschichte ist erfunden, und dennoch ist sie wahr, recherchiert und verdichtet aus historischen Biografien und spektakulären Erkenntnissen der Forschung. Während das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als zersplittertes Sammelsurium souveräner Territorien politisch im Mittelalter steckt, schlägt in Frankfurt bereits der Puls der neuen Zeit. Der Tuchhandel und die Messe haben die Stadt zum „Kaufhaus der Deutschen“ gemacht, in dem Waren und Wissen aus aller Welt gehandelt werden. Ein gewisser Johannes Gutenberg stellt die technische Revolution der Zeit, den Buchdruck mit beweglichen Lettern, auch in Frankfurt vor. Als bedeutender Steuerzahler ist die freie Reichsstadt nur dem Kaiser untertan. Die Könige lassen sich in Frankfurt am Main wählen und später, wie die Kaiser auch, krönen. Aber die Forscher haben auch herausgefunden, wie weit Frankfurt im Alltag von den Standards einer modernen Stadt entfernt ist. Das tägliche Leben folgt damals dem mittelalterlichen Weltbild einer unantastbaren göttlichen Ordnung der Dinge. Erlasse, berufsständische Regelwerke der Zünfte und Benimmbücher regeln pedantisch den Alltag. Von der Körperhygiene – Ärzte wie Jakob haben sich in jedem Fall aus Gründen der Höflichkeit die Hände zu waschen – bis zum Umgang mit der knöchelhoch stehenden Kloake auf den Straßen. Hat der angesammelte Unrat eine gewisse Höhe erreicht, wird einfach neues Pflaster verlegt. Auf Jakobs Weg zu seinen Patienten erlebt der Zuschauer die beengten Lebensbedingungen in der Stadt. Trickreich bauen die Frankfurter sogar Häuser auf Stelzen, um Wohnraum zu schaffen, ohne wichtige Wege zu verlieren – die ersten Fußgängerpassagen entstehen. Großfamilien samt Tieren und Handwerksgesellen leben auf engstem Raum, praktisch ohne Licht, denn die Fenster werden klein gehalten, damit die Wohnungen nicht auskühlen. Und trotzdem: Die Menschen frieren so sehr, dass das Nutzvieh im Erdgeschoss als tierische Fußbodenheizung dienen muss. Wegen der Dunkelheit sind Unfälle im Haushalt an der Tagesordnung – eine typische Verletzungsursache in der mittelalterlichen Stadt, wie Forscher der Universität von Odense in Dänemark entdeckt haben. Dort befindet sich die größte Sammlung mittelalterlicher Knochen in Europa. Die Funde zeigen aber auch: Die Wundärzte des Mittelalters operieren bereits komplizierte Verletzungen erstaunlich erfolgreich. Wundärzte wie Jakob, der wie die meisten seiner Kollegen seine Lehrjahre auf den Schlachtfeldern Europas verbracht hat, beherrschen sogar Eingriffe am offenen Schädel. Nicht nur das: Ein Forscherteam der Universität von Nottingham entdeckt in einem mittelalterlichen Rezeptbuch die Beschreibung für eine Salbe, die sich in ersten Tests als hochwirksam gegen heutige multiresistente Keime erweist. Es ist ein Alltag voller Widersprüche, den Jakob auf seinem Weg durch die Stadt erlebt: die herzhafte Beschimpfungskultur des Mittelalters, die hohe Gewaltbereitschaft der Bürger in Ermangelung einer Polizei und das bizarr anmutende Bestrafungssystem der „Schandmasken“. Gleichzeitig verändert der technische Fortschritt das Leben der Menschen und ihr Denken. Die mechanische Uhr definiert das Zeitverständnis und die Arbeitsbeziehungen neu. Und das kalte Wetter, das die „Kleine Eiszeit“ nach Deutschland bringt, setzt den Erfindungsreichtum in Gang: Daunendecken, Glasfenster und Dämmung der Wände schützen seitdem gegen Kälte und Krankheiten im Alltag. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 11.12.2016 ZDF Ein Tag in Berlin 1926
45 Min.Ende der 1920er Jahre gilt Berlin als Hauptstadt des Verbrechens. „Ein Tag in Berlin 1926“ illustriert die Geschichte von Fritz Kiehl und seiner Arbeit in der ersten Mordinspektion der Welt. Drei Morde pro Woche und kriminelle Banden, die viele Viertel der Stadt kontrollieren: Die Polizei steckt in der Krise. Fritz Kiehl muss einen Raubmörder dingfest machen, den er nur mithilfe neu entwickelter Methoden der Mordinspektion fassen kann. „Ein Tag in Berlin 1926“ dokumentiert 24 Stunden in der Stadt der Sünde. Mit vier Millionen Einwohnern ist die Spreemetropole zur Weltstadt herangewachsen.Im kurzen goldenen Zeitalter zwischen Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise prallen dort Gegensätze aufeinander wie nirgendwo sonst in der Weimarer Republik. In den teuren Restaurants auf den prunkvollen Boulevards und den verruchten Vergnügungslokalen der Stadt stürzt sich die Hautevolee in einen ausschweifenden Lebensstil. Die Abgehängten der Bevölkerung wie Kriegsversehrte und Zuwanderer hingegen leiden unter Hunger und Elend. Die sogenannten Ringvereine kontrollieren die Unterwelt, und die Kriminalitätsrate ist auf Rekordniveau. Die Polizei steht in der öffentlichen Kritik. Nicht umsonst wird Berlin Spree-Chicago genannt. An der Seite von Kriminalkommissar Fritz Kiehl entdecken die Zuschauer den Sündenpfuhl Berlin. Kiehls Tag beginnt am frühen Morgen mit einem Anruf aus dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz. Der verheiratete Beamte arbeitet in der weltweit ersten Mordinspektion – eine Elitetruppe der Kriminalpolizei, die sich auf das schlimmste Kapitalverbrechen spezialisiert hat: Mord. Jeden zweiten Tag findet die Polizei eine Leiche. Sein Chef und Begründer der Inspektion, Ernst Gennat, ist ein Star unter den Kriminalern. Aus der ganzen Welt reisen Kollegen an und wollen von ihm lernen. Er ist der Erste, der feste Ermittlungsverfahren etabliert und seine Kommissare intensiv schult. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Leiche aus Gründen der Pietät umgebettet und der Tatort aufgeräumt wurde, bevor ein Ermittler eintrifft. Für Kiehl ist seine Zugehörigkeit zur Mordinspektion ein Glücksfall, denn er hat ein sicheres Auskommen. Doch die Belastung ist hoch und eine 70-Stunden-Woche keine Seltenheit. Der Mord an einem Kinodirektor ist der aktuelle Fall von Kiehl und lässt ihm keine Zeit zum Durchatmen. Zusätzlich bereitet dem Kommissar eine alte Kriegsverletzung Probleme. Den Tag kann er nur mit starken Schmerzmitteln überstehen. Zusammen mit seinem Kollegen stürzt sich der Beamte in die Ermittlungen, die zunächst ins Leere laufen. Um den kniffligen Fall zu lösen, greift Kiehl zu unorthodoxen Mitteln: Er vertraut auf die Hilfe der Berliner Unterwelt. Die mächtigen Ringvereine sind mafiöse Verbrecherbanden, die ganze Stadtviertel unter ihrer Kontrolle haben. Doch Mord ist selbst bei ihnen verpönt, denn ihre illegalen Geschäfte wie Hehlerei und Prostitution sollen ungestört weiterlaufen. Mit ihrer Hilfe gelingt es Kiehl, den Mörder zu verhaften. Der Rest ist professionelle Polizeiarbeit mit Laboranalysen, Fahndungsaufrufen und geschickter Verhörtaktik – Methoden, die bis heute noch nichts an ihrer Gültigkeit verloren haben. Der Film erzählt nicht nur die fiktive Biografie von Fritz Kiehl, sondern auch, wie die Mordinspektion am Alexanderplatz im Detail gearbeitet hat, wie die Ringvereine organisiert waren und wie die Menschen ihren Alltag im Berlin 1926 erlebt haben. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 23.02.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 10.03.2019 ZDF Ein Tag in Berlin 1943 – Der Passfälscher Cioma Schönhaus
45 Min.Der Jude Cioma Schönhaus ist von der Deportation in den Osten bedroht. Mit Mut begegnet er dem gefährlichen Alltag in Berlin, in dem der kleinste Fehler der letzte sein kann. 1943 soll Berlin nach dem Willen Hitlers „judenrein“ werden. Cioma Schönhaus gehört zu den Zehntausenden Juden, die nicht rechtzeitig ausreisten. Mit falscher Identität taucht er unter und hilft sich und anderen Juden, die Verfolgung durch die Nazis zu überleben. Im vierten Kriegsjahr steuert der Holocaust, die Vernichtung der europäischen Juden, auf seinen Höhepunkt zu. Mehr als 50.000 Berliner Juden sind bereits in den Osten verschleppt worden.Jene, die der Deportation in die Vernichtungslager bis dahin entkommen konnten, sind rechtlos, verfemt und todgeweiht. Polizeikontrollen und Denunzianten lauern an jeder Ecke. Der 20-jährige Cioma Schönhaus lebt als Einziger aus seiner Familie noch in Berlin. Seine Eltern, seine Großmutter, Onkel und Tanten – sie alle sind bereits verschleppt worden. Jeden Tag könnte die Gestapo auch vor Ciomas Tür stehen. Er verlässt die elterliche Wohnung und taucht wie Tausende andere Verfolgte in der Stadt unter. Doch sich verstecken und sich zum Opfer der Nazis machen – das will er nicht. Cioma Schönhaus tarnt sich als sogenannter arischer Deutscher – mit einem falschen Namen und einem ausgedachten Lebenslauf. Auch äußerlich passt er sich an sein Umfeld an: Er trägt die Haare wie ein „Arier“, kurz geschnitten mit Seitenscheitel, und einen Anzug. Um nicht entdeckt zu werden, wechselt er so oft wie möglich seine Unterkunft, und jeden Tag geht er pünktlich um 8:00 Uhr zur Arbeit. Und die ist brisant: Cioma Schönhaus manipuliert kunstvoll Ausweisdokumente, die ihm selbst und anderen Juden eine scheinbar legale Identität verschaffen. Als Passfälscher wird er Teil eines Widerstandsnetzwerks und verhilft dadurch Hunderten Verfolgten zur Flucht. Dabei gelingt es ihm mit einer gehörigen Portion Chuzpe, in einer schier ausweglosen Situation die Lebenslust zu bewahren. Als er auffliegt, wagt er eine abenteuerliche Flucht quer durch Deutschland bis in die Schweiz. Seinem Sohn Sascha Schönhaus berichtet er später detailliert von seinem Leben als „U-Boot“ in Berlin, wie sich die untergetauchten Juden selbst nennen. Getragen von der Originalstimme Ciomas, erzählt „Ein Tag in Berlin 1943“ die Geschichte einer unerschrockenen Persönlichkeit. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 16.10.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 27.10.2024 ZDF Ein Tag in Bologna 1752 – Die Physikerin Laura Bassi
45 Min.Laura Bassi ist Europas erste Philosophie-Professorin und die erste Frau weltweit, die einen Blitzableiter bauen will. Ihre Kollegen halten das für verrückt und boykottieren ihren Plan. Bologna feiert seinen Superstar Laura Bassi. Als sie mit 21 Jahren die Doktorwürde erhält, beschließt sogar der Papst, die talentierte Forscherin zu fördern. Trotzdem muss sich Laura immer wieder in der von Männern dominierten Welt der Wissenschaft durchsetzen. Laura Bassi ist keine Frau, die viel auf Konventionen gibt. Ein Zeitgenosse hat einmal über sie geschrieben: „Sie fürchtet sich vor niemandem.“ 1752 ist die Naturphilosophin fest entschlossen, am Turm der Universität von Bologna einen Blitzableiter anzubringen.Bologna mit seinen vielen Kirch- und Geschlechtertürmen ist besonders anfällig für Blitzschäden. Doch die Erfindung des Blitzableiters ist relativ neu, wenig erprobt und selbst in Wissenschaftskreisen umstritten. Auch Lauras männliche Kollegen halten ihren Plan für gefährlich, wenn nicht sogar für unverantwortlich. Laura Bassi lässt sich davon nicht abschrecken. Sie weiß aber, dass sie die mächtigsten Männer der Stadt auf ihre Seite bringen muss. Am besten wäre es, wenn nicht nur der Magistrat und der Vorstand der Universität, sondern auch der Legat des Papstes ihr ehrgeiziges Projekt unterstützen würden. So brillant Laura auch ist – als Frau werden ihr oft Steine in den Weg gelegt. Zwar erhält sie mit nur 21 Jahren die Doktorwürde und eine Professur für Philosophie an der Universität von Bologna, doch sie muss darum kämpfen, in den Leitungszirkel der Naturwissenschaftlichen Akademie aufgenommen zu werden. Dabei trägt sie wesentlich zur Verbreitung der damals noch jungen Experimentalphysik bei, steht in ständigem Austausch mit den größten Denkern und Universitäten ihrer Zeit und kennt die wichtigsten Forschungsarbeiten. Trotz ihrer Dreifachbelastung als Mutter, Ehefrau und ordentliche Professorin vertieft sie sich in das Thema Elektrizität und wagt schließlich das gefährliche Experiment mit einem Blitzableiter-Modell. Dazu hat sie die wichtigsten Entscheidungsträger Bolognas in ihr Heimlabor eingeladen. Der Ausgang des Versuchs entscheidet nicht nur über die Zukunft ihres Projekts, sondern auch über die Anerkennung ihrer Verdienste als Physikerin. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 09.10.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 20.10.2024 ZDF Ein Tag in der Kaiserzeit
- Alternativtitel: Ein Tag in ... (3): Ein Tag in der Kaiserzeit
45 Min.Der „Terra X“-Dreiteiler „Ein Tag in …“ ist eine ebenso ungewöhnliche wie spannende Zeitreise in den Alltag vergangener Epochen. Die dritte Folge führt nach Berlin in die Kaiserzeit. Das Leben von Kaisern und Königen ist umfassend erforscht und dokumentiert. Der Alltag von ganz normalen Menschen hingegen ist wenig bekannt, steckt aber voller Überraschungen und eröffnet einen neuen, verblüffenden Blick auf unsere Geschichte. Die dritte Folge der „Terra X“-Reihe „Ein Tag in …“ begleitet einen Tag lang das Dienstmädchen Minna Eschler im Jahr 1907 – vom Aufstehen bis zum Gutenacht-Gebet.Minnas Geschichte ist erfunden, und dennoch ist sie wahr, recherchiert und verdichtet aus einer Vielzahl historischer Biografien. Mit Forschern rekonstruiert der Film am Beispiel von Minna das Alltagsleben im Berlin der Kaiserzeit. Das Leben in der boomenden Metropole ist getragen von der Dynamik der Industrialisierung und des technischen Fortschritts sowie eines ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwungs. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat Berlin seine Einwohnerzahl verzehnfacht. Vor allem die arme Landbevölkerung aus dem Osten strömt zu Hunderttausenden in die Hauptstadt. Minna ist eine von ihnen, auf der Suche nach einer Zukunft, die sie in den bitterarmen Landstrichen Pommerns oder Schlesiens nicht hat. Die Strahlkraft Berlins zieht Minna in ihren Bann. Elektrizität lässt neuerdings die Schaufenster erstrahlen, auch die U-Bahn hat gerade ihren Betrieb aufgenommen. Auf den Straßen herrscht Chaos, denn das neuartige Automobil, damals häufig mit Elektromotor, trifft auf eine Stadt, die noch keine Verkehrsregeln kennt. Und die Straßen- und U-Bahnen bescheren ihren Fahrgästen ein weiteres, unerwartetes Problem: Angst vor Geschwindigkeit. Als Flaggschiff des bürgerlichen Wohlstands zieht das „Kaufhaus des Westens“ die Menschen an. Die Stadt ist wie heute: voll, stressig und zugleich unwiderstehlich. Auch an Minnas Arbeitsplatz im Haushalt eines Stuhlrohrfabrikanten hält der Fortschritt Einzug. In der Küche gibt es neuartige Geräte – die erste elektrische Kaffeemaschine und einen strombetriebenen Eierkocher. Doch die Köpfe hängen noch in der alten Zeit. In der wilhelminischen Epoche funktioniert alles nach Befehl und Gehorsam. Die Hierarchien sind undurchlässig – in der Gesellschaft wie in der Familie. Neuankömmlinge wie Minna stehen ganz unten, nur knapp über Prostituierten und Kriminellen. Das prägt Minnas Leben. Sie schläft in einem 70 Zentimeter niedrigen Verschlag. Unter der Treppe, über der Haustür oder der Speisekammer bringen die Neureichen ihr Personal unter. Ihr Arbeitstag dauert 16 Stunden, nur alle zwei Wochen gibt es ein paar Stunden frei. Den Launen und sexuellen Übergriffen des Hausherrn sind die Dienstmädchen rund um die Uhr ausgeliefert. Durch das Dienstbuch, eine Art Arbeitszeugnis, hat die Herrschaft sie in der Hand, denn ohne einen positiven Eintrag haben die Mädchen keine Chance auf einen neuen Job. Doch Minnas Tag führt sie aus den verborgenen Dienstboten-Gängen und Gesinderäumen der bürgerlichen Villen hinaus in die exotisch bunte Warenwelt der Kolonialwarenläden, in das ebenso düstere wie schillernde Milieu der Hinterhöfe, der Proletarier und Prostituierten, in dem eine eigene Sprache und eigene Regeln herrschen. Schließlich kommt sie in das edle Hotel Adlon, das kurz vor seiner Eröffnung steht. Dort gibt es auch für Mädchen Chancen, die nichts gelernt haben, außer gut zu kochen. Letzter Teil der dreiteiligen „Terra X“-Reihe „Ein Tag in …“. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 18.12.2016 ZDF Ein Tag in Dresden 1946
45 Min.Die Historikerin Dr. Leonie Treber im Dresdner Stadtarchiv: Trümmerräumung war zwangsverordnet, körperlich schwere Arbeit und lebensgefährlich.Bild: The History Channel / ZDF und Arsenij Gusev/Arsenij Gusev/Arsenij Gusev„Ein Tag in Dresden 1946“ folgt 24 Stunden lang der jungen Elli Göbel. Die Mutter von zwei Kindern ist eine von über 500 Trümmerfrauen, die helfen, die zerbombte Stadt wiederaufzubauen. Anhand einer fiktiven Biografie verdichtet die „Terra X“-Dokumentation Schicksal und Lebenswirklichkeit der vielen sogenannten Bauhilfsarbeiterinnen in Dresden. Wie haben die Frauen den schweren Alltag gemeistert? Von welcher Zukunft haben sie geträumt? Es ist der 16. September 1946 – der Zweite Weltkrieg ist seit mehr als einem Jahr beendet. Die vier Siegermächte haben Deutschland besetzt und aufgeteilt.Der Osten steht unter sowjetischer Besatzung, darunter auch die Barockstadt Dresden. Das einst prachtvolle Elbflorenz ist eine Trümmerwüste. Durch den verheerenden Bombenangriff in der Nacht auf den 14. Februar 1945 sind 30 Prozent des Wohnraumes völlig zerstört. Dass der Wiederaufbau der Stadt dennoch in Gang kommt, ist besonders den Frauen zu verdanken, die im Volksmund Schipperinnen oder Trümmerfrauen genannt werden. Eine ist Elli Göbel. Den schweren Job hat ihr das Arbeitsamt zugewiesen. Von dem niedrigen Lohn muss sie zwei Kinder ernähren, ihr Mann ist 1943 an der Ostfront gefallen. Bis Kriegsbeginn war Ellis Leben ganz anders – als Geigenlehrerin im schlesischen Breslau. Als im Januar 1945 die Rote Armee vor der Stadt steht, macht sie sich mit ihrer Familie und Tausenden Flüchtlingen auf den langen Weg in Richtung Westen. Ellis Eltern überleben die Tortur nicht, ihre Schwester Gerda gilt seither als vermisst. Doch Elli gibt die Hoffnung nicht auf, Gerda doch noch wiederzufinden. In Dresden ist die Versorgungslage 1946 miserabel. Ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und die Nachricht, dass die engsten Verwandten überlebt haben, ist das, was für die Menschen damals zählt. Die Arbeit als Trümmerfrau – oder Bauhilfsarbeiterin, wie es damals offiziell heißt – ist entgegen der medialen Darstellung alles andere als beliebt. In der Enttrümmerung arbeitet nur, wer keine Wahl hat. Aber es ist die einzige Möglichkeit, an die begehrten Lebensmittelmarken der Kategorie eins zu kommen. Bis heute hält sich hartnäckig der Mythos von der heldenhaften deutschen Trümmerfrau. Dabei arbeiten auf den Baustellen sowohl Frauen als auch Männer. Trümmerfrauen, wie sie im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert sind, hat es eigentlich nur in Berlin und der sowjetischen Besatzungszone gegeben. In den meisten westdeutschen Städten wird die Enttrümmerung schnell von Firmen mit schwerem Gerät übernommen. Und die Bilder von jungen lachenden Frauen, die man aus Schulbüchern kennt, sind oft gestellt. Um in der Nachkriegszeit zu überleben, ist Einfallsreichtum gefragt. Lebensmittel sind knapp, und Hunger ist eine echte Bedrohung. Ersatzprodukte wie die sogenannte Stalinschmiere, eine Ersatzleberwurst aus Speiseölresten und Hefeflocken, füllen wenigstens den Magen. Elli hebt auch Kartoffelschalen auf. Dank der Solanine, die in der Knolle stecken, schäumen sie wie Seife und sind als Putz- oder Waschmittel bestens geeignet. Alte Kleidung wird kurzerhand recycelt: Aus Gardinen oder Uniformen entstehen neue Jacken und Kleider. In der Nachkriegszeit herrscht Nachhaltigkeit, so gut wie nichts wird weggeworfen. Ellis großer Traum ist es, wieder als Musikerin zu arbeiten. Als sie eine Stellenanzeige des Plauener Tanzorchesters liest, will sie auf dem Schwarzmarkt ein Instrument für das Vorspiel organisieren, obwohl der Erwerb von Schwarzmarkt-Waren strafbar ist. Der Schwarzmarkt ist der Supermarkt der Nachkriegszeit. Dort wird schon mal ein Teppich gegen ein paar Lebensmittel oder Meißner Porzellan gegen ein Fahrrad getauscht. Die begehrteste Währung aber sind Zigaretten, Geld ist praktisch nichts mehr wert. Als Elli gerade ein Instrument gefunden hat, wird es plötzlich hektisch auf dem Markt. Die Polizei führt eine ihrer Razzien durch, und Elli wird verhaftet. Ihr droht eine drakonische Strafe und im schlimmsten Fall sogar der Verlust ihrer Kinder. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 29.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 09.01.2022 ZDF Ein Tag in Köln 1629
45 Min.Der Alltag der Hebamme Anna Stein steckt voller Herausforderungen. Wie es ihr in Köln im Jahr 1629 ergangen ist, erzählt die erste Folge des neuen „Terra X“-Dreiteilers „Ein Tag in …“ „Ein Tag in Köln 1629“ führt in die damals freie Reichsstadt zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in der die Hebamme Anna Stein arbeitet. Für ihre Frauen ist sie 24 Stunden im Einsatz. Der Film zeigt ihr Leben zwischen Glaube, Aberglaube und Wissenschaft. 1629 ist das Heilige Römische Reich Deutscher Nation ein Flickenteppich aus über 300 Territorien.Der Dreißigjährige Krieg verwandelt es in ein Schlachtfeld. Weite Landstriche werden verwüstet und entvölkert. Köln ist für alle Kriegsparteien ein wichtiger Handelspartner und bleibt deshalb von direkten Kampfhandlungen verschont. Dennoch schlägt der Krieg auch in Köln tiefe Wunden. Mangelernährung und Krankheiten sind an der Tagesordnung und treiben die Kindersterblichkeit in die Höhe. Die Hebammen, die sich um das Wohl von Müttern und Kindern kümmern, sind rund um die Uhr im Einsatz. Schon am Morgen ist Anna mit den Problemen der Zeit konfrontiert. Als Witwe lebt sie im Haushalt ihres Bruders. Die Verhältnisse sind beengt, und die Grippe ihrer Schwägerin kann damals den schnellen Tod bedeuten. Doch als Hebamme hat Anna ein beachtliches Wissen über Heilkräuter, und ihre Mixturen stehen in ihrer Wirksamkeit modernen Präparaten in nichts nach. Auch in der Chirurgie kennt sich Anna aus. Bei einer schwierigen Geburt führt sie sogar selbstständig kleinere Eingriffe durch. Die Wundärzte verstehen noch zu wenig von der weiblichen Anatomie und schrecken zudem davor zurück, eine gebärende Frau am Unterleib zu berühren. Anna vertraut aber nicht allein auf ihr Können, sondern setzt ebenso auf magische Praktiken. Der Aberglaube ist in der Bevölkerung tief verankert und bietet den Nährboden für den Glauben an Hexen und Dämonen. Beim Marktbesuch mit ihrer Lehrmagd Katarina wird schnell deutlich, welche Themen die Menschen umtreiben. Die dort ausgehängten Flugblätter – Vorläufer der modernen Zeitung – setzen vor allem auf Schrecken und Sensationen. Das sorgt auch schon in der frühen Neuzeit für Auflage, und die Schreiber überbieten sich mit kruden Geschichten über Wunderwesen und Hexen als Hilfstruppen des Teufels. Fake News, politische Propaganda und Meinungsmache sind keine Erfindungen der Moderne. Speziell die Berichte über Hexen sorgen für gute Verkaufszahlen und verhelfen dem Thema zur medialen Dauerpräsenz. Die Folgen werden Anna prompt vor Augen geführt, denn eine ihrer Kolleginnen soll noch am selben Tag auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Der Hexenwahn, dem in der Frühen Neuzeit etwa 25 000 Menschen in Deutschland zum Opfer fallen, hat auch das bis dahin ruhige Köln erreicht. Und gerade Hebammen stehen unter dem Verdacht, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Anna und ihre Lehrmagd haben keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Ein Notfall führt sie in das Haus eines Webers. Die Hebamme muss ihr gesamtes Können und viel Geschick aufbieten, um das Leben von Mutter und Kind zu retten. Sie ist sich bewusst, dass der kleinste Fehler zu einer Anklage gegen sie führen kann. Obwohl ihr die Geburt gelingt, gerät Anna in den Strudel des Hexenwahns. Die Frau, die das Leben der Schwächsten retten soll, muss plötzlich für ihr eigenes kämpfen. Eine Hebamme namens Anna Stein hat es nie gegeben, aber ihre Geschichte ist dennoch wahr – recherchiert und verdichtet aus historisch verbrieften Biografien und neuesten Erkenntnissen der Forschung. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 23.02.2019 arte Ein Tag in New York 1882
51 Min.Plüschige Bars und geheime Hinterzimmer sind damals die Treffpunkte der New Yorker Unterwelt. Welche Rolle deutsche Einwanderer dabei spielten, erforscht die Kuratorin Susan Johnson.Bild: The History Channel / ZDF und Arsenij Gusev/Arsenij Gusev/Arsenij GusevIn der ersten Folge des Terra X-Dreiteilers „Ein Tag in …“ führt die Zeitreise in den Alltag von New York 1882. Wie wäre es gewesen, wenn man als Deutscher damals dort gelebt hätte? Der Film folgt einen Tag lang dem angehenden Anwalt Georg Schmidt. Er ist einer von rund 400 000 deutschen Auswanderern in New York. Trotz aller Widrigkeiten gelingt ihm der Neuanfang in einer Stadt, in der die Korruption wie eine Krake um sich greift. Es ist der 14. Juli 1882. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind noch jung, die Staatsgründung liegt erst gut 100 Jahre zurück.Die USA sind Auswanderungsziel Nummer eins für Menschen aus der ganzen Welt. Für die Europäer ist New York das Tor in die neue Heimat. Damals reicht die Stadt noch nicht über die Insel Manhattan hinaus – die Einwanderer leben in engen Stadtvierteln, die meist nach Nationalität voneinander getrennt sind. „Little Germany“ im Süden von Manhattan ist das Viertel der deutschen Immigranten. Dort wohnt auch der angehende Anwalt Georg Schmidt. Die Deutschen bleiben weitgehend unter sich, trotzen den harten Bedingungen, setzen ihre Ideale, Zielstrebigkeit und Tatkraft dagegen. Und sie hoffen auf Chancen, die sie in der alten Heimat niemals bekommen hätten. Berühmt sind die rheinhessischen Braumeister Eberhard Anheuser und Adolphus Busch, die Erfinder des Budweiser Bier. Oder Levi Strauss, der den gleichnamigen Jeans zu Kultstatus verhalf. Und Henry John Heinz nicht zu vergessen – der Deutschstämmige gilt als Erfinder des Tomaten-Ketchups. Zu den erfolgreichsten Deutschen aber gehört der Harzer Klavierbauer Heinrich Steinweg, dem es gelang, Steinway & Sons zur größten Pianomarke der Welt zu machen. Georg hat den Sprung über den Atlantik gewagt, weil seine Eltern in Potsdam das Geld für das kostspielige Jurastudium nicht aufbringen konnten. In den USA kann er als sogenannter „self-taught lawyer“ eine dreijährige Lehre bei einem zugelassenen Anwalt absolvieren und dann eine Prüfung ablegen. Dafür muss er perfekt Englisch beherrschen, Tausende amerikanische Gesetze und Urteile kennen. Seine Wohnung liegt in einer der ärmlichen Mietskasernen in der Lower Eastside von New York. Georg teilt sie mit einer deutschen Familie aus Westfalen, sein Bereich ist lediglich durch einen Vorhang abgetrennt. Auch sonst sind die Bedingungen alles andere als luxuriös. Tageslicht gelangt nur ganz spärlich durch ein kleines Fenster, es gibt kein fließendes Wasser, und die hundert Hausbewohner teilen sich vier Plumpsklos im Hof. In Castle Garden wartet Georg auf seine Verlobte Maria, die dort mit einem Schiff aus Deutschland eintreffen soll. 1882 empfangen die Amerikaner die Einwanderer mit offenen Armen, vermitteln sogar Wohnungen und Jobs. Einzige Auflage: Vor der Einreise muss jeder Immigrant für zwei Tage in Quarantäne, um das Einschleppen von Krankheiten und Seuchen zu verhindern. Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten. Im Hafengebiet wimmelt es vor Dieben, die es auf die Habseligkeiten oder das bisschen ersparte Geld der Einwanderer abgesehen haben. Die Gauner gehören zu einer der vielen Gangsterbanden von New York. Die mächtigste Anführerin heißt Fredericka Mandelbaum, eine der ersten Frauen an der Spitze der Organisierten Kriminalität. Als die Deutsche aus Kassel 1850 nach New York kommt, ist sie bettelarm. Innerhalb weniger Jahre arbeitet sich „Mother Mandelbaum“ zur größten Hehlerin von New York hoch – und zur ersten Multi-Millionärin des Landes! Diebesgut im Wert von zehn Millionen Dollar soll durch ihre Hände gegangen sein. Für ihre Verbrechen wird sie nie verurteilt, denn sie pflegt Kontakte bis in die höchsten Kreise. Georg sucht die „Königin der Diebe“ auf, weil er dringend ihre Hilfe braucht: Seine Verlobte Maria sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis. Was die Bandenchefin von ihm als Gegenleistung verlangt, bringt Georg in eine ausweglose Situation. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 29.12.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 02.01.2022 ZDF Ein Tag in Nürnberg 1593
45 Min.Frantz Schmidt ist Scharfrichter von Nürnberg und gehört zu den Topverdienern der Stadt. Gesellschaftlich aber sind er und seine Familie geächtet, denn sein Beruf gilt als unehrlich. 45 Jahre lang kämpft Frantz Schmidt gegen den Makel der „Unehrlichkeit“ an. Er hinterlässt ein Tagebuch, das nicht nur sein blutiges Handwerk dokumentiert, sondern auch deutlich macht, wie Frantz gedacht und was er versucht hat, um sich aus seiner Lage zu befreien. Nürnberg 1593. Die Kriminalitätsrate ist hoch, in der Stadt herrscht ein Klima von Angst und Unsicherheit.Der Rat handelt entschlossen und fordert die gnadenlose Verfolgung und Verurteilung von Straftätern durch den Arm des Gesetzes. Für die Vollstreckung zuständig ist der Scharfrichter Frantz Schmidt. Folter und Hinrichtungen sind sein Alltag, und doch quält ihn sein Tun. Weniger treiben ihn Mitleid mit den Delinquenten oder ein schlechtes Gewissen um, sondern die Gewissheit, dass er und seine Nachkommen dem Status der „Unehrlichkeit“ niemals entkommen können. „Unehrlichkeit“ ist damals als Geburtsstand geregelt, wird von einer Generation auf die nächste übertragen und bedeutet neben gesellschaftlichen Repressalien auch eingeschränkte Persönlichkeitsreche. So muss Frantz tatenlos zusehen, wie seine Kinder in der Schule gehänselt oder verprügelt werden. Und ertragen, dass die Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn sehen. Dabei genießt er am Gericht und beim Rat der Stadt hohes Ansehen, nicht nur als Henker, sondern auch als exzellenter Heiler. Häufig werden ihm Patienten geschickt, auch aus „ehrbaren“ Kreisen, die ihren eigenen Ärzten nicht mehr vertrauen. Frantz weiß, welche Arzneimittel wirksam sind, wie man einen ausgekugelten Arm wieder einrenkt oder schwere Wunden versorgt. Nach 15 Jahren im Amt als Scharfrichter fordert Frantz von der Stadt Nürnberg, ihm endlich das Bürgerrecht zu erteilen. Sein akribisch geführtes Tagebuch gilt vielen Forschern als Beleg für seinen Kampf aus der „Unehrlichkeit“. Ob er sein Tagebuch aus Kalkül geführt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Doch das Dokument ist ein nahezu lückenloses Arbeitsprotokoll, das nicht zuletzt auch Aufschluss gibt über das Rechtssystem in der Frühen Neuzeit und die damals gängigen Strafen. Doch trotz seiner tadellosen Lebensführung, die bis ins kleinste Detail von Kirche und Rat beobachtet wird, stehen die Chancen für Frantz nicht gut. In der Geschichte Nürnbergs gibt es keinen einzigen Henker, dem der soziale Aufstieg gewährt wurde. Auf der Grundlage des Tagebuchs rekonstruiert die „Terra X“-Dokumentation einen Tag im Leben von Frantz Schmidt, an dem sich alles für ihn entscheidet. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 09.10.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 13.10.2024 ZDF Ein Tag in Paris 1775
45 Min.Der „Terra X“-Film „Ein Tag in Paris 1775“ schildert den Alltag des jungen Perückenmachers Léonard Minet, der gegen das starre Klassendenken rebelliert und heimlich Damenfrisuren kreiert. Zur Zeit des Ancien Régime gilt es selbst in der Modestadt Paris für einen Friseur als unschicklich, einer Frau die Haare zu machen. Den talentierten Léonard Minet kümmert das nicht. Der Film erzählt, wie es ihm gelingt, Hoffriseur von Versailles zu werden. Die Dokumentation „Ein Tag in Paris 1775“ entführt die Zuschauer in die Zeit von Ludwig XVI., dem letzten Vertreter der französischen Sonnenkönige.14 Jahre vor der Revolution steckt Frankreich finanziell und politisch in der Krise. Während ein Großteil der Bevölkerung arm ist und unter der Willkür ihres Herrschers ebenso leidet wie unter seiner Verschwendungssucht, wird das Bürgertum von Paris zur treibenden Wirtschaftskraft. Die Seine-Metropole entwickelt sich wie keine zweite Stadt in Europa zum Mode-Hotspot. Nicht nur der Adel gibt sich der Prunksucht hin, sondern auch immer mehr Bürger eifern mit Modeschmuck und Second-Hand-Kleidung ihren modischen Vorbildern am Versailler Hof nach. Das Tragen einer Perücke ist das modische i-Tüpfelchen des gepflegten Kleidungsstils, aber vor allem das Erkennungszeichen für den sozialen Status eines Franzosen. Jeder Stand entwickelt seine eigene Form. 1775 aber ändert sich die Modewelt. Das Tragen des eigenen Haars wird zum Symbol der Aufklärung. Verfechter wie Diderot, Montesquieu oder Rousseau zeigen öffentlich ihr eigenes Haar als Zeichen für ihr unabhängiges Denken. Auch Léonard schwört auf den neuen Zeitgeist. Wie die meisten Pariser sehnt er sich nach individueller Freiheit und will den starren Strukturen der Ständegesellschaft entfliehen. Eigentlich soll er das Geschäft seiner Familie übernehmen, die seit Generationen dem Perückenmacher-Handwerk nachgeht. Doch die Geschäfte gehen immer schlechter, und Léonard träumt vom Beruf des Damenfriseurs. Ein Beruf, der gerade erst entsteht und noch nicht durch strenge Vorgaben einer Zunft reguliert ist. Um seine extravaganten Kreationen auszuprobieren, trifft er sich mit der jungen Schauspielerin Lucille, dem aufsteigenden Stern an der Comédie Française. Mit Lucille als Model hofft Léonard, die Aufmerksamkeit der Reichen und Schönen auf sich und seine Frisur-Ideen zu lenken. Als Léonard in die väterliche Werkstatt zurückkehrt, sieht er, wie sein Vater verhaftet wird. Eine unachtsame Bemerkung über den König wurde ihm zum Verhängnis. Ein ausgeklügeltes Spitzelsystem, das an moderne Überwachungsstaaten erinnert, soll jede Kritik am König im Keim ersticken. Damit gerät nicht nur das Leben seines Vaters, sondern auch seine eigene Zukunft in Gefahr. Doch der Zufall will es, dass Léonard am Hof von Versailles seine Künste beweisen darf. Aus der Perspektive der fiktiven Figur Léonard Minet wird ein Tag im Leben eines jungen Perückenmachers erzählt, der in schwierigen Zeiten sein Schicksal in die Hand nimmt und alles dransetzt, um seinen Traum wahr zu machen. Seine Biografie, die anhand von zeitgenössischen Quellen rekonstruiert wurde, basiert auf realer Alltagsgeschichte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 23.02.2019 arte Tag X: 1. Der Untergang der Azteken – 30. Juni 1520
45 Min.Mit elf Schiffen, 16 Pferden, 14 Kanonen und 530 Männern stach Hernan Cortes im Februar 1519 von Cuba aus in See. Er versprach jedem reiche Beute, der mit ihm die Neue Welt erobern würde. Cortes handelte auf eigene Faust. Denn eigentlich sollte er nur in friedlicher Mission für Spanien die Küsten Mittelamerikas erkunden und Tauschhandel mit den Eingeborenen treiben. Sein Ziel aber war Tenochtitlan, verborgen unter dem heutigen Mexiko-City. In der Hauptstadt der Azteken lag der sagenhafte Goldschatz des Montezuma. Das wussten auch die Konquistadoren.In die Stadt, die mitten in einem See lag, kam man nur über wenige Dammstraßen. Die Azteken ließen die Spanier ohne Widerstand in die Stadt einziehen. Tenochtitlan wurde zur tödlichen Falle für die spanischen Eroberer. Am 30. Juni 1520 belagern zehntausende Aztekenkrieger das Quartier der Konquistadoren, die sich des Ansturms kaum erwehren können. Cortes bleibt nur noch ein Pfand: Er hat Montezuma, den Herrscher der Azteken, in seine Gewalt gebracht. Doch als Cortes ihn vor sein Volk führt, wird Montezuma von einem Stein tödlich getroffen. Am 30. Juni steht alles auf Messers Schneide – denn die Azteken haben auch die Dammstraßen zerstört. Dennoch wagt Cortes nachts die Flucht aus Tenochtitlan. Es wird ein Todesmarsch: Drei Viertel seiner Männer fallen im Kampf, 80 werden von den Azteken gefangen und bei lebendigem Leibe den Göttern geopfert. Cortes selbst entkommt diesem Schicksal nur um Haaresbreite. Ohne ihn wären die wenigen überlebenden Konquistadoren geflüchtet und Konquista gescheitert. Doch so kann Cortes schon ein Jahr später, am 13. August 1521, Tenochtitlan in seine Gewalt bringen, mit der Unterstützung von 8000 Tlaxcalteken. Sie richten unter den ihnen verhassten Azteken ein fürchterliches Blutbad an. Das ist das Ende des Aztekenreiches – und der Auftakt zur Eroberung Amerikas. Unter den spanischen Abenteurern war Bernal Diaz del Castillo. Seine „Wahre Geschichte der Eroberung Neuspaniens“ gilt als genaueste und vollständigste Chronik der Konquista. Er erzählt als Augenzeuge vom Untergang der Azteken, vom Tag, an dem sich der Lauf der Weltgeschichte änderte. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 02.07.2005 arte Tag X: 2. Der Sturm auf die Bastille – 14. Juli 1789
45 Min.Mutige Taten, fatale Irrtümer und geniale Entscheidungen ändern den Lauf der Weltgeschichte, manchmal an einem einzigen Tag – dem Tag X. (Text: ZDFneo)Deutsche TV-Premiere Sa. 09.07.2005 arte Tag X: 3. Die Türken vor Wien – 12. September 1683
45 Min.1683 hallte ein Schreckensruf durch Europa: Die Türken stehen vor Wien! Seit 60 Tagen war die Kaiserstadt im Würgegriff osmanischer Truppen. Fast 200º000 Mann, Heer und Tross, lagerten unter dem Halbmond vor Wien. Kara Mustafa, der Feldherr der Osmanen, drohte den Wienern: „Weigert Ihr euch, Wien zu übergeben, so werden wir euch erstürmen und alle, vom Kleinsten bis zum Größten, über die Klinge springen lassen.“ Die Lage war verzweifelt. Die Wiener hungerten, ihre Brunnen waren verseucht: Die Rote Ruhr wütete. Nur noch 4000 Verteidiger standen auf den Mauern.Doch kapitulieren wollten sie nicht. Am 12. September 1683 war alles nur noch eine Frage von Stunden: Für Österreich und seine Verbündeten, die Heilige Liga, gibt es an diesem Tag nur noch eine Möglichkeit: Angriff! Sonst ist Wien verloren. Mit 75 000 Mann wollen sie von den Wiener Höhen aus den Belagerungsring der Türken sprengen. Doch am Morgen dieses Tages ist die Kavallerie des polnischen Königs Jan Sobieski noch immer im Anmarsch durch den Wiener Wald. Niemand weiß: Kommen sie noch rechtzeitig, um die Schlacht am Kahlen Berg zugunsten der Verbündeten zu wenden? Aber auch für Kara Mustafa heißt es: Heute oder nie! Am 12. September 1683 setzt er alles auf seine Mineure. Wenn es ihnen gelingt, nur eine weitere Mine unter der Löbel-Bastei zu zünden, ist Wien sturmreif. Und fällt Wien, dann steht den Osmanen das Tor zum christlichen Abendland offen. Die Geschichte, keine Frage, hätte sich auch so ereignen können. Aber den Wienern gelingt es, die Mine zu entschärfen, und die polnische Reiterei kommt noch zur rechten Zeit. Nach der siegreichen Schlacht am Kahlen Berg ist die türkische Offensive auf dem europäischen Kontinent gestoppt. Habsburg aber wird zu einer der größten Landmächte Europas, Österreich zur Doppelmonarchie und zu einem Vielvölkerstaat, zweieinhalb Jahrhunderte lang – bis 1914. Unter den Verteidigern Wiens war der Kundschafter Georg Michaelowitz. Dem Kaiser berichtete er: „Ich war der Einzige, der sich in höchster Lebensgefahr getraute, Briefe durch das grausame Lager der Türken zu bringen.“ Er erzählt nach Augenzeugenberichten von der „Schlacht am Kahlen Berg“, vom Tag, an dem sich der Lauf der Geschichte änderte. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 16.07.2005 arte
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.