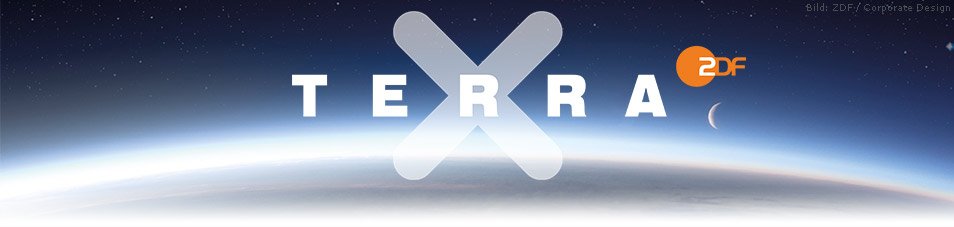1524 Folgen erfasst (Seite 50)
Sturm über Europa: 4. Die Erben des Imperiums
45 Min.Im Jahr 507 nach Christus hatten die Westgoten die Pyrenäen erreicht. Wieder einmal waren sie auf der Flucht. Schon ihre Vorfahren waren als Flüchtlinge von der Donau nach Südfrankreich gewandert. Jeder, der sich den Westgoten auf ihrer Wanderung anschloss, war ohne Ansehen von Herkunft und Abstammung als Gote willkommen. So wurden sie im Laufe ihrer Geschichte zu einem Volk vieler Völker.Über 40.000 Menschen zogen über die Pyrenäen nach Spanien. Auf der Iberischen Halbinsel suchten sie eine neue Heimat. Es war die sechste während ihrer langen Wanderschaft, überliefert die Saga der Goten. Anfang des 6. Jahrhunderts mussten die Westgoten ihr Königreich in Südfrankreich aufgeben. Von den übermächtigen Franken verdrängt, zogen sie in die einstigen römischen Provinzen Spaniens, die sie zu ihrem neuen Königreich machten. Toledo – einst das römische Toletum – wurde 550 zur „Urbs regia“, zur Stadt ihrer Könige. Fast zwei Jahrhunderte lang war Toledo Residenz der westgotischen Könige. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 24.02.2002 arte Superbauten: 1. Der Kölner Dom
45 Min.10 Milliarden Euro – so viel wurde umgerechnet für den Bau des Kölner Doms ausgegeben. Er ist damit das teuerste Bauwerk Deutschlands. Und das beliebteste ist er auch, denn in allen Umfragen rangiert der Kölner Dom als nationale Sehenswürdigkeit auf Platz 1. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 14.03.2010 ZDF Superbauten: 2. Schloss Neuschwanstein
45 Min.Es scheint einem Märchen der Gebrüder Grimm entsprungen und steckt doch bis unter die Dachzinnen voll Technik, die zum Zeitpunkt der Errichtung des Baus topmodern war. Eine Telefonanlage, eine Toilettenspülung, ein Speiseaufzug – Raffinessen, die die Menschen des 19. Jahrhunderts in Staunen versetzten. Ein Traum in weiß auf einem Bergplateau, das es bis dahin gar nicht gegeben hatte. Das gerade erfundene Dynamit sprengte eine Bergspitze ab und schuf so den Platz für die Vision eines einzige Menschen: König Ludwig II. von Bayern. Die Geschichte des Baus von Schloss Neuschwanstein ist eine Geschichte von Träumen und Illusionen, vom Sieg der Technik und vom Verlust der Macht. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 21.03.2010 ZDF Superbauten: 3. Die Dresdner Frauenkirche
45 Min.Gerade einmal 40 x 50 Meter misst der Grundriss der Dresdner Frauenkirche. Kaum mehr als manche Dorfkirche. Doch darüber erhebt sich ein architektonisches Gebilde, das die Frauenkirche zu den schönsten protestantischen Sakralbauten Europas macht. Die Kuppel der Dresdner Frauenkirche ist heute, nach dem spektakulären Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg eingestürzten Gotteshauses, ein weltweit bekanntes Symbol der Versöhnung. Und doch war sie ursprünglich nicht mehr als eine Notlösung. Ratszimmermeister George Bähr stand im 18. Jahrhundert vor einem kaum lösbaren Rätsel, als seinem Bau auf halber Strecke das Geld ausging. Die Kuppel aus Kupfer, die Bähr eigentlich als Krönung der Kirche vorgesehen hatte, war unfinanzierbar geworden.Mit seinem Alternativvorschlag stieß Bähr auf Entsetzen. Er plante eine Kuppel aus Stein. 12 000 Tonnen würden auf den Mauern lasten. Wie sollte das halten? Ein Einsturz des vollbesetzten Gotteshauses wäre eine Katastrophe gewesen. Bähr ist der einzige, der an die Standfestigkeit seiner Fundamente glaubt. Gegen alle Widerstände setzt er seine Pläne durch und behielt Recht. Seine Kuppel hielt mehr als zwei Jahrhunderte, bis der verheerende Feuersturm des alliierten Bombenangriffs auf Dresden sie am 16. Februar 1945 zum Einsturz brachte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 28.03.2010 ZDF Superbauten: 4. Wettlauf zum Himmel
45 Min.Im italienischen Mittelalter beginnt eine Bauära, in der Türme allein dem Zweck dienen, Luxus, Macht und Geld zur Schau zu stellen. In San Gimignano liefern sich vor allem die reichen Kaufmannsfamilien einen Wettkampf um den höchsten Turm der Stadt.Bild: ZDF und Jörg AdamsDer Traum vom höchsten Gebäude der Welt scheint so alt wie die Menschheit. Die Bibel erzählt vom ehrgeizigen Projekt der Babylonier, ein Bauwerk zu errichten, das den Himmel berührt. „Mit dem Turm machen wir uns einen Namen und werden berühmt“, heißt es in der Heiligen Schrift. Gott missfiel die menschliche Anmaßung, und er bestrafte die Einwohner Babylons mit der sprichwörtlichen Sprachverwirrung. Doch der menschliche Ehrgeiz ließ sich offenbar nicht zügeln. Die ersten „Hochhäuser“ entstanden vor zirka 4500 Jahren in Ägypten.Berechnet mit Winkelmaß und Senklot, gebaut aus Stein und Mörtel. 20 000 Menschen gleichzeitig arbeiteten auf der damals größten Baustelle der Welt und schufen das einzige antike Weltwunder, das heute noch existiert: die Pyramiden von Gizeh. Während die zeitgleich in Deutschland errichteten Fürstengräber aus der Bronzezeit bescheidene acht Meter hoch waren, hielten die Grabmäler der Pharaonen mit bis zu 146 Meter den Höhenrekord – bis ins 19. Jahrhundert. Im italienischen Mittelalter begann eine neue Bauära, in der Türme sich zum reinen Statussymbol entwickelten und allein dem Zweck dienten, Luxus, Macht und Geld zur Schau zu stellen. Ende des 13. Jahrhunderts entstanden die ersten Skylines. Der Handel florierte, und wer etwas auf sich hielt, baute in die Höhe. San Gimignano ist bis heute ein gut erhaltenes Zeugnis für die Blüten, die der Bauwahn der berühmtesten Familien – wie die der Ardinghelli oder Salvucci – trieb. Doch erst mit der Erfindung des Stahls erreichte der Wettlauf zum Himmel neue Dimensionen. Das veredelte Eisen ist beliebig formbar und gleichzeitig unglaublich fest, ein Material, das der Industriellen Revolution zu voller Fahrt verhalf und nicht nur die Gesellschaft grundlegend veränderte, sondern auch die Architektur. Gustave Eiffel, Franzose, Ingenieur und ein Mann mit Ambitionen, kannte sich aus mit Stahl. Viele Eisenbahnbrücken, Viadukte und Bahnhöfe hatte er bereits gebaut. Für die Weltausstellung 1884 in Paris gelang ihm der ganz große Wurf, ein neues Weltwunder sollte es werden. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 08.12.2012 ZDFneo Superbauten: 5. Säulen für die Ewigkeit
45 Min.Moschee Hassan II.: High-Tech-Gotteshaus luxuriösen Ausmaßes in Casablanca und höchstes Gotteshaus der Welt.Bild: ZDF und Torbjörn KarvangSeit die Menschen Häuser bauen, bauen sie auch Gotteshäuser – überall auf der Welt. Allein in Deutschland gibt es rund 45 000 Kirchen, das sind in etwa so viele, wie es Schulen gibt. Ein wahrer Kirchensuperbau steht in Ulm: Der Turm des Ulmer Münster misst stolze 161,53 Meter. Jahrhunderte lang war er allerdings nicht mehr als eine Bauruine. Erst wurde die Kirche wegen Geldmangels nicht fertig, dann bremste die Reformation, schließlich war die Gotik out, und am Ende bauten die Kölner auch noch höher. 1880 wird dort Einweihung gefeiert – mit Kaiserbesuch.Der Dom ist damals das höchste Gebäude der Welt. Doch Ulm zieht nach. Anders als in Köln orientieren sich die Architekten nicht an den mittelalterlichen Plänen, sondern bauen munter immer höher. Bis heute ist das Ulmer Münster die höchste Kirche der Welt. Übertroffen allein von einem High-Tech-Gotteshaus luxuriösen Ausmaßes, der Moschee Hassan II. in Casablanca. Nicht nur, dass ihr Minarett alle anderen sakralen Bauten der Welt überragt, sie ist auch flächenmäßig die eindeutige Nummer eins unter den Gotteshäusern – den Petersdom schluckt sie problemlos. Der besondere Clou ist das verschiebbare Dach; auf Knopfdruck setzen sich die 1100 Tonnen in Bewegung und öffnen sich lautlos in fünf Minuten. Damit nicht genug: Nachts schießt ein Laserstrahl aus der Spitze des Minaretts und strahlt 30 Kilometer weit gen Mekka. Doch wann hat das alles angefangen, das Bauen für die Götter? Einer der ältesten und bekanntesten Kultbauten steht in England. Stonehenge, errichtet vor zirka 5000 Jahren aus Sarsenstein, einem der schwersten Gesteine der Welt. Die Steinzeitmenschen, die vor allem Sonne und Mond verehrten, fanden einmal im Jahr zu Tausenden in Stonehenge zusammen, um das wichtigste Ereignis des Jahres zu feiern: die Sommersonnenwende. Im Unterschied zu den Naturgottheiten der alten Briten verehren Ägypter, Römer und Griechen Tausende von verschiedenen Göttern. Mit dem Judentum und dem daraus entstehenden Christentum kommt ein neuer Glaube in die Welt, der Glaube an einen einzigen Gott. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 15.12.2012 ZDFneo Superbauten: 6. Wahnsinn und Visionen
45 Min.Szene aus der Zusammenkunft des National Crime Syndicate: Mafioso Bugsy Siegel, der in Las Vegas mit seinem nagelneuen Luxus-Hotel „Flamingo“ Verlust macht, wird beschuldigt, Gelder zu veruntreuen. Wenig später ist er tot.Bild: ZDF/Torbjörn KarvangVisionäre, Künstler, Milliardäre und Diktatoren hinterlassen die wildesten, verrücktesten und wahnsinnigsten Bauten – seit Tausenden von Jahren. Antipatros von Sidon gab schon vor über 2000 Jahren einen Reiseführer mit den großartigsten Superbauten der damaligen Zeit heraus. Heute bekannt als die Weltwunder der Antike, von denen nur noch die Pyramiden zu bewundern sind. Was treibt Menschen zu diesen gigantischen Bauleistungen an? Liebe, Angst, religiöse Motive oder die pure Geltungssucht? Häufig finden sich Wahnsinn und Visionen unter den Motiven.Die Chinesische Mauer wurde im Verfolgungswahn erschaffen. Zum Schutz gegen die Nomaden aus dem Norden befiehlt der Kaiser von China, die wenig standhafte Mauer aus Lehm in eine „Große Mauer“ aus Stein zu verwandeln. Es wird das größte Bauwerk der Welt, das nach Angaben der Chinesen insgesamt 21 196 Kilometer misst. Die Bauarbeiten an dem Mammutprojekt dauern etwa 2000 Jahre, stürzen die Dynastie beinahe in den Bankrott und kosten schätzungsweise 250 000 Arbeiter das Leben. Sicherheitsdenken und Verteidigungswahn lassen auch die Deutschen dicke Mauern bauen. Würde man hierzulande alle Burgmauern aneinanderhängen, käme man auf mehrere tausend Kilometer. Mehr als 20 000 Burgen muss es in Deutschland im Mittelalter gegeben haben, vor allem Trutz- und Zollburgen. Eine der schicksten thront heute noch hoch über dem Rhein und demonstriert Macht und Stärke: die Marksburg. Noch im 19. Jahrhundert dienen Burgen als Vorlage für die Wünsche von Monarchen, wie Schloss Neuschwanstein, für das sich Ludwig II. heillos verschuldete. Ein zwar kleineres, aber noch viel fantastischeres Traumschloss baute sich der französische Postbote Ferdinand Cheval. Auf seinen Postrunden sammelt er kleine Steine, jeden Tag, ein Leben lang – und baut daraus sein „Palais Idéal“, das aussieht, als sei es einem surrealistischen Gemälde entsprungen. Die Träume mancher Visionäre ließen sogar ganze Städte erstehen: Venedig, La Serenissima, eine Stadt im Wasser, errichtet auf Millionen von Holzpfählen in einer flachen Lagune. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 22.12.2012 ZDFneo Supercodes – Die geheimen Formeln der Natur: 1. Bauplan der Erde
45 Min.Die Welt, die uns umgibt, funktioniert perfekt. Alles scheint aufeinander abgestimmt und folgt universellen Regeln. Seit Menschengedenken versucht man, sie zu verstehen und zu entschlüsseln. In der zweiteiligen „Terra X“-Dokumentation „Supercodes – Die geheimen Formeln der Natur“ begibt sich Harald Lesch auf die Suche nach den unsichtbaren Gesetzen, die unsere Welt zusammenhalten – und wird fündig. Die Mathematik hilft ihm dabei. Auf einmal erkennen wir, warum Früchte häufig kugelrund sind, was Kängurus und Brücken gemeinsam haben oder wo der Zusammenhang zwischen Schneeflocken und sparsamen Autos ist.Warum Musik eigentlich Mathematik ist und was Wettervorhersagen mit Glücksspiel zu tun haben. Tatsache ist, die Welt um uns herum, ihre Formen, Muster und Strukturen, existieren nicht zufällig. Sie folgen der Macht universeller Codes, die in der Natur verborgen sind. Bei seiner Suche nach diesen Gesetzmäßigkeiten stößt der Physiker und Naturphilosoph Prof. Dr. Harald Lesch auf erstaunliche Zusammenhänge, faszinierende Naturwunder und Sternstunden der Geschichte, in denen Menschen oft eher zufällig Entdeckungen machten oder Ideen hatten, die unser Leben und Denken für immer verändert haben. Dem Zweiteiler gelingt es durch die eindrücklichen Moderationen von Harald Lesch, durch CGI, Spielszenen, Graphic Novels und durch große dokumentarische Bilder, die vermeintlich komplizierten Formeln und Gleichungen auch für Feinde der Mathematik nachvollziehbar zu machen und so naturwissenschaftlich Aufklärung zu betreiben, die Spaß macht. Denn was die Welt im Innersten zusammenhält – hier wird es sichtbar. Harald Leschs Begeisterung für das Thema spiegelt sich in den Filmen – und es darf gestaunt werden, wie logisch und raffiniert die Natur das meiste eingerichtet hat. Und warum es sich lohnt, all das zu begreifen: Denn letztlich ist der Mensch auch ein Teil des großen Ganzen, das nur bewahrt werden kann, wenn es verstanden wird. Die Natur ist der größte Lehrmeister, der knallhart aussortiert, was sich nicht bewährt. Wirklich lang bleiben nur echte Gewinner. Von der Natur lernen heißt also, siegen lernen: Immer wenn es in der Geschichte gelungen ist, ein Element aus dem Bauplan der Natur zu berechnen, war das ein Garant für Fortschritt. Doch dafür muss genau hingeschaut werden. Die vielleicht berühmteste universelle Logik, die Fibonaccifolge, entdeckt der italienische Mathematiker Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci, im frühen 13. Jahrhundert. Die Zahlenfolge ergibt sich ausgehend von den natürlichen Zahlen 1 und 2 durch Addieren der beiden vorausgegangenen Zahlen: 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5 und so weiter. Fibonaccis Fund ist eine folgenschwere Entdeckung. Die Formel ist so etwas wie der kosmische Bauplan der Natur. Unzählige natürliche Phänomene folgen ihr – und werden plötzlich verständlich. Warum wachsen Pflanzen so, wie sie es tun – oder was haben wir Menschen mit dem lebenden Fossil Nautilus gemein? Aber nicht nur die Fibonaccifolge, auch die unendliche Konstante Pi, als Kreiszahl bekannt, das Hexagon, das sich nicht nur die Bienen zunutze gemacht haben, die Kugel oder die Parabel sorgen dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Nämlich nahezu perfekt. Übertragen in unseren Alltag leisten diese Formen und Formeln erstaunliche Dienste: Waben aus Kunststoff sorgen vielleicht schon bald für umweltschonendere Autos, der Einsatz von Parabeln ermöglicht stabile Bauwerke, und die Kenntnis von Fraktalen könnte der Forschung helfen, Korallenriffe zu retten. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 28.04.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 02.05.2021 ZDF Supercodes – Die geheimen Formeln der Natur: 2. Unsichtbare Kräfte
45 Min.Die Welt, die uns umgibt, funktioniert perfekt. Alles scheint aufeinander abgestimmt und folgt universellen Regeln. Seit Menschengedenken versuchen wir, sie zu verstehen und zu entschlüsseln. In der zweiteiligen „Terra X“-Dokumentation „Supercodes – Die geheimen Formeln der Natur“ begibt sich Harald Lesch auf die Suche nach den unsichtbaren Gesetzen, die unsere Welt zusammenhalten – und wird fündig. Die Mathematik hilft ihm dabei. Unsichtbare Kräfte und Phänomene sorgen dafür, dass die Welt nicht aus dem Takt gerät. Kluge Köpfe haben im Lauf der Jahrhunderte mit ihrer Beobachtungsgabe und ihrem Verstand viele dieser Kräfte entschlüsselt und sie für alle verständlicher und berechenbarer gemacht.Oft ist es die Mathematik, die hilft, das Unsichtbare sichtbar zu machen: Auf einmal erkennen wir, was Wettervorhersagen mit Glücksspiel zu tun haben, Hollywood mit Vogelschwärmen oder ein fallender Apfel mit der Abwehr von Asteroiden. Isaac Newton ist im 17. Jahrhunderts der Erste, der physikalisch erklären kann, warum ein Apfel auf den Boden fällt, und zwar senkrecht nach unten in Richtung Erdmittelpunkt, weil – so die bahnbrechende Erkenntnis – die Erde den Apfel anzieht. Newton nennt diese dominante Kraft unseres Universums Gravitation. Ohne sie gäbe es keine Galaxien. Nur dank ihr bilden sich aus Gas und Staubteilchen Sterne und Planeten. Sie hält das Universum zusammen und die Menschen auf der Erde. Das Wissen um sie hilft heute sogar, Asteroiden abzuwehren. Newton, Euler, Lorenz und all den anderen, die sich ihre Köpfe über Naturgesetze und Gesetzmäßigkeiten zerbrochen haben, können wir gar nicht genug danken. Denn nur wenn wir etwas Theoretisches begreifen und lernen, es in der Praxis anzuwenden, gibt es gesellschaftlichen Fortschritt. Wer sich hingegen nicht immer wieder hinterfragt und aufs Neue organisiert, der wird abgehängt – das gilt nicht nur für die Natur, sondern auch für Gesellschaft und Wissenschaft. Interessanterweise gehen aber weder die Natur noch die Forscher immer den direkten Weg. Viele Gelehrte haben sich mit etwas anderem beschäftigt und quasi nebenbei etwas Weltbewegendes entdeckt. So auch Leonhard Euler, der das exponentielle Wachstum berechnete, oder Edward Lorenz, dem wir die Chaostheorie verdanken. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 28.04.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 09.05.2021 ZDF Superhelden: 1. Odysseus
„Terra X – Superhelden“ führt in die mythische Welt berühmter Heroen. Diese Folge erzählt vom listenreichen Odysseus, der beliebtesten Sagenfigur der griechischen Antike. Odysseus muss auf einer langen Irrfahrt mächtigen Göttern, gewaltigen Naturereignissen und Ungeheuern trotzen. Die Abenteuer, die der Held erlebt, sind aber mehr als pure Erfindung. Sie spiegeln die spannende Epoche der griechischen Entdeckungsfahrten im Mittelmeer. Die „Odyssee“ stammt aus der Feder des griechischen Dichters Homer. In 24 Gesängen schildert er die phantastische Irrfahrt von Odysseus, dem König von Ithaka, der nach dem Sieg über Troja die Heimkehr antritt.Zehn Jahre dauert die Reise. Da er es sich mit den Göttern verscherzt hat, unterziehen sie ihn lebensbedrohlichen Prüfungen. Sie schicken ihn zu einem menschenfressenden Ungeheuer, ins Totenreich, treiben ihn mit den Klängen der Sirenen fast in den Wahnsinn, lassen heftige Stürme aufkommen, die ihn ständig vom Kurs abbringen, machen ihn jahrelang zum Zwangsgeliebten einer Göttin und vieles mehr. Mit 500 Mann sticht der Held in See, als einziger Überlebender kommt er zu Hause an. Der Film zeigt, wie präzise Homer am Bild seines Helden Odysseus gearbeitet hat. Der Dichter entwirft einen völlig neuen Typus des mannhaften Helden, der bis heute Gültigkeit hat: Selbst in schwierigsten Situationen handelt Odysseus besonnen, geduldig und klug. Jeden Schicksalsschlag wendet er zum Guten, lässt sich niemals unterkriegen, lernt aus seinen Fehlern und setzt auf List und Strategie statt auf Gewalt. Odysseus ist ein Held, der den Herausforderungen einer neuen Ära genügen muss, die Homer im Blick hat. Im 8. Jahrhundert vor Christus, als der Dichter die „Odyssee“ verfasst, erleben die Griechen einen wirtschaftlichen Aufschwung. Das zerklüftete Hinterland mit seinen engen und schroffen Tälern bietet aber nicht genügend landwirtschaftliche Nutzflächen für alle. Daher weichen die meisten Bauern und Viehzüchter in die schmalen, aber fruchtbaren Küstengebiete rund um die Ägäis aus. Überbevölkerung ist die Folge. Es kommt zu Unruhen und Krisen und zu dem Entschluss, neue Siedlungsräume zu erkunden. In der Regel sind es junge Männer, die unter der Führung eines reichen Aristokraten in die Welt hinausziehen. Als große griechische Kolonisation gehen die Erkundungsfahrten in die Geschichte ein. Die Auswanderer entdecken den für sie bis dahin unbekannten Westen des Mittelmeers mit Italien, Sizilien, Frankreich und Spanien. Sie leiden Entbehrungen, müssen mit Naturkatastrophen fertigwerden, das unberechenbare Meer beherrschen und vor feindlich gesinnten Völkern fliehen. Wo sie freundlich aufgenommen werden, gründen die Griechen Kolonien wie Marseille oder Syrakus, die schon bald reicher und schöner sind als die Heimatstädte im Mutterland. Für den großen Aufbruch hat Homer die literarische Blaupause geschrieben, wie Wissenschaftler sagen. Somit ist die „Odyssee“ nicht nur pure Fiktion, sondern auch ein Dokument über die Vorstellungswelt der Griechen und über ihr gebündeltes geografisches sowie nautisches Wissen zu Homers Zeit. Die ewige Frage, ob sich hinter den mythischen Helden historische Vorbilder verbergen, stellt sich auch bei Odysseus. Die meisten Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass der König von Ithaka keine Persönlichkeit der Geschichte ist, sondern einen idealen Anführer oder König verkörpert. Trotzdem versuchen einige Forscher zu beweisen, dass es ihn tatsächlich gegeben hat. Eine Spur führt auf die ionische Insel Kefalonia. Vor einigen Jahren haben Archäologen dort ein Grabmal und einen Siegelstein entdeckt, auf dem ein Hund mit Rehkalb abgebildet ist. Der Fund gilt als Sensation, denn Homer beschreibt das Motiv im 19. Gesang als königliches Familienwappen des Odysseus. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 17.02.2018 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 18.02.2018 ZDF Superhelden: 2. Beowulf
Diese Folge der „Terra X“-Reihe „Superhelden“ erzählt die Geschichte des nordgermanischen Helden Beowulf, der mit grenzenlosem Mut und übermenschlicher Kraft unheimliche Wesen bekämpft. Das Beowulf-Epos gehört zu den berühmtesten Dichtungen aus dem alten England. Hinter der Sage über Heldenmut und Monster verbirgt sich die Geschichte der Angelsachsen, die nach Britannien auswandern und dort die ersten Königreiche gründen. Es ist ein unbekannter christlicher Dichter, der die Heldentaten des Beowulf irgendwo im angelsächsischen England zwischen dem 7. und 9. Jahrhundert verfasst hat.Das Werk gilt heute als eines der bedeutendsten und einflussreichsten Werke der englischen Literatur. Die Geschichte vereint alle Elemente eines modernen Action-Stoffs. Auch der legendäre Schriftsteller und Literaturprofessor J.R.R. Tolkien war von dem Heldengedicht fasziniert und nutzte es als Inspiration für seine berühmten Mittelerde-Romane. Nur durch ein einziges Manuskript ist das Beowulf-Epos überliefert – in der Nationalbibliothek in London wird es gehütet wie ein Schatz. Die Geschichte von Beowulf und seinen sagenhaften Taten beginnt im Dänemark des 6. Jahrhunderts, im Reich des legendären König Hrothgar, einem Nachfahren des germanischen Gottes Odin. Er hat eine prunkvolle Festhalle errichten lassen, „Heorot“ genannt. Sie ist Regierungssitz, Gerichtssaal und Festhalle für die Gemeinschaft. Die fröhlichen Feiern der Dänen erwecken den Unmut eines blutrünstigen Trolls, der in den nahe liegenden Sumpfgebieten haust. Zwölf Jahre hält das Monster das Land fest in seinem Griff. Es tötet alle Krieger, die es wagen, die Halle zu betreten. Keiner traut sich, sich ihm entgegenzustellen. Bis Beowulf eintrifft, der junge, selbstbewusste Krieger vom Volk der Geatas, der Gauten. Er will König Hrothgar helfen und sein Reich von dem schrecklichen Scheusal befreien. Das Beowulf-Epos wird zu einer Zeit des Umbruchs niedergeschrieben. Ab dem 5. Jahrhundert wandern Angeln, Sachsen und Jüten im Zuge der Völkerwanderung in Britannien ein. Sie kommen aus Skandinavien und dem Norden Deutschlands. Nachdem die Römer das Land verlassen haben, herrscht dort für lange Zeit eine Art Machtvakuum. Die Neuankömmlinge – später Angelsachsen genannt – gründen bald ihre eigenen Königreiche. Auch wenn sie sich irgendwann dem christlichen Glauben öffnen, bleiben sie ihrer heidnischen Kultur und ihren Mythen lange verbunden. Das Beowulf-Epos erzählt davon. Über seine literarische Bedeutung hinweg vermittelt das Werk Einblicke in das altgermanische und frühe englische Leben. In Dänemark und Großbritannien begibt sich die Dokumentation auf die Spuren der angelsächsischen Geschichte, zeigt spektakuläre archäologische Funde und berichtet über aktuelle Erkenntnisse. Im dänischen Lejre haben Archäologen Überreste einer alten Königshalle gefunden, die in vielem den Beschreibungen der legendären Heorot-Halle in „Beowulf“ entspricht. In England hat man spektakuläre Grabbeigaben und vergrabene Schätze entdeckt, die an Schilderungen über Bestattungsrituale im Epos erinnern. Dänische, englische und deutsche Wissenschaftler helfen bei der Einordnung des historischen Kontexts und zeichnen ein lebendiges Bild des Lebens und der Glaubenswelt im angelsächsischen England. Sie zeigen: Das Beowulf-Epos ist eine Heldengeschichte, die auch nach über 1000 Jahren nichts von ihrer Kraft verloren hat. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 24.02.2018 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 25.02.2018 ZDF Superhelden: 3. Parzival
45 Min.Diese Folge der „Terra X“-Reihe „Superhelden“ erzählt von den Abenteuern des naiven Helden Parzival, der auserwählt ist, neuer König der geheimnisvollen Gralsgesellschaft zu werden. Der Roman über den unbedarften Helden Parzival, der erst lernen muss, einer zu sein, spielt in der gewaltsamen Welt der Ritter. Das Werk ist die humorvolle wie tiefsinnige Antwort auf die verheerenden Verhältnisse im Römisch-Deutschen Reich zur Zeit der Kreuzzüge. Wolfram von Eschenbach hat den Ritterroman über den „tumben Thor“ Parzival um 1200 verfasst.Er ist zwar nicht der Erfinder der Figur – das war der Franzose Chrétien de Troyes -, aber er hat die Geschichte des schönen, aber unbesonnenen Helden weitergesponnen und zu einem Bestseller gemacht. Mit fast 25 000 Versen ist der „Parzival“ das längste deutsche Erzählwerk seiner Zeit, mit über 100 Abschriften auch eines der beliebtesten im Mittelalter. Das liegt vor allem an den Themen, die der Dichter anspricht: Wolfram von Eschenbach geht es um ritterliche Wertvorstellungen, vorbildliche Herrscher und um die für ihn wichtigste christliche Tugend – Mitgefühl. Parzivals Abenteuer beginnen mit seinem Entschluss, Ritter von König Artus und seiner Tafelrunde zu werden. König Artus und seine Getreuen verkörpern im Mittelalter das ideale höfische Rittertum. Sie kämpfen für Kirche und Vaterland, beschützen die Schwachen und sorgen für die öffentliche Sicherheit. Im „Parzival“ aber hat der Vorzeige-Hof seinen guten Ruf verspielt. Es herrscht Chaos und Streit, selbst der gerechte Artus handelt aus Willkür und Selbstsucht. Das Gegenmodell zum höfischen Rittertum der Artusrunde ist die geheimnisvolle Gralsgesellschaft. Ihre Regeln gibt der Gral vor. Sie sind so streng und starr, dass kein Mensch sie einhalten kann. Im Roman ist es der Gralskönig, der versagt und damit den Fortbestand der Gesellschaft in Gefahr bringt. Wolfram von Eschenbach entwirft die religiöse Gemeinschaft nach dem Vorbild der christlichen Ritterorden. Sie entstehen zur Zeit der Kreuzzüge. Im Namen Gottes ziehen sie als Soldaten Christi ins Heilige Land gegen die Muslime. Aber nicht nur die heilige Sache treibt die Ritter in den Kampf, sondern auch die Aussicht auf reiche Beute und Herrschaftsgebiete im Orient. Wer sich hinter der Gralsgesellschaft und ihrem Anführer Anfortas verbergen könnte, versucht der Film aufzuzeigen. Die Spur führt nach Spanien und zu den Tempelrittern, die nicht nur im Zusammenhang mit der Legende um den Heiligen Gral, sondern auch bei der Rückeroberung der von Muslimen besetzten Gebiete Spaniens eine wesentliche Rolle gespielt haben. Im Roman lernt Parzival beide Ritterwelten kennen. Er, der nichts von höfischen Sitten, ritterlichen Idealen und den Lehren der Kirche weiß und sie erst mühsam kennenlernen muss, wird nach harten Prüfungen schließlich zum Hoffnungsträger der christlichen Gesellschaft. Mit einer einzigen Heldentat, die darin besteht, menschliches Mitgefühl zu zeigen, kann er die Gemeinschaft vom Leid erlösen. Die Geschichte spiegelt die Ordnung in Europa um 1200 wider, mit all seinen Werten, Tugenden und Vorstellungen, aber auch Konflikten, Kriegen und Fehden. In einer Zeit des Umbruchs ist der Roman nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Ereignissen jener Epoche, sondern auch die Suche nach einem neuen Selbstverständnis des Ritterstands. Als Wolfram von Eschenbach seinen Roman vollendet, sind die Kreuzzüge im Heiligen Land gescheitert, der deutsche Thronstreit im Römisch-Deutschen Reich ist gerade zu Ende. Die Menschen wünschen sich Frieden und Sicherheit. Parzival erfüllt die Sehnsucht nach einem Friedensstifter – das macht ihn zum Publikumsliebling im Mittelalter und darüber hinaus. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 04.03.2018 ZDF Deutsche Streaming-Premiere So. 04.03.2018 ZDFmediathek (ab 19:30 Uhr) Superpflanzen
45 Min.Wer glaubt, dass Grünzeug still und stumm vor sich hin vegetiert, der irrt. In der Welt der Pflanzen geht es ebenso aggressiv, liebevoll und gefährlich zu wie in der Tierwelt. Pflanzen haben Gefühle, stehen auf Musik, behängen sich mit „Leberwürsten“ und können sogar zu Giftmischern werden. Aufwändigste Filmmethoden wie Extrem-Zeitraffer und Makroaufnahmen geben faszinierende und neue Einblicke in das Universum der Pflanzen. Mit „Superpflanzen“ nimmt Dirk Steffens die Zuschauer mit in das Wunderreich der Pflanzen. Da finden sich anmutige Überlebenskünstler – wie Kakteen, die nur ein einziges Mal im Jahr, nur bei Vollmond, blühen oder auch Pflanzen, die als Mitwohnzentralen Tieren Schutz und Heimat bieten.Um sich vor Fressfeinden zu schützen, ziehen sich einige Pflanzen perfekte Tarnkleider an und werden nahezu unsichtbar in ihrer Umwelt. Der Palmengarten Frankfurt ist der Ausgangspunkt von Dirk Steffens’ Reise zu den Superpflanzen. Der Botanische Garten ist der größte Palmengarten Deutschlands und beherbergt über 14.000 Exemplare verschiedenster Pflanzen. Darunter findet sich auch ein absoluter Rekordhalter: Die Titanwurz produziert – nur alle sieben Jahre – die größte Blüte überhaupt. Durch ihre Größe wird sie von Insekten von Weitem geortet. Nach zwei Tagen ist der Zauber vorbei, und sie schließt ihre atemberaubende Blüte wieder. Diesem und anderen Spektakeln begegnet Dirk Steffens im Palmengarten Frankfurt. Das Format lebt von dem Wechsel unterhaltsamer wie erkenntnisreicher Moderationen und Pflanzenaufnahmen aus der ganzen Welt. Wie bei der „Terra X“-Reihe „Supertiere – mit Dirk Steffens“ schaffen auch bei diesem Format Animationen in den Moderationen eine zusätzliche Erklärebene, die hin und wieder auch ein Augenzwinkern erlauben. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 20.04.2014 ZDF Supertalent Mensch: 1. Körperbeherrscher
Vier Menschen gehen ans Limit des körperlich Leistbaren. Herbert Nitsch ist der erfolgreichste Apnoetaucher aller Zeiten. Der Österreicher hat 31 Weltrekorde aufgestellt: Niemand kann unter Wasser länger die Luft anhalten, und keiner taucht tiefer als er. 214 Meter hat Herbert Nitsch geschafft, mit nur einem Atemzug. Nach einem schweren Unfall kämpft er sich zurück ins Leben – doch die Tiefe lässt ihn nicht los. Wim Hof meditiert im Eis und geht halb nackt in der Arktis spazieren. Kälte scheint ihm nichts auszumachen. „Der Eismann“ – so nennt er sich selbst.Ines Papert ist viermalige Weltmeisterin im Eisklettern. Gipfel ziehen sie magisch an. Scheinen sie unbezwingbar – umso besser. „Terra X“ begleitet sie bei einem besonderen Projekt: einer Erstbegehung in den Dolomiten. Daniel Kish verlor sein Augenlicht kurz nach der Geburt. Er ist blind, und doch lebt er heute beinahe wie ein Sehender. Er reist durch die Welt, wandert und fährt Fahrrad. Dabei hilft ihm eine verborgene Fähigkeit unseres Körpers. Daniel Kish sieht mit den Ohren – fast wie eine Fledermaus. Sie alle beherrschen ihren Körper in außergewöhnlicher Weise. „Terra X“ porträtiert diese „Supertalente“ – und fragt nach den Hintergründen: Welche wissenschaftlichen Erklärungen gibt es für die außerordentlichen Leistungen? Und was können wir alle tun, um unsere verborgenen Kräfte zu mobilisieren? Denn auch die Supertalente sind – eigentlich – ganz normale Menschen. Sie zeigen das erstaunliche Potential, das in uns allen steckt. Was ist uns in die Wiege gelegt, was können wir erlernen? Und wo liegen die Grenzen unseres Körpers? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 06.12.2014 ZDFneo Supertalent Mensch: 2. Geistesgiganten
Sechs Menschen beweisen höchst außergewöhnliche Sinnes- und Geistesfähigkeiten: In schwindelerregender Höhe balanciert Lukas Irmler über dem Abgrund. Auf der Slackline, einem schwankenden Seil, gehört er zu den Besten der Welt. Doch wie überwindet er seine Höhenangst? Im Alter von fünf Jahren trat Shi Yan Yao in das Shaolinkloster ein. Sein ganzes Leben hat er der Meditation und der Kampfkunst gewidmet. Seine Körperbeherrschung scheint keine Grenzen zu kennen. Gert Mittring und Rüdiger Gamm sind so etwas wie menschliche Taschenrechner. Egal ob Wurzeln oder Potenzen – die kompliziertesten Aufgaben lösen sie in Rekordzeit ohne jedes Hilfsmittel.Derek Paravicini ist ein Savant. Er zeigt uns, wozu das menschliche Gehirn in der Lage ist: Musik ist seine Welt. Wenn er ein Lied nur einmal hört, spielt er es auf dem Klavier nach. 12 000 Musikstücke kann er auswendig. Der Umgang mit anderen Menschen dagegen bringt ihn an seine Grenzen. Emotionen und soziale Regeln sind dem Autisten fremd. Ganz anders Jan Becker: Er liest in seinen Mitmenschen wie in einem Buch. Jan Becker bezeichnet sich selbst als menschlichen Lügendetektor. Wie macht er das – und kann er wirklich Gedanken lesen? „Terra X“ porträtiert diese „Supertalente“ – und sucht nach den Hintergründen der außerordentlichen Leistungen. Wie kann sich unser Hirn Zahlen mit 200 Stellen hinter dem Komma merken, und welche Kräfte werden frei, wenn wir meditieren? Wissenschaftler versuchen, die Geheimnisse der Geistesgiganten zu entschlüsseln – und helfen uns so dabei, unsere eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Denn: Die Geistesgiganten sind Supertalente, und im Übrigen ganz normale Menschen. Sie zeigen das erstaunliche Potential, das vielleicht in uns allen steckt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 06.12.2014 ZDFneo Supertalent Mensch II: 1. Die Grenzgänger
Der menschliche Körper ist zu verblüffenden Leistungen fähig. „Terra X“ zeigt ungewöhnliche Menschen, die ans Limit gehen und fragt, ob solche Talente in jedem von uns schlummern. Sie fliegen wie Vögel durch die Lüfte, surfen auf 20 Meter hohen Wellen, werden steinalt oder vertragen Strom. Es scheint fast so, als mobilisierten Supertalente schier unerklärliche Kräfte. Doch hinter jeder Leistung steckt eine wissenschaftliche Erklärung. Wenn Halvor Angvik die Berge hochsteigt, hat er kaum einen Blick für die Aussicht. Denn er will eigentlich nur hinunterspringen. Halvor Angvik ist Wingsuit-Jumper.In einer Art Fledermaus-Anzug gleitet er durch die Lüfte und wird dabei 200 km/h schnell. Ein kleiner Fehler könnte ihn das Leben kosten. Nicht weniger wagemutig ist der Nürnberger Sebastian Steudtner. Vor 20 Meter hohen Brechern kennt er keine Angst. Steudtner ist Big-Wave-Surfer und reitet Wellen, die sich zu Wassermonstern auftürmen. Er ist der einzige Deutsche, der es in die Welt-Elite geschafft hat. Zwei Mal gewann er schon den Surf-Oscar für die höchste Welle des Jahres. Doch um Preise geht es ihm nicht. Sein Ziel ist, die größte Welle der Welt zu reiten. Etwas ruhiger gehen es die Bewohner einer Bergregion auf Sardinien an. Trotzdem brechen sie sämtliche Rekorde: Das sardische Bergvolk wird steinalt. 100-Jährige sind in der Provinz Nuoro keine Seltenheit. Doch warum überschreiten sie alle Altersgrenzen? Wissenschaftler suchen seit Jahren nach dem Geheimnis des langen Lebens auf Sardinien und kommen ihm Schritt für Schritt auf die Spur. Was andere tötet, macht Biba Struja nichts aus. Der Serbe ist immun gegen Strom. Seit 30 Jahren experimentiert er mit bloßen Händen mit der tödlichen Gefahr und hat bis heute keinen einzigen Kratzer. Doch wie macht er das? Ein Trick oder eine seltene Begabung? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 27.12.2015 ZDF Supertalent Mensch II: 2. Die Superhirne
45 Min.Das menschliche Gehirn kann verblüffende Anforderungen meistern. „Terra X“ zeigt Menschen, die geistige Höchstleistungen bringen und fragt, ob solche Talente in jedem von uns schlummern. Sie sprechen weit über 20 Sprachen, lösen Zauberwürfel innerhalb von Sekunden, spielen Blindschach oder können nach einem Unfall plötzlich perfekt Klavierspielen. Die Supertalente zeigen, dass unser Gehirn zu viel mehr fähig ist, als wir heute erahnen. Die Zwillinge Michael und Matthew Youlden sind echte Multisprachler. Beide beherrschen mehr als 20 Sprachen, die meisten davon fließend.Darunter auch seltene Sprachen wie Kornish, Katalanisch oder Papiamentu. Und lernen sie in atemberaubender Zeit. Sieben Tage brauchen sie, um in einer neuen Sprache im Alltag durchzukommen. „Terra X“ schickt die Zwillinge auf Sprachreise und zeigt, wie jeder ganz einfach eine neue Sprache lernen kann. Sebastian und Philipp Weyer sind auch Zwillinge und halten gleich mehrere Rekorde. Ihre Spezialität ist der legendäre Zauberwürfel. Die Zwillinge brauchen kaum mehr als sechs Sekunden, um die bunten Farben des Rubik’s Cube richtig zu ordnen. Doch welche Leistung steckt dahinter? Sind sie einfach nur Mathegenies oder aber ist es ein anderes Talent, das sie zu wahren Meistern in dieser Disziplin macht? Elisabeth Sulsers Leben ist ebenfalls sehr bunt. Wenn sie Töne hört, sieht sie Farben. Ein G ist blau, das C rot, ein D ist gelb. Gleichzeitig kann sie die Musik schmecken – salzig, sauer, süß und bitter. Die Schweizerin ist eine so genannte Synästhetin und weltweit ein ganz besonderer Fall. Sie ist die einzig bekannte Person mit diesen Formen der Doppelwahrnehmung. Der Pianist Derek Amato sieht auch, was andere nicht wahrnehmen. Permanent kreisen in seinem Kopf schwarze und weiße Kästchen voll von verschiedenen Tönen und Instrumenten. Sie sagen ihm, was er auf dem Klavier spielen soll. Dabei hatte der Amerikaner mit Musik nie viel am Hut. Erst nach einem Unfall mit einer schweren Gehirnerschütterung konnte er plötzlich perfekt Klavier spielen. Vincent Keymer und Marc Lang sind Schachexperten der besonderen Sorte. Vincent Keymer ist erst elf Jahre alt, spielt aber schon Schach wie die Großen. Im Alter von fünf Jahren fegt er seine Eltern vom Brett, mit neun Jahren schlägt er zum ersten Mal einen ukrainischen Großmeister und mit zehn wird er mit der deutschen Jugendnationalmannschaft Europameister. Marc Lang hat gegen Vincent keine Chance, obwohl er 35 Jahre mehr Schacherfahrung auf dem Buckel hat. Führend ist er aber in einer ganz besonderen Form des Spiels: Blindsimultanschach. Das heißt: Er muss das Spielbrett gar nicht sehen, um den Gegner schachmatt zu setzen. Er spielt aus dem Gedächtnis heraus und am liebsten gegen mehrere Spieler. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 03.01.2016 ZDF Supertiere: 01. Die Starken
45 Min.Lassie und Flipper, Ratatouille oder Happy Feet – in der Welt der Kinderfilme gibt es keine Hürde, die für Tiere zu hoch ist. Aber ist das alles nur Fiktion? Tatsächlich wimmelt es im Tierreich von ungewöhnlichen Fähigkeiten. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 31.10.2010 ZDF Supertiere: 02. Die Cleveren
45 Min.Deutsche TV-Premiere So. 07.11.2010 ZDF Supertiere: 03. Wilde Liebe
45 Min.In der ersten Folge des neuen Zweiteilers von „Terra X – Supertiere“ ist Moderator Dirk Steffens in Sachen Liebe unterwegs – im Tierreich. Wie die verschiedensten Fell- und Federträger ihre Dates arrangieren und beim anderen Geschlecht punkten, das ist Gegenstand des ersten Teils „Wilde Liebe“. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 22.01.2012 ZDF Supertiere: 04. Wilder Kindergarten
45 Min.Auch im zweiten Teil der neuen Staffel von „Terra X – Supertiere“ wagt Moderator Dirk Steffens indiskrete Blicke ins Familienleben der Tiere. Diesmal nimmt er sich die Eltern und ihren Nachwuchs vor. Welche Mühen viele Tiere auf sich nehmen, welche Tricks und Methoden sie anwenden, um ihren Nachwuchs aufzuziehen, das ist Thema in der Folge „Wilder Kindergarten“. Dabei erinnert so manches an menschliche Verhältnisse. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 29.01.2012 ZDF Supertiere: 05. Dicke Freunde
45 Min.Wir Menschen tummeln uns gern in Gesellschaft. Auch im Tierreich gibt es Partnerschaften und Wohngemeinschaften, die nicht nur der Fortpflanzung der eigenen Spezies dienen. Wenn Vögel sich zusammentun, dann rauschen sie schon mal als Millionengeschwader durch die Lüfte. Denn: Wo der Einzelne mit Pauken und Trompeten untergehen würde, schafft die Gemeinschaft schier Übertierisches. Es gibt aber auch Bedingungen, unter denen sich die seltsamsten Duos zusammentun und sogar aus Feinden die besten Freunde werden können.Es ist überraschend, welch spannende Beziehungen, kuriose Wohngemeinschaften oder liebevolle Hingabe bei Tieren zu finden ist. Kommunikation ist die Grundvoraussetzung, um miteinander zu agieren. Denn erst dann kann die Macht der Gemeinschaft richtig zum Tragen kommen, und die ist beim Tier wie beim Menschen überlebenswichtig. Affendame Sina ist der Stargast im nächtlichen Senckenberg Museum. Schimpansen sind dem Menschen im Sozialverhalten sehr ähnlich. Sie kommunizieren untereinander und haben Laute und Namen für Artgenossen und Nahrung. Per Sprachcomputer oder Zeichensprache schaffen es manche Affen, über 1000 Worte zu erlernen. Und Verstehen können sie sogar deutlich mehr. Viele Tiere haben noch ausgefeiltere Arten der Kommunikation, wie etwa die Sepien. Ihre Sprache funktioniert rein optisch. Mit ihrer Haut können sie binnen Bruchteilen von Sekunden komplexe Farbmuster abspielen. Meist wird nur die dem anderen zugewandte Seite gefärbt. Selbst geflirtet wird einseitig. Das Farbspiel funktioniert über Melanophoren, Farbzellen in der Haut, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können. Und die hochentwickelten Augen des Gegenübers verstehen die Botschaft sofort. Meist sind es ganz handfeste Gründe, die die Tiere zueinanderfinden lassen: Essen oder Sex. Oder steckt doch noch etwas anderes dahinter? Freundschaft vielleicht? Ein Gefühl, zu dem Tiere nach Ansicht vieler Wissenschaftler nicht fähig sind. Jeder Hunde- oder Katzenbesitzer wird da etwas ganz anderes erzählen. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 13.01.2013 ZDF Supertiere: 06. Die Scharfsinnigen
45 Min.Hören, Sehen, Riechen, Tasten und Schmecken: Wir Menschen schlagen uns mit unseren fünf Sinnen ganz gut durchs Leben. Manche Tiere haben aber weit mehr drauf. Mit dem fünften oder sechsten Sinn ist bei ihnen die Fahnenstange längst nicht erreicht. Sie verfügen über Sinnesorgane, die uns gänzlich fehlen. Sie können damit eine Welt erfassen, die außerhalb unserer Wahrnehmung liegt. So können sich einige Schlangen mit ihrem Grubenorgan, das ähnlich wie eine Wärmebildkamera funktioniert, auch im Dunklen perfekt zurechtfinden.Elefanten kommunizieren mit ihren Füßen über Infraschall und das Chamäleon hat mit seinen Augen einen fantastischen Rundumblick von über 280 Grad. Was in den gemeinsamen Fokus der Augen gerät, hat praktisch keine Chance zu entkommen. Mit ihren Super-Sinnen sind die Tiere zu Höchstleistungen fähig. Die zweite Folge erzählt auch von der abenteuerlichen Reise einer Walmutter mit ihrem neugeborenen Kind. Über Tausende von Kilometern navigiert die Riesin ihr Junges zielsicher durch die Weiten der Meere. Die Überflieger der Lüfte sind die Kraniche – dank ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten überwinden sie im Schwarm das höchste Gebirge der Welt – den Himalaya. Auch Gustav, der Storch, der Moderator Dirk Steffens bei dieser Supertier-Staffel im Senckenbergmuseum besucht, ist ein Meister der Orientierung. Während sich die menschlichen Zweibeiner mit Karten und Navi quälen, trägt er wie auch die anderen Zugvögel seinen Routenplaner praktisch im Schnabel. Der dritte Teil von „Supertiere 3“, „Meine Lieblinge“, wird am Sonntag, 3. Februar, 19:30 Uhr, zu sehen sein. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 26.01.2013 ZDFneo Supertiere: 07. Meine Lieblinge
45 Min.In dieser Folge stellt Dirk Steffens in der nächtlichen Kulisse des Senckenberg-Museums in Frankfurt seine liebsten Szenen der ersten zwei Staffeln der „Supertiere“ vor. Die schönsten Tieraufnahmen erzählen die Geschichte der Rekordhalter im Tierreich. Da gibt es Echsen, die übers Wasser gehen, Kraken, die logische Meisterleistungen vollbringen und Affen, die mit ihrem Kurzzeitgedächtnis ihre menschlichen Vettern abhängen. Auch in Liebes- und Familienangelegenheiten geht es um den innersten Kern der Evolution, um die Idee des Lebens. Und um das, was die Arten im Laufe der Jahrmillionen so alles angestellt und entwickelt haben, um die eigenen Gene an die nächste Generation weiterzugeben.Das istnicht nur ein spannendes Feld der Wissenschaft, sondern hin und wieder auch einfach witzig. Aber wir Menschen sind nicht die einzigen, die in Liebesdingen und im Umgang mit den lieben Kleinen oft unfreiwillig komisch sind. Affen, Vögel oder auch Meeresbewohner stehen uns da in nichts nach. Welche Methode auch immer gewählt wird – sie ist erfolgreich, denn sonst gäbe es die jeweilige Art schon längst nicht mehr. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 02.02.2013 ZDFneo Supertiere: 08. Riesen
45 Min.Ausgewachsen misst der deutsche Mann im Durchschnitt knapp 1,80 Meter, die Frau rund 1,65 Meter. Mit dieser Größe gehören Menschen selbst schon zu den „Riesen“. Im Vergleich zu manchen Kolossen im Tierreich sind wir aber echte Winzlinge. Der Argentinosaurus, der größte Saurier aller Zeiten, wurde schätzungsweise 40 Meter lang und erreichte eine Schulterhöhe von bis zu neun Metern. Damit hätte er bequem in den dritten Stock eines Hauses schauen können. Das höchste heute lebende Landtier, die Giraffe, schafft mit ihren sechs Metern zumindest einen Blick ins zweite Geschoss. Ihr außergewöhnlich langer Hals erlaubt ihr den exklusiven Zugang zu weit oben wachsenden Akazienblättern – ein echter Vorteil gegenüber allen anderen vegetarischen Steppenkollegen.Der Giraffenkörper ist übrigens trotz seiner Länge und seiner eigentümlichen Form so perfekt ausbalanciert, dass die Savannenbewohner für kurze Zeit 50 Stundenkilometer schnell laufen können – und damit sogar manchem hungrigen Löwen entwischen. Eine Klasse für sich ist der Blauwal. Mit 30 Metern Länge und knapp 200 Tonnen Gewicht übertrumpft er selbst die schwersten Dinosaurier. Während seine Vorfahren noch an Land lebten, hat der Blauwal heute den entscheidenden Vorteil, dass er im Meer wohnt und das Wasser einen Großteil seiner Masse mitträgt. Der enormen Belastung an Land würden weder sein Bewegungsapparat noch sein Kreislauf oder die Organe standhalten. „Bigger“ ist also nicht immer automatisch „better“. Zwar ist ein Tier, je größer es ist, umso sicherer vor Fressfeinden. Andererseits benötigen Riesen mehr Futter. Weil das so ist, haben sich viele große Tiere einen sparsamen Lebenswandel entwickelt: Ihr Herz schlägt langsamer, und sie atmen seltener. Der längste Hals, der meiste Platz, die beste Anpassung – all das hat im Laufe der Evolution über den Fortbestand einer Art entschieden und dafür gesorgt, dass manche Tierkolosse zu Erfolgsmodellen wurden. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 31.08.2013 ZDFneo
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.