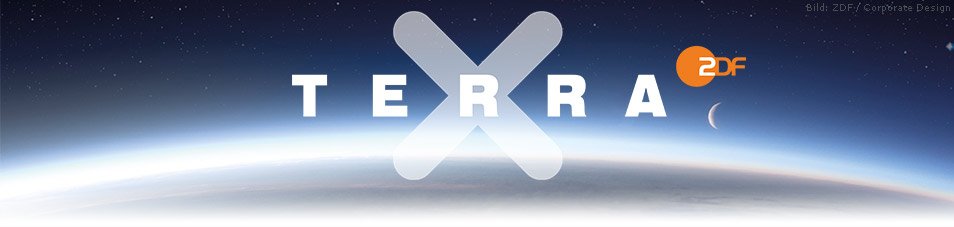1524 Folgen erfasst (Seite 48)
Sphinx: 27. Piratengold für England – Francis Drake
45 Min.Dreißig Jahre lang bis zu seinem Tod auf See im Jahr 1596 lehrt Sir Francis Drake mit seinen kleinen Schiffen das spanische Weltreich das Fürchten. Er ist Abenteurer, Admiral, Kapitän, Günstling der englischen Königin Elisabeth I. und der berühmteste Pirat der Geschichte. Im Namen Englands führt er einen privaten Kaperkrieg an den Küsten Amerikas. Überall erbeutet er Gold und Silber, die unermesslichen Schätze des spanischen Weltreichs. In England ist Francis Drake ein Volksheld – in Spanien der meistgehasste Mann seiner Zeit.Wie kann ein Mann ein Weltreich ins Wanken bringen? An Bord eines modernen Schatzschiffes und an den Originalschauplätzen in Panama geht „Sphinx“ auf Spurensuche. Originaldokumente aus dem 16. Jahrhundert, gefunden in spanischen und englischen Archiven, lüften das Geheimnis ihrer Zeit. Am Grund der karibischen See findet die Expedition der Schatzsucher mit den modernsten technischen Mitteln die Schätze, die Francis Drake auf seiner gefährlichen Jagd entgingen. Spannende Spielszenen, inszeniert an den Originalschauplätzen nach Augenzeugenberichten, erzählen die unglaubliche aber wahre Geschichte des Sir Francis Drake. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 19.11.2000 ZDF Sphinx: 28. Der Traum vom Taj Mahal – Sturm über Indien
45 Min.Taj Mahal, eines der berühmtesten Bauwerke der Welt und Wahrzeichen Indiens, ist wahrscheinlich das bekannteste und meist fotografierte Gebäude der Welt – und doch ist seine Geschichte fast unbekannt. Das Taj Mahal ist der Höhepunkt der ruhmreichen Epoche der Moguln. Unter ihrer Herrschaft hat Indien einen Traum von Größe und Schönheit gewonnen, der das Land bis heute prägt.Wer waren die sagenhaften Moguln, die „Herrscher der Welt“, wie sie sich nannten? SPHINX führt zurück in das Indien der Märchenhochzeiten, Elefantenkämpfe, Tigerjagden und Polospiele, in das verwunschene Rajasthan mit seinen kargen Landschaften und idyllischen Städten und hinein in die prächtigen Festungen und Paläste der Maharajas, die dort heute noch leben wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Die Maharadschas selbst berichten von der großen Geschichte ihrer Vorfahren, von Akbar, dem Großen Mogul, vom grausamen Tamerlan und dem Anfang vom Ende: der Ankunft der Europäer. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 17.12.2000 ZDF Sphinx: 29. Das Geheimnis des weißen Goldes
45 Min.Jahrtausendelang glaubten Menschen an die Möglichkeit, aus wertlosem Metall Gold machen zu können. Auch Kurfürst August der Starke verfiel dem Traum vom schnellen Geld, als er vom Alchemisten Johann Friedrich Böttger hörte. Er ließ ihn festnehmen und forschen. Doch Böttger fand statt Gold die Zusammensetzung eines Stoffes, der mindestens genauso wertvoll war: Porzellan. Es war die Geburtsstunde der Meißner Porzellanmanufaktur. Der Film gibt Einblicke in die Geschichte der Alchemie. Eine Dokumentation von Christian Twente und Nina Koshofer (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Mo. 01.01.2001 ZDF Sphinx: 30. Der Mordfall Kaspar Hauser
45 Min.Wer war Kaspar Hauser? 1828 taucht er als 16 jähriger Junge in Nürnberg auf, sprachlos und im Entwicklungsstadium eines Kleinkindes. Eingesperrt in einen Kerker, ohne je einen Menschen gesehen zu haben, hatte er seine Kindheit an einem geheimen Ort verbracht. Schon zu seinen Lebzeiten kommt das Gerücht in Umlauf, Kaspar Hauser sei der rechtmäßige Erbprinz von Baden und Opfer eines blutigen Erbfolgestreits. Höchste Kreise beginnen sich für ihn zu interessieren, und er wird zum Spielball der Herrschenden. 1833 wird er ermordet. Sein Mörder wird nie gefasst, seine Herkunft nie bewiesen. Das Interesse am „Mordfall Kaspar Hauser“ ist bis in die heutige Zeit geblieben.1996 veröffentlichte schließlich das Magazin DER SPIEGEL nach einer Genanalyse, dass Kaspar Hauser nicht der Erbprinz von Baden gewesen sein kann. Sphinx geht der Geschichte und den Indizien im „Mordfall Kaspar Hauser“ noch einmal nach. Zahlreiche Vermutungen geben Hinweise auf mögliche Orte, an denen Kaspar Hauser in seiner Kindheit eingekerkert gewesen sein könnte. Im Zuge der Filmarbeiten wird in Schloss Beuggen am Rhein ein bislang ungeöffnetes Geheimverlies aufgebrochen. Ein außergewöhnlicher Fund dort liefert tatsächlich ein neues Indiz dafür, dass Kaspar Hauser als kleines Kind auf Schloss Beuggen gefangen gehalten wurde. Noch aufschlussreicher verläuft für die Filmemacher jedoch die Suche nach den leiblichen Eltern Kaspar Hausers anhand einer neuen DNA-Untersuchung. Beauftragt wurde das auf solch knifflige Fälle spezialisierte Rechtsmedizinische Institut der Universität Münster. Unter absoluter Geheimhaltung ist es dem Rechtsmediziner Professor Bernd Brinkmann gelungen, das Resultat von 1996 zu korrigieren. Das festgestellte Ergebnis ist eine historische Sensation: Entgegen der ersten Schlussfolgerung des Spiegels führt die genetische Spur eindeutig in Richtung des Fürstenhauses von Baden. (Text: History) Deutsche TV-Premiere Sa. 17.08.2002 arte Sphinx: 31. Pizarro – Das Blut des Sonnengottes
45 Min.Am 16. November 1532 besiegt der spanische Hauptmann Francisco Pizarro mit nur 180 Mann den großen Inka-Fürsten Atahualpa mit seiner Gefolgschaft von über 30.000 Kriegern in der Festung Cajamarca im heutigen Peru. Mehr als 7.000 Inka werden niedergemetzelt, die anderen fliehen in Panik. Der Untergang des Inka-Reiches ist besiegelt. Das „Blut des Sonnengottes“, das sagenhafte Gold des Gottkönigs Atahualpa, fällt in die Hände Pizarros und füllt bald die Schatztruhen der spanischen Krone. Pizarro, ein von seinem Vater nie anerkannter Knecht und Analphabet, schwingt sich auf zum wichtigsten Eroberer seiner Zeit. Er kommt aus Trujillo, einem armen Dorf in der Extremadura. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Sa. 24.08.2002 arte Sphinx: 32. Die Sphinx – Das Rätsel in Stein
45 Min.Über den Schöpfer der Sphinx von Gizeh streiten Archäologen bis heute. Die meisten behaupten, dass es Pharao Chephren war, der das Wesen aus Löwe, Mensch und Gott vor etwa 4.500 Jahren zum Symbol seiner Macht erklärte. Doch der angesehene Ägyptologe Rainer Stadelmann ist davon überzeugt, in dem zerstörten Antlitz der Sphinx die Züge des legendären Pharaos Cheops erkennen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Sa. 31.08.2002 arte Sphinx: 33. Spartacus – Gladiator gegen Rom
45 Min.73 vor Christus rebelliert ein bis dahin unbekannter Sklave gegen die römischen Gladiatorenspiele, die Menschen zu blutrünstigen Monstern degradieren. Sein Name wird durch seinen Aufstand unsterblich: Spartacus, römischer Kriegsgefangener aus dem heutigen Rumänien und selbst Gladiator. Mit 70 Gefährten überwindet er die Gefängnismauern der berühmten Gladiatorenschule zu Capua, um den gewaltigsten Sklavenaufstand zu entfesseln, den die Antike je gesehen hat. Eine Revolution, die ganze drei Jahre lang die römischen Streitkräfte in Atem hält. Zuletzt werden Spartacus und seine Gefährten Opfer der römischen Militärmaschinerie. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Sa. 07.09.2002 arte Sphinx: 34. Vasco da Gama – Die Jagd nach den Gewürzinseln
45 Min.Am 8. Juli 1497 verlässt der Portugiese Vasco da Gama mit einer Flotte von vier kleinen Schiffen die stürmische Küste vor Lissabon. Niemand weiß, ob er sein Ziel erreichen wird. Seine Aufgabe ist es, den Seeweg nach Indien zu finden. Viele hatten es bereits versucht – und waren gescheitert. Kolumbus, der berühmteste Seefahrer aller Zeiten, wollte ebenfalls nach Indien und hatte stattdessen „nur“ Amerika entdeckt. Auch Vasco da Gamas Reise war vom Scheitern bedroht. Warum gelang es ausgerechnet ihm, als Sieger hervorzugehen im größten Abenteuer am Anfang der Neuzeit? Warum fand der Portugiese auf seiner Route als erster Europäer den Seeweg nach Indien, und warum irrte Kolumbus? Obwohl Vasco da Gama nach zwei Jahren mit nur einer Hand voll Edelsteinen und Gewürzen zurückkehrt, wurde er wie ein Held empfangen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 29.12.2002 ZDF Sphinx: 35. Mythos Babylon – Nebukadnezar
45 Min.Ein verwittertes Steinrelief im libanesischen Wadi Brisa zeigt einen mächtigen Herrscher bei der Löwenjagd. Es ist das einzige Bildnis, das von Nebukadnezar erhalten ist, 2500 Jahre alt. In seinem Hochmut und seiner Grausamkeit, so berichten die Quellen, habe Nebukadnezar alle Grenzen überschritten. Gleichwohl wurde er zum Schöpfer einer Metropole, die bis heute als erste Großstadt der Welt gilt: Babylon.Was für ein Mensch verbirgt sich hinter der Maske des allmächtigen Herrschers über Leben und Tod? Und wie lebten er und seine vielen hunderttausend Untertanen in der legendären Metropole Babylon? Nahe der antiken Stadt Sippar, tief begraben unter dem Sand der irakischen Wüste, findet unsere Expedition in einer versunkenen Bibliothek, 400 Tontafeln, die vom Leben der alten Babylonier erzählen. Mit dieser ältesten Bibliothek der Welt beginnt eine faszinierende Reise durch die Geschichte, in die Furcht erregende und wunderbare Welt Babylons. In Inszenierungen und 3D-Animationen ersteht Babylons Welt wieder. Um das „Geheimnis Babylon“ zu lüften kommt auch modernste Technik zum Einsatz. Ein lang gehegter Traum der Archäologen wird wahr: Mittels russischer Aufklärungssatelliten gelingen Luftaufnahmen vom alten Babylon, die Aufschluss über die wirkliche Größe der Metropole geben. Luftbildarchäologen analysieren die einstigen Grundrisse der Wunderwerke antiker Baukunst: Der Turm zu Babel; oder das siebte Weltwunder: Die Doppelmauer von Babylon. Ein neues Licht fällt auf jene Metropole, die von der Bibel einst als „Sündenbabel“ in Bausch und Bogen verdammt wurde, die aber bis heute als mythisches Urbild aller Großstädte im Gedächtnis geblieben ist. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Mi. 01.01.2003 ZDF Sphinx: 36. Napoleon – Wahrheit und Legende
45 Min.Er schien gekommen, um Europa zu beherrschen. Erwarb Napoleon seine Kaiserkrone durch einen politischen Mord? Trieben ihn seine Gegner oder doch nackter Ehrgeiz in einen gigantischen Eroberungsfeldzug, der sein Schicksal besiegelte? Woran starb Napoleon wirklich? Mit modernster Reaktortechnik enträtselt „Sphinx“ diesen Mythos – eines der letzten Geheimnisse um einen Mann, der einem Zeitalter seinem Namen gab, doch dessen Legende erst in der Niederlage unsterblich wurde. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 05.01.2003 ZDF Sphinx: 37. Gefangen im Reich des Shogun
45 Min.20. April 1600: Ein Taifun spült ein holländisches Schiff an die japanische Küste. Der englische Steuermann William Adams, einer der wenigen Überlebenden, wird vor den gefürchteten Feldherrn leyasu geführt. Der Befehlshaber über Tausende Samurai steht vor der schwierigen Entscheidung, ob er die Neuankömmlinge hinrichten lässt oder ihnen eine Chance gewährt. Schließlich wird Adams Leben verschont, er darf aber nicht nach England zurückkehren. Der einfache Steuermann macht innerhalb kürzester Zeit eine unglaubliche Karriere. Es gelingt ihm sehr schnell, sich auf die fremde Kultur einzustellen, er lernt Japanisch, baut hochseetaugliche Schiffe für den neuen Shogun und avanciert zu seinem wichtigsten Berater und engstem Vertrauten. Ihm wird die höchste Ehre zuteil, die je einem Fremden erwiesen wurde: Er wird in die Adelskaste der sagenumwobenen Samurai aufgenommen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Sa. 14.08.2004 arte Sphinx: 38. Die letzte Schlacht der Kelten
45 Min.Im Winter 53/52 vor Christus gelingt es dem Arverner-Fürsten Vercingetorix die zerstrittenen Stämme Galliens zu vereinen, um gegen die römische Besatzungsmacht anzutreten. In Alesia versucht Caesar Vercingetorix mit seinen Truppen mit einer Belagerung auszuhungern. In der legendären Schlacht von Alesia entscheidet sich dann das Schicksal der Kelten, die die Römer „Gallier“ nannten. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 14.11.2004 ZDF Sphinx: 39. Imhotep – Magier des Pharao
45 Min.Die Stufenpyramide von Sakkara gilt als das erste monumentale Steingebäude der Weltgeschichte. Vor fast 5.000 Jahren ließ sie Pharao Djoser südlich von Kairo errichten. Der Totenschrein ist das Werk des genialen Baumeisters Imhotep. Er war der erste Normalbürger, der zum Gott erhoben wurde und dessen Ruhm den seines Königs überstrahlte. – Film über die Bedeutung Imhoteps. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 21.11.2004 ZDF Sphinx: 40. Dschingis Khan – Der apokalyptische Reiter
45 Min.Es ist die Geschichte des Dschingis Khan, der einmal Temüdschin hieß. So verschlungen sein Lebensweg war, so wenig eindeutig lässt sich sein Charakter fassen. Die Überlieferung kennt ihn als blutrünstig, grausam, Furcht einflößend, aber auch als genialen Feldherren, klugen und energiegeladenen Staatsmann. Unter seiner Herrschaft entstand in nur 15 Jahren ein gewaltiges Imperium, das vom Kaspischen bis zum Gelben Meer, vom Indus im Süden bis zum Jenissei im Norden reichte. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 26.12.2004 ZDF Sphinx: 41. Die Maya – Die Rache des Regengottes
45 Min.Die Hochkultur der Mayas fasziniert seit ihrer Wiederentdeckung im Urwald Mittelamerikas Forscher und Abenteurer. Die Mayas verfügten über erstaunliche mathematische und astronomische Kenntnisse und entwickelten ein kompliziertes Schriftsystem. In dicht besiedelten Städten lebten bis zu 200.000 Einwohner, die mittels Landwirtschaft und Transportwesen versorgt wurden. Die Ursachen des Untergangs dieser Zivilisation vor einem Jahrtausend konnten noch nicht endgültig geklärt werden. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 02.01.2005 ZDF Sphinx: 42. Ludwig II. – Tod des Märchenkönigs
45 Min.Man nennt ihn den Märchenkönig, weil er sich mit seinen Königsschlössern in Bayern eine eigene Welt baute: König Ludwig II. war eine schillernde Figur. Er liebte die Kunst und wollte ein König sein, wie es noch keinen gab. Doch dieser Traum endete tragisch. Der König wurde für geisteskrank erklärt, abgesetzt und inhaftiert. Sein Tod im See ist bis heute ein ungeklärtes Rätsel. Ein Oberstaatsanwalt rollt den Fall nochmals auf. Er überprüft die alten Polizeiberichte und untersucht die Tatumstände. War es Mord oder Selbstmord? (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 09.01.2005 ZDF Sphinx: 43. Kreuzzug in die Hölle – Die Tempelritter
45 Min.13. Oktober 1307: Tausende von Männern in ganz Frankreich werden festgenommen – der Auftakt einer Verhaftungswelle, die bald über ganz Europa hinwegrollt. Das Ziel ist die Zerschlagung des Templerordens, einer der mächtigsten Organisationen des Mittelalters. Die Tempelritter galten als das Symbol einer 200-jährigen Herrschaft, die den Feinden des Christentums das Fürchten gelehrt hatte. Mit der Kreuzzugbewegung erlebten sie einen steilen Aufstieg. Bald übernahmen sie die militärische Hoheit in eroberten Gebieten und kontrollierten die Handelswege. Die weltweit operierende Organisation wurde zu einem Machtapparat, der allein dem Papst unterstand. Nach der Rückeroberung des Heiligen Landes durch die Muselmanen gerieten die Tempelritter in eine Interessenkollision zwischen Papst und französischer Krone – und wurden schließlich zu Opfern in den Schauprozessen der Inquisition. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 16.01.2005 ZDF Sphinx: 44. Marie Antoinette – Vom Thron zum Schafott
45 Min.Marie Antoinette wurde 1793 im Namen der Revolution auf dem Schafott hingerichtet. Während ihrer Einkerkerung führte die Königin eine geheimnisvolle Korrespondenz. Es sind vor allem Geheimcodes und unkenntlich gemachte Stellen, in den Briefen an den schwedischen Offizier Graf von Fersen, die bis heute Rätsel aufgeben. Sind es Zeugnisse eines historischen Verrats oder Dokumente einer verbotenen Liebe? (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 23.01.2005 ZDF Sphinx: 45. Savonarola – Der schwarze Prophet
45 Min.Savonarola (1452–1498) war ein wortgewaltiger Prediger. Zehntausende lauschten im Dom von Florenz seinen Predigten, in denen er die Unmoral der Reichen, der weltlichen und kirchlichen Fürsten geißelte und für die Armen und Schwachen Partei ergriff. Auf dem Höhepunkt seiner Macht riss Savonarola die Herrschaft über Florenz an sich und errichtete einen Gottesstaat. Mehrere Mordanschläge auf ihn scheiterten. Schließlich sollte ein Gottesurteil, die so genannte „Feuerprobe“, darüber entscheiden, ob er ein Prophet Gottes oder ein teuflischer Verführer sei. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Sa. 02.09.2006 arte Sphinx: 46. Kreuzzug der Kinder
45 Min.1212 zieht in Köln ein Junge namens Nikolaus Tausende von Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren mit fanatischen Reden in seinen Bann: Sie seien auserwählt, Jerusalem zu befreien. Auch der junge Schäfer Stefan schart im französischen Cloyes mit gleichlautender Verkündung zahlreiche Kinder um sich: Das Mittelmeer werde sich vor ihnen teilen und trockenen Fußes würden sie das Heilige Land erreichen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 03.09.2006 arte Sphinx: 47. Heinrich VIII. – Mörder auf dem Königsthron
45 Min.König Heinrich VIII. ist hauptsächlich bekannt als mörderischer Ehemann, der zwei seiner sechs Ehefrauen hinrichten ließ. Doch mit seiner Politik legte er auch den Grundstein für die Entwicklung Großbritanniens zur Weltmacht. Die Dokumentation untersucht Leben und Wirken dieses widersprüchlichen Monarchen. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Sa. 16.09.2006 arte Sphinx: 48. Der Mann auf dem Grabtuch
45 Min.Seit 1578 wird im Turiner Dom ein von Millionen Gläubigen als das Leichentuch Jesu Christi verehrtes Leinentuch aufbewahrt. Es birgt das blasse Abbild eines Gekreuzigten. Durch Panzerglas geschützt ist es der Weltöffentlichkeit nur alle 25 Jahre zugänglich. Zahlreiche Merkmale stimmen mit der Passionsgeschichte und der biblischen Überlieferung überein. Doch hat es dieses Leinentuch wirklich gegeben? (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 19.11.2006 ZDF Sphinx: 49. Jeanne d’Arc – Die Jungfrau von Orleans
45 Min.Der Kampf des französischen Thronfolgers Karl VII. gegen die Engländer um Herrschaft und Krone zur Zeit des Hundertjährigen Kriegs scheint verloren. Da taucht 1429 das 17-jährige Bauernmädchen Jeanne d’Arc auf und führt in nur fünf Monaten für Frankreich und seinen König die Wende herbei. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Di. 26.12.2006 ZDF Sphinx: 50. Die eiskalte Zarin – Katharina die Große
45 Min.Ihr Leben ist Legende: Die deutsche Prinzessin Sophie Friederike Auguste von Anhalt Zerbst wollte schon als Kind Königin werden, und mit 15 Jahren war sie fast am Ziel. Sie reiste im Jahr 1744 nach Russland, als Braut für den Thronfolger Peter von Holstein. Doch die Ehe wurde zu einem Martyrium, das sie in ihren Memoiren präzise beschrieben hat und das den Stoff für melodramatische Spielfilme lieferte. Ihr infantiler und trunksüchtiger Ehemann spielte mit Puppensoldaten. Sie aber stellte sich als warmherzige Mutter aller Russen dar, die ihr Volk von der Leibeigenschaft befreien wollte. Als Katharina II. bestieg sie nach einem Staatsstreich den Zarenthron. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere Mo. 01.01.2007 ZDF Sphinx: Marie Antoinette – Vom Thron zum Schafott
War Marie Antoinette Opfer oder Täterin? „Wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen!“ soll Marie Antoinette den hungernden Volksmassen geraten haben. Durch diese Worte erhielt sie ihren Platz in der Geschichte: als Inbegriff einer vergnügungssüchtigen Monarchin, ohne Gespür für die sozialen Probleme und Umbrüche ihrer Zeit. Eine lebensfrohe, leichtfertige Frau, die selbstverschuldet, blind und naiv auf ihren Untergang zusteuerte. Der Film zeigt die Geheimgänge des Schlosses von Versailles, durch die die Königin heimlich zu ihren nächtlichen Ausschweifungen aufbrach.Doch ein Leben, das an goldenen Tafeln begann, sollte bald auf den Stufen des Schafotts enden. Paris 1791: In Frankreich hatten seit zwei Jahren Revolutionäre die Herrschaft übernommen und es schien, dass sich die Monarchie unter Ludwig XVI. einem gravierenden Umbruch gegenüber sah. Alle europäischen Adelshäuser blickten besorgt auf Paris und harrten gebannt der dortigen Entwicklungen. Nach ihrer Verhaftung und Einkerkerung, von ihrem Volk gedemütigt und verachtet, begann mit der Revolution Marie Antoinettes Hass gegen Frankreich und ein fatales Doppelspiel. Die Königin führte eine geheimnisvolle Korrespondenz mit ausländischen Verbündeten. Es sind vor allem Geheimcodes und unkenntlich gemachte Stellen, in den Briefen an den jungen schwedischen Offizier Hans Axel Graf von Fersen, die bis heute Rätsel aufgeben. Mit Hilfe des Schweizer Kriminologen Marcel Widmer versucht die Dokumentation nun die verschlüsselten Botschaften zu knacken. Sind es Zeugnisse eines historischen Verrats oder Dokumente einer verbotenen Liebe? Am 16. Oktober 1793, sechs Monate nach ihrem Mann Ludwig XVI., wurde Marie Antoinette, die „Witwe Capet“, im Alter von 38 Jahren hingerichtet. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 23.01.2005 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail