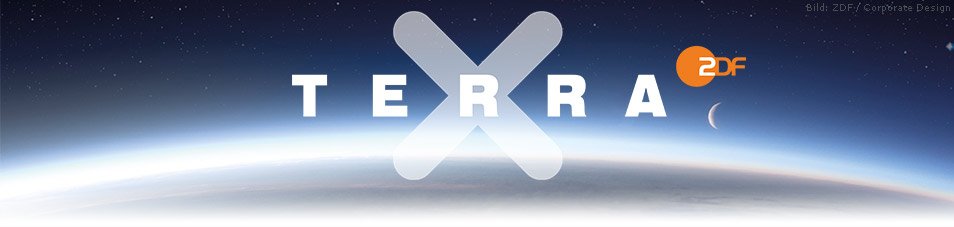1525 Folgen erfasst (Seite 30)
Der Kontinent: 3. Die Zähmung Europas
45 Min.Vor rund 8000 Jahren begann im Osten des Kontinents eine Revolution: Bauern aus Mesopotamien, einer der Wiegen der Zivilisation, breiteten sich aus. In nur wenigen Jahrtausenden erreichten sie den Atlantik. Die Landwirtschaft der Jungsteinzeit veränderte Europa radikal: Aus undurchdringlichen Urwäldern wurden immer größere Flächen Ackerland. Hunderte von Wildpflanzenarten wichen wenigen Kulturpflanzen: Emmer-Weizen, Gerste, Hafer und Ölbaum. Hundertmal mehr Menschen konnten von der Landwirtschaft leben als von der Jagd. Es gab Nahrungsvorräte, und die Menschen wurden sesshaft. Spuren dieser frühen Kultur sind heute überall in Europa zu finden: Sonnentempel auf Malta und Menhire in der Bretagne bezeugen Sesshaftigkeit und Besitztum. Es sind die frühesten Bauwerke des Kontinents: technische Meisterleistungen von mathematischer Präzision. Der steinerne Kalender von Stonehenge im Süden Englands ist sicher das bekannteste und imposanteste Beispiel dieser Zeit. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 02.10.2005 ZDF Der Kontinent: 4. Die Zukunft Europas
45 Min.Europa im dritten Jahrtausend. 730 Millionen Menschen nehmen Einfluss auf den Kontinent. Mensch und Natur finden neue Wege der Koexistenz. Nach einer wechselvollen Geschichte, begonnen vor drei Milliarden Jahren, gehen die Ver-änderungen seit dem 20. Jahrhundert so rasant voran, wie niemals zuvor. Neue Technologien, neue Einwanderer und neue Anstrengungen, verloren gegangene Natur zurückzubringen, prägen unsere Zeit. In Folge vier der Reihe begeben sich die Filmemacher auf die Spuren der Wildnis, mitten im am dichtesten besiedelten Kontinent der Welt. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Mo. 03.10.2005 ZDF Krieger, Fürsten und Druiden – Auf den Spuren der Kelten
Krokodile – Zeugen der Urzeit
Kronzeugen des Hochadels – Mumienfund in Rom
Der kühnste Traum – die Bezwingung des Mount Everest
45 Min.Bis heute ranken sich viele Legenden um das Rätsel, wer der Erste auf dem höchsten Berg der Erde war: Edmund Hillary und der nepalesische Bergsteiger Tenzing Norgay sollen den Gipfel des Mount Everest am 29. Mai 1953 als Erste erreicht haben. Doch entspricht das der Wahrheit? Die „Terra X“-Dokumentation zweifelt das an. Nicht Edmund Hillary, sondern George Mallory und sein Gefährte Andrew Irvine könnten den 8848 Meter hohen Riesen als Erste bezwungen haben – fast 30 Jahre früher. Am 6. Juni 1924 werden die beiden Briten in der Nähe des Berggipfels fotografiert.Dann entschwanden sie den Blicken der Gefährten im tiefer gelegenen Camp und schienen für immer von der eisigen Wildnis verschluckt. 75 Jahre nach diesem Drama machte der amerikanische Bergsteiger Conrad Anker einen spektakulären Fund: die Leiche von George Mallory. Die große ungelöste Frage, ob Mallory und Irvine vor ihrem Tod vielleicht doch die wahren Erstbesteiger waren, flammte erneut auf. Hatte Mallory erst beim Abstieg vom Gipfel den Tod gefunden? Reinhold Messner glaubte nicht an dessen Erfolg, da er es für unmöglich hielt, eine Felsbarriere am Gipfelgrat zu überwinden. Andere hielten es für denkbar. Conrad Anker wollte Klarheit erlangen und wagte die Besteigung über die Nord-flanke mit denselben Mitteln wie Mallory Jahrzehnte zuvor. Eine aufsehener-regende Expedition, die Licht ins Dunkel der damaligen Ereignisse zu bringen versucht. In großartigen Bildern vom höchsten Berg der Welt verquickt der Film die historische Expedition mit der aktuellen Besteigung von Conrad Anker. Die drama-tischen Rekonstruktionen wurden auf dem Mount Everest unter schwierigsten Bedingungen gedreht. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 10.02.2013 ZDF Eine kurze Geschichte über …: 1. Das Mittelalter
45 Min.In dieser Folge der Terra X-Reihe „Eine kurze Geschichte über …“ erklärt der beliebte Geschichtsblogger Mirko Drotschmann – alias „MrWissen2Go“ – die Welt des Mittelalters. Das Mittelalter gilt als dunkel, rückständig und grausam. Aber war es das wirklich? YouTuber Mirko Drotschmann bringt Licht ins Dunkel. Er erzählt die Geschichte einer Epoche, die erstaunlich bunt und vielgestaltig war – eine filmische Reise durch 1000 Jahre. Das Mittelalter reicht vom fünften Jahrhundert nach Christus – als die Antike mit dem Untergang des Römischen Reiches im Westen zu Ende ging – bis zur Erfindung des Buchsdrucks mit beweglichen Lettern durch den Mainzer Johannes Gutenberg.Gewaltige Burgen und mehr als hundert Meter in den Himmel ragende Kathedralen zeigen eindrücklich, zu welchen Leistungen die Menschen im Mittelalter bereits fähig waren. Computeranimationen lassen auch die Bereiche der damaligen Welt wieder sichtbar werden, die heute längst verschwunden sind oder schon immer im Verborgen lagen. Dazu gehören auch Himmel und Hölle. Für die Menschen im Mittelalter waren sie so real, wie die Welt, die sie umgab. Mirko Drotschmann erklärt, was diese Weltsicht mit den Menschen gemacht hat. Noch heute sind viele mittelalterliche Redewendungen im Sprachgebrauch. Besonders viele stammen aus der Welt der Ritter wie zum Beispiel die Formulierung „jemandem mit offenem Visier begegnen“ oder „mit offenem Visier kämpfen“ oder auch „für jemanden eine Lanze brechen“. Aber was hieß das eigentlich, als Ritter zu leben, Herr auf einer eigenen Burg zu sein oder für den König zu kämpfen? Aus bis zu 150 Einzelteilen bestand eine Rüstung, die den Ritter vor Lanzen, Schwerthieben oder Pfeilen schützen sollte. Um sich in die Zeit hineinzuversetzen, wird Mirko Drotschmann von Kopf bis Fuß in eine Rüstung gesteckt. Ein wissenschaftliches Experiment soll Klarheit bringen, wie beweglich ein Ritter in voller Montur noch war. Die Teststrecke ist ein 400 Meter langer Hindernisparcours. Das verblüffende Ergebnis: Die gut 30 Kilogramm schwere, auf Maß gefertigte Rüstung ermöglicht einen nahezu vollen Bewegungsumfang. Frauen führten im Mittelalter ein besonders hartes Leben. Selbst im Kloster, wo sie nicht heiraten mussten und damit vor männlicher Willkür besser geschützt waren, besaßen sie nur eingeschränkte Rechte. Zu ihren traditionellen Aufgaben gehörte die Versorgung der Kranken und Schwangeren aus den umliegenden Dörfern. Dass Nonnen aber auch in Männerdomänen eindrangen und wie Mönche im Skriptorium Bücher kopieren durften, haben Paläontologen am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte herausgefunden. Im Zahnstein einer Nonne, die vor rund 900 Jahren in einem Kloster auf dem Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens begraben wurde, entdeckten sie Spuren von Lapislazuli. Aller Wahrscheinlichkeit gelangte der kostbare blaue Farbstoff beim Verzieren von Büchern in den Mund der Frau, beim Anlecken des Pinsels. Und das bedeutet, dass Frauen womöglich doch einen höheren Status hatten, als man bisher vermuten konnte. Das Mittelalter war alles andere als ein dunkles, düsteres Zeitalter. Vieles hat sich innerhalb der 1000 Jahre entwickelt: Städte sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, Kathedralen in den Himmel gewachsen. Es gab große Fortschritte in Handwerk und Medizin. Und auch der Horizont der Menschen erweiterte sich: 1492 landete Kolumbus in der Neuen Welt, und Luthers Reformation rüttelte an der Vormachtstellung der katholischen Kirche. Die Menschen lenkten ihren Blick mehr und mehr auf das irdische Leben und stellten Überliefertes in Frage. Damit war der erste Schritt auf dem Weg in die Moderne getan. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 18.03.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 29.03.2020 ZDF Eine kurze Geschichte über …: 2. Die Hexenverfolgung
45 Min.In der Terra X-Reihe „Eine kurze Geschichte über …“ beleuchtet der bekannte Geschichts-Blogger Mirko Drotschmann – alias „MrWissen2Go“ – die Zeit der Hexenverfolgung. Verhöre, Folter, Scheiterhaufen – die Hexenprozesse der Vergangenheit schockieren heute. Kaum ein Thema ist so klischeebeladen wie die Hexenverfolgung. Der YouTuber Mirko Drotschmann erzählt die grausame Geschichte der Hexenjagd in Deutschland. Noch lange sind nicht alle Fragen über die dunkle Epoche der Hexenjagd in Deutschland beantwortet.Wie konnte es dazu kommen? Wer waren die Opfer, wer die Täter? Waren es wirklich vor allem Frauen, die verfolgt wurden? Und was genau geschah hinter den Mauern der Gerichtssäle und Folterkammern? Bis 1780 fielen etwa 50 000 Menschen den Hexenverfolgungen in Europa zum Opfer – über die Hälfte davon im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Mirko Drotschmann räumt mit hartnäckigen Vorurteilen auf und erklärt, was man über Hexenwahn und Hexenverfolgung wissen muss. Er schildert, wie es dazu kam, dass Nachbarn oder Bekannte plötzlich andere als Hexen bezichtigten. Und er erzählt, warum Frauen und Männer Taten gestanden haben, die sie nicht begangen hatten. Der Film rollt den tragischen Fall der „Bader-Ann“ aus Veringenstadt auf der Schwäbischen Alb auf. Im Jahr 1680 wurde sie als Hexe verurteilt, enthauptet und dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mirko Drotschmann findet im Archiv der Stadt die Verhörprotokolle und Prozessakten. Es ist eine Expedition in ein düsteres Kapitel der Geschichte: Wer einmal in die Mühlen des juristischen Apparates geriet, war kaum noch zu retten. Die Verurteilung sollte auf einem Geständnis beruhen, doch das wurde in den meisten Fällen mit Folter erzwungen. Neben dem Richter spielte vor allem der Scharfrichter eine wichtige Rolle im Prozess. Die Henker waren mehr als reine Vollstrecker. Sie kannten sich mit der menschlichen Anatomie mindestens genauso gut aus wie ein Arzt. Die perfide Aufgabe des Henkers war es, das Opfer so lange wie möglich am Leben zu halten, um das gewünschte Geständnis zu erpressen. Die Menschen der frühen Neuzeit lebten in einer Welt, die von Aberglaube und magischem Denken bestimmt war. Zudem versetzten Wetterkatastrophen, Missernten, Krieg und Pestepidemien viele in eine apokalyptische Stimmung. Die Archäologin Marita Genesis ist Expertin für Richtstätten – also Orte, an denen Verurteilte gehängt, gerädert oder enthauptet wurden. Sie hat Dutzende Skelette ausgegraben und herausgefunden, dass einige Tote aus Angst vor Wiedergängern mit magischem Abwehrzauber bestattet wurden. Zum Motor für die unmenschlichen Verfolgungen und massenhaften Hinrichtungen wurde ein Handbuch der Hexenjäger: der „Hexenhammer“. Der Dominikanermönch Heinrich Kramer beschreibt darin detailliert, wie Hexen und Zauberer zu erkennen und zu verfolgen seien. Vor allem in Frauen sah er willfährige Opfer des Teufels. Mirko Drotschmann beschäftigt sich mit der Motivation des fanatischen Hexenverfolgers und analysiert, warum sein Werk so lange seine fatale Macht entwickeln konnte. Erst im Jahr 1775 wurde die letzte vermeintliche Hexe in Deutschland umgebracht. Doch wer glaubt, der Spuk sei heute vorüber, irrt sich. Tatsächlich gibt es auch heute noch Hexenverfolgungen, zum Beispiel in einigen Gebieten Südostasiens, Lateinamerikas und Afrikas. Auch dort ist es keine Seltenheit, dass überwiegend Frauen der Hexerei bezichtigt, verstümmelt oder sogar getötet werden. Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, sich einen Sündenbock zu suchen, Menschen in eine Schublade zu stecken, oder Feindbilder aufzubauen. Für erlebtes Leid wird oft ein anderer verantwortlich gemacht – so wie damals die Hexen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.03.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 05.04.2020 ZDF Eine kurze Geschichte über …: 3. Das alte Ägypten
45 Min.In der dritten Folge der „Terra X“-Reihe „Eine kurze Geschichte über …“ erklärt der beliebte Geschichts-Blogger Mirko Drotschmann – alias „MrWissen2Go“ – die Welt des alten Ägypten. 3000 Jahre Hochkultur am Nil. Kein Reich existierte länger, keines war seiner Zeit so weit voraus. Monumentale Tempel, die Grabanlagen im Tal der Könige und vor allem die Pyramiden von Gizeh zeugen von den Leistungen der alten Ägypter. Mirko Drotschmann erzählt ihre faszinierende Geschichte. Was war das Geheimnis dieser einzigartigen Erfolgsstory? Welche Bedeutung hatte der Totenkult? Drotschmann geht auf Spurensuche in ägyptischen Museen, trifft Mumienforscher und ist hautnah dabei, wenn Ingenieure an der Uni Kassel eine geniale Technik entschlüsseln, die für den Bau der Pyramiden genutzt wurde.Computeranimationen zeigen, wie die Pyramiden von Gizeh zur Zeit der Erbauung ausgesehen haben und welche Geheimnisse noch heute in ihrem Inneren verborgen sind. Die Geschichte des Pharaonenreiches beginnt mit einem Schatz der Natur: dem Nil. Der majestätische Strom durchquert rund 1000 Kilometer trockenste Wüste und schenkte Ägypten Fruchtbarkeit und Reichtum. An seinen Ufern entwickelte sich die ägyptische Hochkultur. Nach der Vereinigung von Ober- und Unterägypten herrschten die Pharaonen über den ersten zentral gelenkten Staat der Geschichte. Zum Kitt der Gesellschaft wurden religiöse Mythen, die vielen Götter und die gottgleichen Pharaonen. Der Film zeigt, wie die wie Götter verehrten Herrscher lebten, wie ihr Leben im Palast aussah und warum Inzest zur gängigen Heiratspolitik gehörte. Für die toten Pharaonen entstanden prachtvollen Grabbauten wie die Pyramiden von Gizeh oder die unterirdischen Gräber im Tal der Könige. Tiefe Fallschächte und Scheintüren sollten Grabräuber in die Irre führen. Doch nur die Kammer eines eher unbekannten Pharaos blieb bis Anfang des 20. Jahrhundert unentdeckt: das Grab von Tutanchamun. Aberhunderte Beigaben wie kostbarer Schmuck, Kultobjekte, Amulette, Waffen, aber auch Alltagsgegenstände ziehen bis heute in Bann. Mirko Drotschmann reist nach London, wo unter anderem auch dieser legendäre Grabschatz bis Mai 2020 ausgestellt wird. Die Toten im alten Ägypten wurden mit unglaublicher Akribie vor dem Verfall bewahrt. Einige Mumien sehen noch heute so aus, als wären sie erst vor wenigen Jahren gestorben und nicht vor vielen Hunderten Jahren. Für die Forscher des German Mummy Projects sind Mumien ganz besondere „Bio-Archive“, die über das Leben und Leiden der alten Ägypter Aufschluss geben. Wie ernährten sie sich, wie alt wurden sie? Woran sind sie gestorben? Hat man versucht, sie zu heilen? Und welche Medikamente nahmen sie ein, oder konsumierten sie Drogen? Der Zuschauer erfährt, dass die ägyptischen Ärzte ihrer Zeit weit voraus waren. Sie führten Operationen am Kopf und Amputationen durch und behandelten Knochenbrüche. Erfolgreich – wie Untersuchungen an Mumien beweisen. Knallharte Machtpolitik und der Totenkult hielten das Reich für rekordverdächtige 3000 Jahre zusammen. Zwar versuchten immer wieder sogenannte „Fremdländer“, das reiche Ägypten zu erobern, aber erst ab 500 vor Christus gelang es zunächst den Persern, dann Alexander dem Großen und schließlich den Römern, das Pharaonenland zu schwächen und schließlich in die Knie zu zwingen. Die Eindringlinge prägten die Kultur und Sprache. Aber haben sie sich auch in genetischer Hinsicht verewigt? Forschern des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte ist es erstmals gelungen, das Erbgut von altägyptischen Mumien zu entziffern. Die Ergebnisse sind verblüffend. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 25.03.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 12.04.2020 ZDF Kwezi – Ein Schakal schlägt sich durch
Labyrinth des Todes
Leben auf dem Fluss – Mit der Pinasse auf dem Niger
Timbuktu: Seit jeher hat der Name der malinesischen Stadt in der Sahara einen magischen Klang. Als eine der heiligen Stätten des Islam war sie für Nicht-Muslime verboten, Kaufleute beschrieben sie als sagenhaft reich. Einer Legende nach waren die Straßen mit Gold gepflastert. Doch der Zugang nach Timbuktu war zu keiner Zeit einfach. Bis heute führen nur wenige Wüstenpisten dorthin. Deshalb werden Personen und Waren nach wie vor überwiegend auf dem Fluss Niger transportiert. (Text: ZDF)Leben auf dem Mars? – Odyssee ins Weltall
Leben auf dem Vulkan
45 Min.Vulkane gelten vor allem als gefährlich und zerstörerisch. Sie bedrohen Menschen, Tiere und ganze Kontinente durch Explosionen, Lavaströme und giftige Gase. Die „Terra X“-Dokumentation „Leben auf dem Vulkan“ zeigt jedoch eine andere Seite der Feuerberge. Im Verlauf der Erdgeschichte schufen Vulkane immer wieder Landschaften und Lebensräume. Sie spielten nicht nur eine bedeutende Rolle bei der Entstehung des Lebens selbst, sondern formten immer neue Landmassen und trieben so die Evolution vieler Arten voran. Keine andere Naturgewalt hat einen so großen Anteil an der Gestaltung und Umgestaltung der Welt wie die gigantischen Feuerberge.Internationale Kamerateams zeigen Vulkane rund um den Globus und spüren Lebewesen auf, die sich auf erstaunliche Weise an das Leben in Asche und Glut angepasst haben. Bereits einige Dinosaurierarten ließen ihre Eier von der vulkanischen Hitze ausbrüten. Heute tun dies noch immer einige Reptilien und Vögel, wie beispielsweise das Thermometerhuhn in Indonesien. Aufwändige Computeranimationen erwecken die Dinos zum Leben und zeigen, wie sie die Energie der Vulkane zu ihrem Vorteil nutzten. In der Tiefsee erkundet „Terra X“ die vielgestaltigen Lebensgemeinschaften auf dem Meeresgrund. An den Hängen der Unterwasservulkane soll hier einst das Leben entstanden sein, aber auch heute sind noch lange nicht alle Geheimnisse der Tiefseegeschöpfe gelüftet. Einige der Unterwasserpioniere überraschen die Forscher immer wieder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Einige Tiefseebewohner orientieren sich offenbar an den Geräuschen, die ein Unterwasser-Schlot von sich gibt. Wird das Brodeln unter dem Meeresboden zu stark, verlassen beispielsweise Tiefseegarnelen ihren angestammten Vulkan und treiben so lange mit den Strömungen durch den Ozean, bis ihnen die Geräuschkulisse eines anderen besser gefällt. Sicher soll der neue Wohnort sein, aber gleichzeitig über ausreichend Hitze und Chemikalien verfügen. Alle nötigen Informationen entnehmen die winzigen Krustentiere dem Sound der Feuerberge. Extrem an das Leben auf dem Vulkan ist eine Sittichart angepasst, die sich auf dem Masaya niedergelassen hat, dem höchsten Vulkan Nicaraguas. Jeden Morgen erhebt sich der grüne Vogel wie ein Phönix aus der Asche seiner heißen Bruthöhle. Niemand weiß bisher, wie es der Vogel in dieser unwirtlichen Umgebung schafft, seine Jungen aufzuziehen. Allein die Konzentration von Schwefel in der Luft sollte den grünen Flieger zum Absturz bringen. In einzigartigen Bildern erzählt „Leben auf dem Vulkan“ von den Strategien der großen und kleinen Überlebenden gewaltiger Vulkanausbrüche, von Opportunisten und Pionieren. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 10.08.2014 ZDF Leonardo da Vinci – Der Genie-Code
45 Min.Leonardo da Vinci ist der Inbegriff des Genies. Und doch liegt sein Leben bis heute in rätselhaftem Dunkel. Um die Wirklichkeit zu verstehen, überschritt er alle Grenzen. Ist ihm das zum Verhängnis geworden? Seine Geheimnisse zeichnete in rätselhafter Schrift auf Tausenden von Seiten auf. Enthalten sie einen geheimen Code? Er schuf die berühmtesten Gemälde der Welt. Jeder kennt seine Mona Lisa und ihr geheimnisvolles Lächeln. Welche geheimen Botschaften hat er darin hinterlassen? (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 15.03.2009 ZDF Leonardo da Vinci – Was erfand er wirklich?
Leonardo da Vinci gilt als eins der größten Genies aller Zeiten. Doch neueste Forschung enthüllt, dass viele seiner Ideen schon existierten, bevor er sie in seinen Zeichnungen festhielt. Leonardo hat viele Rätsel aufgegeben. Seine viele Tausend Seiten umfassenden Aufzeichnungen enthalten futuristische Kriegsmaschinen und Flugapparate. Aber ist er wirklich ihr Schöpfer, oder ist seine Leistung eher, dass er die Erfindungen seiner Zeit sammelte? Leonardo da Vinci wird als brillanter Erfinder gefeiert, und viele seiner visionären Entwürfe begegnen uns tagtäglich. Er gilt als der Entwickler des Kugellagers, der Tauchglocke und unzähliger Flugapparate.Mit Hilfe eines Teams internationaler Experten folgt „Terra X“ der Frage, ob einige Erfindungen möglicherweise voreilig Leonardo da Vinci zugeschrieben worden sind. Eine Antwort lässt sich in Leonardos Arbeitsbüchern finden. Etwa 7000 von rund 13 000 Seiten sind erhalten, gefüllt mit Zeichnungen und Notizen in einer schwer entzifferbaren Spiegelschrift. Wissenschaftler verglichen Zeichnungen aus dem 15. Jahrhundert des berühmten Ingenieurs Mariano di Jacopo, besser bekannt als Taccola, mit den Skizzen Leonardos. Parallelen zwischen Taccolas Aufzeichnungen und Leonardos Notizbüchern sind deutlich zu erkennen. Und es gibt Belege dafür, dass Leonardo da Vinci die Schriften des 70 Jahre älteren Taccola tatsächlich kannte. In seiner Bibliothek wurde ein Buch von Taccola mit Leonardos handschriftlichen Notizen gefunden. Ein darin skizzierter Fallschirm findet sich etwa auch in den Büchern Leonardos. Eine Erfindung, die ebenfalls Leonardo da Vinci zugesprochen wird, ist eine Kriegsmaschine, die ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus war: der Panzer. Doch Historiker sind überzeugt, dass der Panzer in Grundzügen schon lange zuvor entworfen worden war. Knapp 50 Jahre vor Leonardos Geburt erscheint das Werk „Bellifortis“, eine bebilderte Handschrift, die sich der Kriegskunst widmet. Im „Bellifortis“ ist ein Panzer dargestellt, der dem von Leonardo stark ähnelt. Vermutlich übernahm Leonardo Jahrzehnte später einzelne Details aus diesen Entwürfen für seinen eigenen, komplexeren Panzer. Szenisch belebt durch anspruchsvolle Reinszenierungen, führt die „Terra X“-Dokumentation an Originalschauplätze, rekonstruiert bemerkenswerte Erfindungen mit Hilfe von 3D-Animationen und zeigt, dass es vor allem Leonardos Verdienst ist, dass Wissen wiederentdeckt, weiterentwickelt und für die Nachwelt erhalten wurde. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Do. 29.03.2018 ZDFmediathek (ab 19:30 Uhr) Deutsche TV-Premiere Fr. 30.03.2018 ZDF Erstausstrahlung ursprünglich für den 29.03.2018 angekündigtLeoparden – Der lautlose Tod
Der letzte Neandertaler
Die letzten Geheimnisse des Orients: 1. Auf den Spuren alter Kulte
45 Min.Der Orient: faszinierende Wiege der Religionen.Bild: THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Katrin Sandmann./Katrin Sandmann/Katrin SandmannZwischen den prächtigen Ruinen untergegangener Imperien spürt der Orientalist Daniel Gerlach mysteriöse Kulturen des Morgenlandes auf, die bis heute im Verborgenen weiterleben.Was hat es mit diesen rätselhaften Geheimreligionen des alten Orients auf sich und welchen Einfluss hatten sie in der Vergangenheit auf die christliche Kultur Europas? Diesen Fragen geht Daniel Gerlach auf einer Reise zwischen Mittelmeer und Zweistromland nach. Kaum eine Weltregion übt stärkere Faszination auf die Menschen im Abendland aus als der Orient. Im Nahen Osten liegt die Wiege der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Auch wenn wir diese Region heute mit Krieg und Terror in Verbindung bringen, war und ist sie auch Schauplatz kultureller und religiöser Vielfalt. Von dieser wenig beleuchteten Seite des Morgenlandes erzählt der Film. In der ersten Folge begibt sich Daniel Gerlach auf eine Abenteuerreise zu faszinierenden Schauplätzen, die ein Licht auf die Frühgeschichte des Christentums werfen. Im heutigen Libanon besucht er die monumentalen Ruinen von Baalbek. Hat das Christentum hier Elemente anderer, älterer Kulturen übernommen? Im Irak ist dieses Erbe des Alten Orients noch immer lebendig. Hier spürt Gerlach die Mandäer auf, Anhänger einer uralten Religion, deren höchster Prophet Johannes der Täufer ist und die einige Rituale noch wie zurzeit Christi begehen. Etwas weiter nördlich, nahe der heutigen irakischen Hauptstadt Bagdad, tritt Gerlach in den prächtigen Überresten gigantischer Palastanlagen eine Zeitreise in das Reich der Sassaniden an, die nicht das Kreuz, sondern das Feuer anbeteten. Bis heute gibt es im Irak die sogenannten Zoroastrier, die sich auf den Propheten Zarathustra berufen, der im ersten oder zweiten Jahrtausend vor Christus lebte und dessen Lehren großen Einfluss auf die Religionen des Orients hatten. In der vom Islamischen Staat zerstörten Stadt Mossul und im ägyptischen Kairo begibt sich Daniel Gerlach auf die Spuren der Ostkirche, in der die Christen des Vorderen Orients ihre spezifische Form des Glaubens und Überzeugungen bewahrt haben, die sich von denen des Westens bis heute unterscheiden. Was hat es mit den alten Kulten und zum Teil verschwiegenen Religionsgemeinschaften auf sich? Welche Rolle spielen sie für uns in Europa? Antworten auf diese Fragen sucht Gerlach bei hohen Geistlichen, ehrwürdigen Scheichs, alten Freunden und einfachen Gläubigen. Dabei erfährt er, mit welchen erstaunlichen Mitteln in der Region um Einfluss gerungen wird und wie Minderheiten immer wieder zum Spielball der Politik wurden. Daniel Gerlach nimmt an Feuerzeremonien und mysteriösen Taufritualen teil und besucht auf dieser Reise manchmal unbekannte, aber spektakuläre Schauplätze des alten Orients und findet Geheimnisse dieser faszinierenden Region, deren Erbe Europa zum Aufstieg verhalf. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 31.08.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 04.09.2022 ZDF Die letzten Geheimnisse des Orients: 2. Verborgene Welten des Islam
45 Min.Daniel Gerlach vor der Skyline von Kairo.Bild: THE HISTORY CHANNEL / ZDF und Katrin Sandmann./Katrin Sandmann/Katrin SandmannIn diesem Teil seiner Orientreise besucht Daniel Gerlach Religionsgemeinschaften, die im Schatten des dominierenden Islam bis heute weiterleben.Erzählen verschwiegene Derwisch-Orden und rätselhafte Geheimreligionen wie Drusen und Jesiden eine andere Geschichte des Islam? Zwischen dem Irak, Ägypten und Israel spürt der Orientalist alte Mythen und lebendige Kulte auf, die viele Überraschungen bergen. Die filmische Reise beginnt in Jerusalem, der Hauptstadt der monotheistischen Religionen. Nirgendwo auf der Welt wird deutlicher, wie die Überlieferung der abrahamitischen Religionen ineinander verwoben ist. Das gilt auch für den Koran, der jüdisches und christliches Erbe verarbeitet, dabei aber den Anspruch auf die endgültige Deutung erhebt, sozusagen „als letztes Update des Betriebssystems“, wie Gerlach sagt. Von Jerusalem aus geht die Reise weiter ins jordanische Petra. Die prächtige Felsenstadt der Nabatäer ist eines der eindrucksvollsten Zeugnisse antiker Zivilisation. In Begleitung einer jordanischen Prinzessin erkundet Gerlach die atemberaubenden Ruinen, die das Narrativ widerlegen, dass die Araber vor der Ankunft des Islam nur Beduinen gewesen seien. Tatsächlich waren sie bereits Schöpfer hochkomplexer, städtischer Zivilisation. Im Irak folgt er den Spuren eines schiitischen Erlösers, der irgendwann spurlos verschwunden ist, und findet sich in einer Pilgerstadt am Euphrat wieder, die mit bis zu 18 Millionen Pilgern jährlich die wohl größte Menschenansammlung der Welt beherbergt. Das Verlangen vieler Schiiten, den Glauben unmittelbar zu erleben und Gott direkt zu begegnen, führt ihn weiter zu den Sufis nach Ägypten. Dort, mitten in der Wüste, begehen Gläubige alljährlich ein mehrtägiges religiöses Fest mit geheimnisvollen, alten Ritualen. Hier kommt die Mystik ins Spiel, die Gerlach auch bei der Gemeinschaft der Drusen findet, einer weiteren „Geheimreligion“, die wenig von ihrem Glauben preisgibt. Nur so viel: Sie glaubt an die Seelenwanderung. Auf seiner Reise bekommt Gerlach das wohl kostbarste Koran-Manuskript der Welt in die Hände und begegnet einer schwarzen Schlange, die im Alten Orient als magisches Symbol für Macht und Geborgenheit steht. Er trifft Angehörige der Glaubensgemeinschaft der Jesiden im Nordirak, die einen Engel in der Gestalt eines blauen Pfaus verehren. Bei seinen Erkundungen erfährt er auch, mit welchen erstaunlichen Mitteln in der Region um Einfluss gerungen wird und wie Minderheiten immer wieder zum Spielball internationaler Mächte wurden. Auch in diesem Teil seiner Reise zu faszinierenden Schauplätzen des alten Orients entschlüsselt Gerlach das versteckte und manchmal vergessene Erbe einer Weltgegend, die Europa einst zum Aufstieg verhalf. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 31.08.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 11.09.2022 ZDF Die letzten Geheimnisse des Orients: 3. 1001 Legende
45 Min.Der Orient steckt voller Legenden, wie die berühmten Märchen aus 1001 Nacht. Der Orientalist Daniel Gerlach macht sich auf die Suche nach den wahren Geschichten hinter den Erzählungen. Geheimnisvolle Kulte, märchenhafte Paläste und verführerische Frauen prägen das Bild des Morgenlandes in Europa. Dabei haben Orient und Okzident mehr gemein als oft vermutet. Immer wieder haben Reisende in der Vergangenheit Spuren hinterlassen – in beiden Welten. Schon als die ersten europäischen Entdecker ins Morgenland reisten, suchten sie dort nach den Schauplätzen großer Mythen und biblischer Geschichten.Von Venedig aus, der Stadt, die sich bis heute rühmt, die „Porta d’Oriente“, „das Tor zum Orient“, zu sein, begibt sich Daniel Gerlach auf eine ähnliche Mission. Fast jeder kennt die biblischen Geschichten von Moses und Abraham, die ihren Ursprung im Orient haben. Aber über die Jahrhunderte haben auch orientalische Erzählungen die westliche Kultur geprägt – die Märchen aus 1001 Nacht etwa, mit ihren Erzählungen über die Klugheit der schönen Prinzessin Scheherazade und der Abenteuerlust des Seefahrers Sindbad. Die Suche nach den Ursprüngen alter Legenden führt Daniel Gerlach vor die Küste des Oman, wo er nach mysteriösen Seeungeheuern Ausschau hält. Mitten in der irakischen Wüste erkundet er ein sagenumwobenes Kalifen-Schloss aus dem goldenen Zeitalter der Abbasiden. Im Haschemitischen Königreich Jordanien trifft er auf die Erben eines kaukasischen Volkes, das nicht nur durch die Tapferkeit seiner Krieger die Geschicke manches Herrscherhauses im Nahen Osten lenkte, sondern vor allem durch die Schönheit seiner Frauen. Die Tscherkessinnen prägten auch lange Zeit die Vorstellung der Haremsdame in Europa. Aber, was hat es mit dem Klischee des Orients auf sich, eine lustfeindliche Gegend und gleichzeitig Sündenpfuhl zu sein? Im ägyptischen Alexandria, der irakischen Hauptstadt Bagdad, der antiken Stadt Jerasch in Jordanien und in der wohl berühmteste Ruinenstadt des Orients, Babylon, findet Daniel Gerlach erstaunliche Hinweise auf das gemeinsame kulturelle Erbe von Orient und Okzident. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 20.11.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 24.11.2024 ZDF Die letzten Geheimnisse des Orients: 4. Mystische Orte
45 Min.Die frühen Hochkulturen des Nahen Ostens geben bis heute Rätsel auf. Der Orientalist Daniel Gerlach besucht sagenumwobene Schauplätze der Geschichte, um ihre letzten Geheimnisse zu lüften. An den entlegensten Orten im Orient kann man Spuren vergessener Kulturen und untergegangener Königreiche finden. Sie zeugen von großen Herrschern, frühen Astronomen und auch davon, wie Ideen und Glaubensvorstellungen von einer Kultur zu anderen wandern. Im Orient entstanden Mythen und Legenden, die das Morgenland bis heute mit dem Abendland verbinden. An kaum einem anderen Ort der Welt finden sich die Spuren so vieler, zum Teil vergessener Kulturen, die langsam wieder aus dem Vergessen auftauchen.Sei es durch uralte Überlieferungen oder neue Ausgrabungen und Funde. Daniel Gerlach durchreist bei seiner Suche nach verwunschenen Orten spektakuläre Landschaften, die von alten Herrschern und Völkern erzählen und Schauplatz historischer Ereignisse waren. Sein Weg führt in eine prächtige Totenstadt in der Wüste Saudi-Arabiens, von der sich Forscher neuen Aufschluss über den plötzlichen Untergang der einst mächtigen Nabatäer erhoffen und bereits Erstaunliches über die Rolle der Frau in der damaligen Zeit entdeckten. Am äußersten Rande der Türkei im alten Obermesopotamien besucht er auf dem Berg Nemrut Dağı die Kultstätte eines Königs, der sich mit den Göttern gleichsetzte und dessen Grabstätte ihre letzten Geheimnisse bis heute nicht preisgegeben hat. Auf der Insel Sokotra findet er nicht nur Spuren des Ur-„Robinson Crusoe“, sondern auch Erinnerungen an den ersten Mord aus Eifersucht in der Geschichte der Menschheit. An all diesen Orten steht die Frage im Vordergrund: Was ist dort tatsächlich geschehen, und was gehört ins Reich der Fantasie? (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 20.11.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 01.12.2024 ZDF Die letzten Geheimnisse des Orients: 5. Rückkehr nach Syrien
45 Min.Nach dem Sturz des Assad-Regimes reist der Orient-Experte Daniel Gerlach nach Syrien, um herauszufinden, wie es um die Menschen des Vielvölkerstaates und die Kulturdenkmäler des Landes steht. 13 Jahre Bürgerkrieg und mehr als 50 Jahre Diktatur haben in Syrien Spuren hinterlassen. Nicht nur die Bevölkerung, auch die zum Teil jahrtausendealten archäologischen Stätten haben gelitten. Die Syrer hoffen auf eine bessere Zukunft, aber sie sind skeptisch. Syrien ist ein Land so alt wie die Zeit. Akkader, Assyrer, Hethiter und später auch Griechen, Römer, Kreuzfahrer und Osmanen kamen und gingen.Sie alle hinterließen Spuren und machten Syrien damit zu einer einzigartigen Schatzkammer der Menschheit. Direkt nach dem Sturz des Assad-Regimes eröffnet sich für den Orient-Experten Daniel Gerlach erstmals seit 2011 die Möglichkeit, dieses faszinierende Land mit seiner reichen Geschichte und unzähligen archäologischen Stätten neu zu entdecken und dabei eine Bestandsaufnahme der durch den Bürgerkrieg verursachten Zerstörungen zu machen. Seine Reise führt ihn zu verschiedenen UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten: von Bosra im Süden des Landes bis nach Aleppo und Palmyra. In der Wüstenstadt haben Fundamentalisten des Islamischen Staates im Jahr 2015 einen Teil der Kulturgüter zerstört und bewusst Menschen umgebracht, die sich für deren Schutz einsetzten. Die Fanatiker wollten damals nicht nur die Vergangenheit auslöschen, sondern auch die Zukunft der dortigen Menschen, denn das kulturelle Erbe des Landes ist untrennbar mit seinen Bewohnern verbunden. Millionen Syrer haben während des Bürgerkrieges ihre Heimat verlassen. Jetzt gibt es Hoffnung auf Rückkehr und Versöhnung. Daniel Gerlach trifft auf seiner Reise alte Freunde und Bekannte, aber auch Vertreter unterschiedlichster Glaubensgemeinschaften, die sich der Aufgabe verschrieben haben, die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, die durch den Krieg noch verstärkt wurde. Sie sehen sich nicht als Sieger oder Besiegte, Sunniten, Drusen oder Alawiten, sondern als Syrer, die Gewalt ablehnen und respektvoll miteinander leben wollen. Der Sturz des Assad-Regimes bietet die Möglichkeit für einen gemeinsamen Neuanfang. Doch es gibt auch Skepsis gegenüber der neuen, strengreligiösen Regierung, die sich nach ihrem überraschenden Siegeszug jetzt im Alltag bewähren muss. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 23.04.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 27.04.2025 ZDF Die letzten Jahre von Pompeji
Die letzten Minuten – Archäologie auf Schlachtfeldern
45 Min.Große Schlachten veränderten den Lauf der Weltgeschichte, sie gruben sich tief ein in das kollektive Bewusstsein von Nationen und wurden zu Synonymen für ganze Generationen. Doch was steht hinter Namen wie Waterloo, Verdun oder Stalingrad? Schlachtfeldarchäologen stoßen bei ihrer Arbeit auf die Schicksale der beteiligten Soldaten und verschaffen uns so einen neuen, sehr persönlichen Blick auf die kriegerischen Wendepunkte unserer Geschichte. Es ist die Rekonstruktion der letzten Minuten im Leben der Gefallenen. Bei Waterloo, wo der Schauplatz der letzten Schlacht Napoleons längst von Feldern überdeckt ist, finden Archäologen fast zwei Jahrhunderte nach dem Geschehen einen gefallenen Soldaten.Der junge Mann war Infanterist, hatte Arthrose in den Füßen, deutsche Pfennig-Münzen in der Geldbörse und wurde von einer französischen Kugel getötet. Auch mitten in Deutschland finden Archäologen Spuren des napoleonischen Größenwahns: In Leipzig, zwei Jahre vor Waterloo der Ort einer Völkerschlacht, bergen Spezialisten des sächsischen Landesamtes für Archäologie immer wieder Skelette und Ausrüstung. Heute unterscheiden nur noch die Uniformknöpfe Freund und Feind. In Verdun ist das „Terra X“-Team exklusiv dabei, als ein deutsch-französisches Forscherteam ein unterirdisches Kampfstollensystem zum ersten Mal seit dem Ersten Weltkrieg wieder betritt. Dabei treffen sie auf die persönlichen Zeugnisse der Soldaten, die im Stellungskrieg kämpften, lebten und starben. In Stalingrad versucht eine Grabungskampagne, Gefallenen zu identifizieren, die Angehörigen zu verständigen und ihnen ein würdiges Grab zu geben. Eine Mammutaufgabe, denn noch über hunderttausend Deutsche und Russen sind in Stalingrad vermisst. „Die letzten Minuten“ – erzählt von all den Namenlosen, die in den großen Schlachten der Geschichte ihr Leben lassen mussten. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 17.03.2013 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail