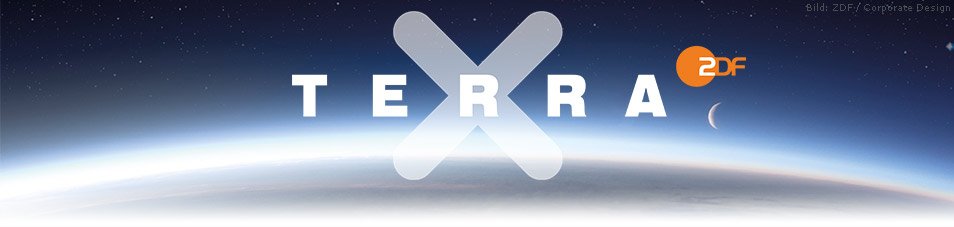1525 Folgen erfasst (Seite 35)
Morgenland: 2. Mit den Schwertern des Geistes
45 Min.Die zweite Folge der dreiteiligen Reihe „Morgenland“ berichtet von den „Schwertern des Geistes“: So umschrieben die Muslime im Mittelalter die Wissenschaften und Künste. Das waren Waffen, die sie weit besser als ihre europäischen Zeitgenossen zu nutzen wussten. In den islamischen Großreichen zwischen Südspanien und dem Himalaja erblühte eine Hochkultur, wie sie die Welt bis dahin nicht gesehen hatte: das goldene Zeitalter des Islam. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 21.05.2009 ZDF Morgenland: 3. Imperien am Scheideweg
45 Min.Der letzte Teil der dreiteiligen Reihe „Morgenland“ erzählt 400 Jahre Weltgeschichte: Im Jahr 1683 erzittert das Abendland ein letztes Mal vor dem Islam – als der osmanische Großangriff auf Wien verhindert wird. Zugleich tauchen muslimische Piraten an Europas Küsten auf, treiben Sklavenhandel mit Christen. Das Zeitalter der Entdeckungen ist in vollem Gange – aber es findet ohne die Muslime statt. Der europäische Kolonialismus erblüht und bedrängt die großen islamischen Imperien. Die Gegensätze verhärten sich – aber gleichzeitig steigt in Europa das Interesse an Poesie und Exotik des Morgenlandes. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 24.05.2009 ZDF Mumienkult in Tibet – Das Geheimnis der Mönche
Musik: 1. Große Gefühle
45 Min.Das Banjo von Dr. Leonard Husseys, Meteorologe an Bord der Endurance, mit den Unterschriften der Mannschaft.Bild: ZDF und Februar Film GmbHMusik ist die universelle Sprache der Gefühle – eine ständige Verbündete mit direkter Wirkung auf Herz und Hirn. „Terra X“ entdeckt die emotionale Wechselwirkung von Musik und Lebensgefühl. Musik erzählt von Liebe und Glück, von Trauer und Wut. Musik kann verführerisch sein, Ängste schüren oder vertreiben. Rhythmus, Klang und Melodie besitzen eine magische Kraft. Forscher erklären, wie Musik entstanden ist und warum sie uns so viel bedeutet. Als Wissenschaftler den Urknall hörbar machen, entdecken sie auch die Geburtsstunde der Musik.Der erste Sound der Welt ist so alt wie das Universum selbst. Vor mehr als 165 Millionen Jahren erzeugen Grillen den ersten Rhythmus. Vor rund 30.000 Jahren folgt die Melodie – als Singsang der Mutter für ihr Kind. Seit der Mensch angefangen hat, aus Geräuschen, Rhythmen und Klängen Melodien zu erschaffen, beeinflusst Musik das Leben jedes Einzelnen – vom Mutterleib bis zum Tod. Zu den stärksten Motiven der Musik gehört die Liebe. Das älteste bekannte Liebeslied haben Forscher in einem ägyptischen Grabmal gefunden. Den Teilnehmern der „Endurance“-Expedition von Ernest Shackleton hilft Musik, um ihre katastrophale Situation zu überstehen. Als ihr Schiff im Eis der Antarktis stecken bleibt, singt die Crew im Bauch des Schiffes allabendlich zum Banjo. Nur so, berichten viele später, hätten sie die Krise überlebt. Der griechische Philosoph Pythagoras gilt als Pionier der systematischen Auseinandersetzung mit Musik. Er experimentiert mit Klängen und dem Verhältnis der Töne zueinander. Damit legt er den Grundstein der Musiktheorie in der westlichen Welt. Heute haben Akustiker das Wissen um Klänge und Raum längst perfektioniert. Brian Katz von der Pariser Sorbonne kann nach dem Brand des Dachstuhls von Notre-Dame die einmalige „Stimme“ der Kathedrale mit akustischen Messungen und Computersimulationen rekonstruieren. Mit dem ersten Druck von Noten, für die Ottaviano Petrucci 1502 in Venedig das Patent anmeldet, nimmt die Verbreitung von Musik an Fahrt auf. Mit dem Phonographen von Thomas Edison, mit Vinyl und Radio beschleunigt sich diese Entwicklung rasant. Heute sind Abermillionen Songs und Kompositionen jederzeit verfügbar. Die erste Folge dieser „Terra X“-Reihe sucht nach den Ursprüngen der Musik und erzählt, warum sie eine solche Macht über uns hat. Wissenschaftler und Musiker wie Moby und die Hornistin der Berliner Philharmoniker, Sarah Willis, thematisieren in Interviews die einzigartige Wirkkraft von Musik. Lillo Scrimali, einer der bekanntesten deutschen Arrangeure der Pop-Gegenwart, und Musiker von den „Die fantastischen Vier“ und „The Voice of Germany“ begleitet die Doku instrumental. Es singen die Soul-Interpreten Rachel Scharnberg und Jeffrey Amankwa. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 30.04.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 04.05.2025 ZDF Musik: 2. Macht der Klänge
45 Min.Bild: ZDF und Februar Film GmbHMusik kann eine unglaubliche Macht entfalten, da sie nicht nur über das Rationale funktioniert, sondern auch über das Emotionale. „Terra X“ erzählt, wie Musik unsere Geschichte beeinflusst. Schon immer wurde Musik genutzt, um Soldaten in den Krieg zu führen, Revolutionäre einzuschwören oder Massen zu begeistern. Forscher erklären, was Musik bewirkt, wenn sie als Machtinstrument eingesetzt wird, und wann sie heilsam oder zerstörerisch sein kann. Der Einsatz von Musik reicht weit zurück. Erforscht sind die etwa 60.000 Jahre alten „Songlines“ der Aborigines, die erklingen, wenn sie durch ihr Land ziehen.Sie erzählen von spirituellen Pfaden und heiligen Orten und sind Ausdruck der tiefen Verwurzelung der Ureinwohner mit ihrem Kontinent. Auch für Europäer ist Musik identitätsstiftend. Schon die Griechen singen in der Antike Hymnen. Noch preisen die Texte Götter oder Helden. In der Frühen Neuzeit werden Hymnen zum musikalischen Ausdruck nationaler Identitäten. Zu den ältesten gehört „Het Wilhelmus“. Die Nationalhymne entsteht während des Aufstands gegen die Spanier. Musik schweißt nicht nur zusammen, sie spendet auch Trost: So singen afroamerikanische Sklaven ihre „Work Songs“, um die harte, menschenunwürdige Arbeit auf den Baumwollfeldern der Südstaaten durchzuhalten. Auch das berühmte Protestlied „Bella Ciao“ ermutigt. Ob es wirklich von italienischen Partisanen gesungen wurde, darüber streiten Historiker. Sicher ist, das ursprüngliche Liebeslied wird zur berühmtesten antifaschistischen Hymne der modernen Geschichte. Dass Musik sogar Nationen retten kann, zeigt die „Singende Revolution“ im Baltikum. Ende der 1980er-Jahre machen Esten, Letten und Litauer ihre Nationalhymnen und Volkslieder zur gewaltfreien Waffe im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer. Mit Erfolg: Alle drei Länder erlangen 1991 ihre Unabhängigkeit. Musik als Machtinstrument nutzen Herrscher und Regime immer wieder für ihre Ideologien oder Propagandazwecke. Auch als Militärmusik wird Musik eingesetzt – ob bei den Legionen der Römer, bei Napoleons Armee oder im Vietnamkrieg. Musik als Folter ist noch heute in manchen Ländern an der Tagesordnung. Seelische und körperliche Schäden sind die Folge. Musik kann aber auch therapeutischen Nutzen bringen. Im norwegischen Bergen haben Wissenschaftler herausgefunden, wie Musik bei Alzheimer-Patienten wie eine Frischzellenkur wirkt. Diese Folge der „Terra X“-Reihe „Musik“ erzählt, wie uns die Macht der Klänge zu Höchstleistungen motiviert, Erinnerungen wachruft, aber auch zur Gefahr werden kann. Dazu werden unter anderen der Musiker Moby und der Komponist Ramin Djawadi befragt, der mit der Titelmusik für die Kultserie „Game of Thrones“ weltberühmt wurde. Außerdem kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort: Wie kann Musik gezielt eingesetzt werden, um Menschen, ihr Handeln und ihre Emotionen zu beeinflussen? (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 30.04.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 11.05.2025 ZDF Mutige Mozu – Ein Schneeaffe in Japan
Mythos Ägypten – Hatschepsut die Große
45 Min.Hatschepsut ist die erste namentlich bekannte Frauengestalt der Geschichte, die in herausragender Weise die Geschicke ihrer Zeit geprägt hat. Im 15. Jahrhundert vor Christus – lange vor der Ptolemäerkönigin Kleopatra – bestieg sie den Pharaonenthron und herrschte mehr als 20 Jahre über das Reich am Nil. Sie ließ das gigantische Terrassen-Heiligtum von Deir el-Bahari bei Luxor errichten, längst einer der bekanntesten Tempel Ägyptens und Magnet für Touristenscharen. Als ihr Gatte Thutmosis II. starb, ergriff seine junge Witwe Hatschepsut die Macht und trat mit 16 Jahren aus der traditionellen Frauenrolle im Alten Ägypten heraus.Als Preis für den Thron veränderte sie ihr veröffentlichtes Bild und befahl, sie auf Wandmalereien und Statuen nur noch als Mann darzustellen. Inschriften preisen die Schönheit der „Tochter des Sonnengottes“. Hatschepsuts erfolgreiche Regentschaft brachte ihren Untertanen Frieden und Wohlstand. Bis in das geheimnisumwitterte Land Punt schickte die Königin ihre Handelsschiffe. Besonders das ungeklärte enge Verhältnis zu ihrem Vertrauten und Kanzler Senenmut, den sie später verstieß und verfemte, hat die Fantasie der Nachwelt angeregt. Noch heute sind nicht nur viele Facetten im Leben der Hatschepsut rätselhaft, sondern vor allem die Umstände ihres Todes und die Zerstörung ihrer Statuen und Inschriften. Bisher waren Experten davon überzeugt, Thutmosis III., Stiefsohn und Nachfolger der Pharaonin, habe aus Rachsucht und Hass die Erinnerungen an die beliebte Landesmutter ausgelöscht. Neuere Erkenntnisse von Archäologen widerlegen dies jedoch. Bei Grabungen in Ägypten und Forschungen in international renommierten Museen werden alle Fakten zusammengetragen, um ein vollständiges Bild der großen Herrscherin zu entwerfen, das sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder stark gewandelt hat. Der Film lässt führende Hatschepsut-Spezialisten zu Wort kommen. Auch Wissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen wie Sylvia Schoske, Joyce Tyldesley und Pauline Gedge hat das außergewöhnliche Schicksal der emanzipierten Königin inspiriert. Über Hatschepsuts Ende ist nur der ungefähre Zeitpunkt bekannt. Wurde sie gewaltsam vom Thron verdrängt? Oder gar von ihrem Nachfolger Thutmosis III. ermordet? Nach dem Tod der Regentin sollte ihr Andenken jedenfalls schnell ausgelöscht werden. Ihre Obelisken im Karnak-Tempel wurden ummauert, ihre Statuen verstümmelt und die Namenskartuschen und Reliefs in ihren Kultstätten ausgemeißelt. Die Spuren der brutalen Zerstörung sind noch heute in der Anlage von Deir el-Bahari deutlich zu erkennen. Sogar den einzigartigen Bauplan des gewaltigen Heiligtums griffen spätere Architekten nie wieder auf – nur um die Erinnerung an die Regentin nicht aufleben zu lassen. Ihr Name verschwand. In den Königslisten taucht er nicht mehr auf. Denn eine Pharaonin entsprach nach herkömmlicher Vorstellung nicht den göttlichen Vorgaben. Erst im 19. Jahrhundert wurde Hatschepsut wieder entdeckt, als Archäologen auf einen seltsamen „König“ stießen, der eine weibliche Figur hatte und weibliche Titel trug. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 22.05.2005 ZDF Mythos Ägypten – Im Bann des großen Ramses (1)
45 Min.Giovanni Belzoni zählt zu den schillerndsten Figuren, die seit Ende des 18. Jahrhunderts das Alte Ägypten erforschen. Seine einzigartige Karriere vom Zirkusartisten zu einem der großen Entdecker antiker Schätze verdankt der Mann aus Padua dem puren Zufall. „Im Bann des großen Ramses“ erzählt das bewegte Leben eines ungewöhnlichen Mannes und blättert eine der spannendsten Epochen der Erforschung des Alten Ägyptens auf. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 13.08.2006 ZDF Mythos Ägypten – Im Bann des großen Ramses (2)
45 Min.Deutsche TV-Premiere So. 20.08.2006 ZDF Mythos Ägypten – Wettlauf um den Hieroglyphen-Code (1)
45 Min.Jean-François Champollion war ein Genie unter den Gelehrten seiner Zeit. Bereits mit 17 Jahren beherrschte er ein halbes Dutzend alter Sprachen und verkündete selbstbewusst, die altägyptischen Hieroglyphen entziffern zu wollen. Doch auch der Arzt und Physiker Thomas Young brütete über den mysteriösen Zeichen. Erste Folge der Doku „Mythos Ägypten: Wettlauf um den Hieroglyphen-Code“ über die Erforschung des ägyptischen Altertums und die Entschlüsselung der Hieroglyphen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 27.08.2006 ZDF Mythos Ägypten – Wettlauf um den Hieroglyphen-Code (2)
45 Min.Deutsche TV-Premiere So. 03.09.2006 ZDF Mythos Burg: 1. Feste Heimat
45 Min.Die „Terra X“-Dokumentation „Mythos Burg“ beleuchtet, wie die Burg als Wohn- und Wehrbau zum architektonischen Erfolgsmodell des Mittelalters wurde. Wie prachtvoll oder wie entbehrungsreich war das Leben auf den Burgen des Mittelalters? Diese Folge beleuchtet die aufregende Vergangenheit berühmter Burgen – wie etwa Burg Eltz an der Mosel oder Windsor Castle in England. Im 12. und 13. Jahrhundert erlebte Mitteleuropa einen Bauboom. Innerhalb von 100 Jahren wurden weit über 10 000 Burgen gebaut. Und bereits zuvor hatte sich die Burg als Statussymbol der Mächtigen und als effektiver Wohn- und Wehrbau europaweit durchgesetzt. Wären all die Monumente der Macht noch erhalten, würden wir etwa in Deutschland alle 25 Kilometer an einer Burg vorbeifahren.Bis heute hat das Zeitalter der Burgen und ihrer Bewohner Spuren in unserer Kultur und Sprache hinterlassen. So steckt allein in weit über tausend deutschen Ortsnamen das Wort „Burg“. Diese Folge der „Terra X“-Reihe „Mythos Burg“ widmet sich der Immobilie „Burg“. Schon ihr Urtyp – die Motte – ist genauso schlicht wie genial: Errichte einen Turm, möglichst auf erhöhtem Posten, mit weitem Panoramablick und ziehe einen Zaun oder eine Mauer außen herum. Fertig ist die Burg. Ein Erfolgsmodell: Über die Jahrhunderte entstehen immer komplexere und prachtvollere Bauten. Der Wettbewerb um die schönste, größte und mächtigste Burg war eröffnet. Europa wird zu einer Burgenlandschaft. Im Mittelpunkt der zweiteiligen Dokumentation stehen berühmte und seinerzeit sehr bedeutende Bauten wie Burg Eltz, Burg Hammerstein, Burg Trifels und auch Windsor Castle in England. Wie und wo wurden Burgen gebaut, wie lebten die Menschen auf ihnen, wie verteidigten sie ihr Zuhause? Mithilfe verschiedener visueller Stilmittel wird den Bollwerken von einst Leben eingehaucht. International renommierte Wissenschaftler zeigen im Experiment, mit welch ausgefeilten Methoden die Burgen des Mittelalters errichtet und bewohnt wurden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 14.08.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 18.08.2019 ZDF Mythos Burg: 2. Bollwerk der Macht
45 Min.Dieser Teil der „Terra X“-Reihe „Mythos Burg“ beleuchtet die Burg als erfolgreichen Wehrbau und taucht mit großen Bildern und Reenactments tief in die Welt des Mittelalters ein. Was sind die raffiniertesten Wege, eine Burg zu erobern? Und wie kann eine Burgbesatzung einer monatelangen Belagerung standhalten? Diese Folge lässt auf wissenschaftlicher Basis berühmte Burgen wiederauferstehen. Sie waren einst das weithin sichtbare Statussymbol der Macht. Burgen waren Wirtschaftszentren, Heimstatt von Raubrittern und Schauplätze von Kriegen.Hinter ihren steinernen Mauern wurden kostbarste Schätze verwahrt, und angeblich schmorten in dunklen Kerkern Gefangene bis an ihr Lebensende. Bis heute entführen uns Burgen in eine Welt der Märchen und Legenden. Was ist wahr, und was ist Mythos? In der Folge „Bollwerk der Macht“ fokussiert die „Terra X“-Reihe die Burg als strategischen Wehrbau. Wie entwickelten sich die ersten Burgentypen zu wehrhaften Festungen? Was sind die erfolgreichsten Methoden, eine Burg zu erobern oder zu halten? Wissenschaftler zeigen etwa mit einem originalgetreuen Nachbau, wie durchschlagskräftig und zielgenau die Blide – ein schweres Wurfgerät des Mittelalters – Burgen angreifen und zerstören konnte. International renommierte Wissenschaftler erklären in Experimenten die neuralgischen Stellen einer Burg und zeigen auf, wie Burgherren ihre Bollwerke gegen die fortschreitende Entwicklung der Feuerwaffen rüsteten. Fotorealistische 3-D-Animationen lassen aus realen Ruinen berühmter Burgen mächtige Festungen werden und beleuchten, wie der Mythos „Burg“ entstehen konnte. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 14.08.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 25.08.2019 ZDF Mythos Frankenstein
Hat der Name der Burg Frankenstein im Odenwald Mary Shelley zu ihrem Romantitel inspiriert?Bild: History / ZDF / Oliver HalmburgerDie Geschichte von Frankenstein und seiner Kreatur ist heute so aktuell wie nie zuvor. „Terra X“ zeigt, was der 200 Jahre alte Stoff mit Genforschern und Robotern von heute zu tun hat. Mary Shelleys Roman „Frankenstein oder der moderne Prometheus“ handelt vordergründig von einem schaurigen, mordenden Monster. In Wirklichkeit geht es um die Grenzen wissenschaftlichen Strebens, um Moral und um die Frage, was den Menschen zum Menschen macht. Ihr Material fand die 19-jährige Autorin in den philosophischen Hauptthemen ihrer Zeit. Anfang des 19. Jahrhunderts scheint die Menschheit kurz davor zu stehen, selbst zum Schöpfer von Leben zu werden.Der Arzt Luigi Galvani entdeckte, dass durch Stromstöße Muskelbewegungen erzeugt werden können – auch bei toten Lebewesen. In Glasgow wurde die Leiche eines hingerichteten Verbrechers vor großem Publikum an eine Stromquelle angeschlossen. Der Leichnam zuckte und wand sich. Seitdem forschen Wissenschaftler an der Idee, einen Menschen künstlich zu erschaffen. Forscher bei Google oder IBM arbeiten mit Hochdruck an künstlicher Intelligenz. „Denkende“ Maschinen bringen sich selbst Strategiespiele bei und bezwingen den menschlichen Geist. Die Reproduktionsmedizin könnte heute schon das perfekte Baby kreieren, und Wissenschaftler wie George Church versuchen mit Hilfe von Gentechnik, Krankheiten auszurotten, aber auch das Mammut wieder zum Leben zu erwecken. Wo fängt menschliches Bewusstsein an, wo hört es auf? Ab wann ist es anmaßend, ins Leben einzugreifen? Diese Fragen behandelt Mary Shelley in ihrem Roman, und Wissenschaftler stellen sie sich auch heute. Genauso präsent ist die Sorge, wir könnten die Geister, die wir rufen, nicht mehr kontrollieren. „Wenn Du einen Geist in einer Flasche hast, wird er früher oder später herauskommen“, sagt der Philosoph Nick Bostrom. „Du solltest also sichergehen, dass das Wesen, das du erschaffen hast, gutmütig ist.“ „Mythos Frankenstein“ zeigt mit Hilfe von szenischen Rekonstruktionen, aktuellen Experimenten, Experteninterviews und dokumentarischen Elementen die Geschichte und die Gegenwart eines Mythos auf, der den Menschen seit der Antike beschäftigt. Experten wie der Philosoph Nick Bostrom, ein Entwickler des humanoiden Roboters „Roboy“, Alois Knoll, und der Experte für künstliche Intelligenz, Damian Borth, stellen dar, warum das faustische Erkenntnisstreben von Viktor Frankenstein mehr mit uns zu tun hat, als wir glauben. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 02.04.2017 ZDF Mythos Nordsee: 1. Wilde Küsten, Götter und segelnde Drachen
45 Min.„Terra X“ erzählt die Geschichte des Nordseeraums, von seiner Entstehung am Ende der letzten Eiszeit bis in die Gegenwart. Die Doku zeigt Völker und Nationen, deren Schicksal mit der Nordsee verwoben ist, und spürt den Mythen nach, die sich um das Meer ranken. Vom legendären Avalon über untergegangene Städte bis zum Seemannsgarn von Totenschiffen, Meeresgöttinnen und Riesenkraken. Mit einer Fläche etwa so groß wie Frankreich ist die Nordsee ein Winzling im Vergleich zu den Weltmeeren, aber für Europa, seine Entwicklung und Geschichte, von großer Bedeutung.Millionen Menschen leben an ihren Ufern, fast ein Viertel aller weltweiten Schiffsbewegungen findet hier statt, obwohl die Nordsee lediglich 0,2 Prozent der Weltmeeresfläche ausmacht. Die Geschichte ihrer Küstenbewohner ist eine Geschichte vom ewigen Kampf gegen die unberechenbaren Fluten. Er begann bereits lange vor der Zeitenwende, wie archäologische Funde belegen. Durch das Ausgreifen des Römischen Reiches nach Friesland geraten das Meer und seine Küstenlandschaften erstmals ins Blickfeld antiker Autoren. Römische Chronisten berichten von künstlichen Erdhügeln, die die Nordseevölker aufschütteten, um ihr Land vor der See zu schützen. Sie erzählen von einer merkwürdigen Welt, „nicht Meer und nicht Land“, denn der starke Gezeitenunterschied, der das Watt entstehen lässt, ist für die Mittelmeerbewohner ein ungewöhnliches Phänomen. Die Überlieferungen erzählen auch von furchterregenden Göttern, die den römischen Eroberungsgelüsten die Stirn bieten. Trotzdem gelangen im 1. Jahrhundert nach Christus der Süden und Westen der Nordsee unter römische Kontrolle. Denn nach einigen gescheiterten Versuchen, England zu erobern, gelingt es den Römern Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus schließlich, auf der Insel dauerhaft Fuß zu fassen und die lokale Bevölkerung zu unterwerfen. Erst fünf Jahrhunderte danach verändern sich die Machtverhältnisse. Der Stern des Römischen Reiches sinkt unter dem Ansturm fremder Völkerschaften. Auch England gerät ins Blickfeld germanischer Stämme. Die Invasion der Angeln und Sachsen aus dem Bereich des heutigen Schleswig-Holstein ist der historische Hintergrund einer der berühmtesten europäischen Sagen, der von König Artus und seiner sagenhaften Burg Avalon. Aber der heroische Kampf des christlichen Herrschers gegen die heidnischen Invasoren wird heutzutage von den meisten Forschern ins Reich der Legende verbannt. Von vielen Geschichten umrankt sind auch die Wikinger, die seit dem frühen Mittelalter die Küsten des Nordseeraums heimsuchen. Doch neben ihren brutalen Überfällen auf Klöster und Siedlungen werden die Wikinger selbst zu Städtegründern und Händlern, die den Nordseeraum prägen. Ihre wagemutigen Fahrten auf technisch ausgeklügelten, hochseetüchtigen Schiffen lassen sie schließlich sogar zu den ersten Entdeckern Amerikas werden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 21.10.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 25.10.2020 ZDF Mythos Nordsee: 2. Goldene Zeiten, Piraten und der Blanke Hans
45 Min.„Terra X“ erzählt die Geschichte des Nordseeraums, von seiner Entstehung am Ende der letzten Eiszeit bis in die Gegenwart. Die Doku zeigt die Völker und Nationen, deren Schicksale mit der Nordsee verwoben sind und spürt den Mythen nach, die sich um das Meer ranken, vom legendären Avalon über untergegangene Städte bis zum Seemannsgarn von Totenschiffen, Meeresgöttinnen und Riesenkraken. Mit der Hanse tritt im Mittelalter eine neue Macht im Nordseeraum auf. Aus geschäftlichen Absprachen und einem lockeren Kaufmannsbund entsteht der erste Global Player, der sogar Königreichen trotzt.Als Piraten die Nordsee unsicher machen, greift die Hanse erbarmungslos durch. Einer der Freibeuterkapitäne wird zum Mythos: Klaus Störtebeker – ein Robin Hood der Nordsee. 1588 greift eine weitere Weltmacht in den Nordseeraum ein: Spanien. Doch der Versuch König Philipps II., England zu erobern, scheitert. Der „Blanke Hans“, wie die Menschen im Norden ihre See respektvoll nennen, wird zum tödlichen Verbündeten der Engländer und ihrer Königin Elizabeth im Krieg gegen den mächtigsten Herrscher der Zeit. Seine riesige Flotte, die Armada, trifft auf einen seemännisch überlegenen Gegner und die Stürme der See. Philipps Kriegsgaleonen werden zerstört. Ein historischer Wendepunkt, der Englands Aufstieg zur unangefochtenen Seemacht markiert. Auch ein weiterer Nordseeanrainer, die Niederlande, schaffen im 17. Jahrhundert ein weltumspannendes Imperium, eine Epoche, die als „Goldenes Zeitalter“ in die Geschichte eingegangen ist. Damals entsteht der Mythos vom „Fliegenden Holländer“, einem Handelskapitän, der in seinem Hochmut Gott herausfordert und ewig segeln muss. Hochmut bringt auch die Bewohner des sagenumwobenen Rungholt, des Atlantis des Nordens, zu Fall – so die Legende. Eine Stadt, die durch den Abbau von Salztorfen reich wurde. In der wohl verheerendsten aller Nordseekatastrophen, 1362, der „groten Mandränke“, dem „großen Ertrinken“, finden angeblich 200 000 Menschen den Tod, wurden 100 000 Hektar Weideland zerstört – und Rungholt vernichtet. Sturmfluten sind von alters her eine Geißel der Nordseeküsten. Statistiken verzeichnen Dutzende teils verheerender Fluten seit der Antike. Und genauso alt ist der Versuch der Menschen, Bollwerke gegen die Wassermassen zu errichten. „Wer nicht deichen will, muss weichen“, lautet ein altes Sprichwort an der deutschen Nordseeküste. Tausende von Arbeitern, die Koyer, schufteten in früheren Zeiten mit Spaten und Karren und schufen in Generationen die ersten Bollwerke gegen die See. Doch oft genug hielten sie nicht stand, wie etwa bei der Sturmflut, die 1953 große Teile der Niederlande verwüstete und im gesamten Nordseeraum über 2000 Menschenleben kostete. Seit damals hat der Küstenschutz gigantische Ausmaße angenommen. Denn der Kampf gegen die Kräfte der Nordsee kennt keine Waffenruhe. Heute kommt modernste Technik zum Einsatz, helfen Computer, die gefürchteten Sturmfluten planbar zu machen. Zusammen genommen bilden die Wehre und Deiche der Nordsee das größte globale Bauwerk. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 28.10.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 01.11.2020 ZDF Mythos Tahiti: Die Erfindung des Paradieses
45 Min.Der Bericht des Prinzen von Nassau (Loris Rizzo) etabliert schwärmerisch einen Kult der Liebe.Bild: ZDF und Philipp Grieß.Louis Antoine de Bougainville umsegelte von 1767 bis 1769 als erster Franzose die Welt. Sein Bericht über die Inseln des Pazifik begründen den „Mythos Tahiti“. Wie entstand diese Idee vom Paradies auf Erden, von freier Liebe und einem Leben im Einklang mit der Natur? Die Dokumentation folgt den Stationen der Expedition und ihren schillernden Akteuren: Denn ihre Reise sollte auch Europa für immer verändern. An Originalschauplätzen in Paris, Brasilien und auf Tahiti hat das „Terra X“-Team diese Dokumentation gedreht. Der Anlass dazu war das 250. Jubiläum der Seereise von Louis Antoine de Bougainville.Das Personal war interessant und temperamentvoll: Neben dem Kapitän reisten der wohlhabende Lebemann Prinz von Nassau sowie Jeanne Baret mit. In Männerkleidung stellte sie an der Seite des Botanikers Philibert Commerson pflanzenkundliche Forschungen an. Ihre Mitbringsel von der anderen Seite der Erde zieren heute nahezu jeden Garten: Hortensie und Bougainvillea. Wie gelang es ihr, unerkannt als erste Frau um die Welt zu segeln? Warum war die Erkundung der Natur- und Pflanzenwelt den Leitern dieser Expedition so wichtig? Bougainvilles Schiffe drangen an Orte vor, die kein Europäer zuvor gesehen hatte. Tahiti war kurz vorher von den Engländern „entdeckt“ worden – doch da gab es auf beiden Seiten nur Unverständnis und Aggression. Bougainville dagegen sah die Menschen und die Kultur Tahitis mit den interessierten Augen eines Forschers. Er erkundete die Sitten und Lebensgewohnheiten der Menschen, erzählte in seinem Bericht von erotischer Freizügigkeit und bewunderte das harmonische Zusammenleben der Gastgeber. Sein Südsee-Report inspirierte Philosophen und Künstler zu Abhandlungen über sexuelle Freiheiten, den „Edlen Wilden“ und die menschliche Gesellschaft im Naturzustand. Und es beflügelte Maler wie Paul Gauguin zur Flucht ins vermeintliche Paradies und zu ikonischen Meisterwerken. Der „Mythos Südsee“ war geboren – und hält bis heute an. Aber was steckt wirklich dahinter? Die Dokumentation folgt den Stationen dieser Expedition, die am Vorabend der Französischen Revolution Europa für immer verändern sollte. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 10.06.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 14.06.2020 ZDF Mythos Wolfskind – Mogli und die wilden Kinder
45 Min.Spielszene: Mogli (Shivam Lohar), der unter Wölfen aufwächst.Bild: Jens Monath / ZDF„Das Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling erzählt vom Wolfskind Mogli, das allein im Dschungel unter Tieren aufwächst. Wie aber sieht es in der Realität mit Wolfskindern aus? Wolfskinder – das sind Kinder, die ohne menschliche Bezugsperson aufwachsen – entwickeln Defizite. Historische Fälle sowie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sie Probleme beim Erlernen von Sprache und beim Knüpfen zwischenmenschlicher Beziehungen haben. Erzählungen von Wolfskindern finden sich bei vielen Völkern. Es geht dabei um Kinder, die – ohne Kontakt zu Menschen – allein in der Wildnis oder zusammen mit Wölfen, Bären oder anderen Tieren leben.Anders als in den Mythen und Erzählungen haben Kinder, die auf diese Weise aufwachsen, in der Realität große Probleme, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Die Fähigkeit zu sprechen ist angeboren. Aber erst im Kontakt mit anderen Menschen kann ein Kind diese Fähigkeit ausbilden, das Sprechen lernen. Fehlt in den ersten Lebensjahren der Kommunikationspartner Mensch, entwickeln sich unter anderem keine Verbindungen zwischen den für die Sprache zuständigen Hirnarealen. Wolfskinder jaulen, knurren, schreien und grunzen wie Wölfe oder Affen. Denn, so unwahrscheinlich es auch im ersten Moment klingen mag, wissenschaftliche Experimente und Interviews mit Experten legen nahe, dass sich Tiere unter gewissen Umständen tatsächlich der Kinder annehmen würden. So geschehen im Fall von John Ssebunya, einem Jungen in Uganda, der als Kind eine Zeitlang mit Affen lebte. Als roter Faden und Rahmenhandlung der Dokumentation dienen Leben und Werk von Rudyard Kipling, dessen „Dschungelbuch“ bis heute zu den bekanntesten Jugendbüchern der Welt zählt. „Mythos Wolfskind – Mogli und die wilden Kinder“ erweckt in aufwändig gedrehten Spielszenen Kiplings Jugend, das Leben seines Helden Mogli sowie historische Fälle von Wolfskindern zum Leben. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in Deutschland, Österreich, Uganda und Indien statt. Bei den szenischen Drehs in Indien wurde anstelle von Wölfen mit Huskys gearbeitet. Mit „Terra X: Mythos Wolfskind – Mogli und die wilden Kinder“ präsentieren wir die erste in 4K gedrehte Dokumentation. Mit dieser neuen Aufnahmetechnik sind Farb- und Kontrastumfang sehr viel größer und differenzierter als bei bisherigen Standards, so dass bisher nie gesehene Nuancen, Strukturen und Details sichtbar werden. Dazu trägt die sogenannte HDR (High Dynamic Range)-Farbkorrektur bei: Die Bilder erhalten eine noch größere Tiefenschärfe und Farbintensität. Diese Brillanz besticht vor allem bei den Aufnahmen aus Indien und Uganda. Die neue Technik entspricht fast der Wahrnehmung des menschlichen Auges und wird in absehbarer Zeit Standard werden. Japan will die Olympischen Spiele 2020 bereits in 8K übertragen. „Terra X: Mythos Wolfskind – Mogli und die wilden Kinder“ wird zwar in HD ausgestrahlt, gleichwohl wird die bessere Qualität der Bilder zu erkennen sein. Für 4K-ausgerüstete Zuschauer bieten wir den 4K-Film als Download an. Zusätzlich wurden noch circa 30 Szenen in 4K im neuen VR- beziehungsweise 360°-Format gedreht. Dabei waren bis zu acht Kameras im Einsatz, deren Bilder später mit einer speziellen Software „zusammengenäht“ wurden, so dass sich bei der Betrachtung mit einer VR-Brille ein unglaubliches Raumerlebnis ergibt. Eine weitere technische Innovation ist die Verwendung des vom Fraunhofer-Institut Erlangen entwickelten Cingo-Tons, der sich nach Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters richtet. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 25.09.2016 ZDF Nanga Parbat – Auf dem Weg zum Schicksalsberg
Der Neandertaler – Was wirklich geschah
45 Min.Vor 150 Jahren fanden italienische Steinbrucharbeiter im Neandertal bei Mettmann eine Schädelkalotte und eine Handvoll Knochen. Fast wäre der außerordentliche Fund auf dem Abraum gelandet, wenn nicht ein Dorfschullehrer erkannt hätte, welche Sensation sich hinter den unscheinbaren Fossilien verbarg: eine neue, bis dahin unbekannte Menschenart. Seit diesem denkwürdigen Tag im Jahre 1856, zwei Jahre vor Darwins bahnbrechendem Werk „Die Entstehung der Arten …“ ist unser Blick auf den „anderen Menschen“ immer noch skeptisch.Zunächst leugnete die Forschung seine Existenz. Einige Wissenschaftler behaupteten, die Knochen stammten von einem Höhlenbären, andere waren der Ansicht, einen durch Rachitis veränderten Homo Sapiens vor sich zu haben. Doch auch seit feststeht, dass es sich beim Neandertaler um einen Menschentypus handelt, der neben unseren Vorfahren auf der Erde lebte, über eine vergleichbare Intelligenz verfügte und uns an körperlicher Kraft weit übertraf, ist unser Verhältnis zum Neandertaler gestört. Die These vom Keulen schwingenden Unhold, der unseren Ahnen das Leben schwer gemacht hat, war gerade vom Tisch, da hielt man ihn schon für einen Menschenfresser und Ritualmörder. Auch sein Verwandtschaftsverhältnis zu uns ist nach wie vor ungeklärt. Galt er im 19. Jahrhundert noch als unser primitiver Vorfahr, sahen ihn die Forscher des 20. Jahrhunderts als entfernten Cousin, der seine Unterlegenheit schon darin zeigte, dass er ausstarb. Doch die Forschungsarbeiten laufen weltweit auf Hochtouren und sollen mit ihren Ergebnissen unser Bild vom Neandertaler erneut völlig verändern. Besonders das deutsche Forschungsprojekt zum Neandertalerjahr unter der Leitung von Ralf W. Schmitz fördert dabei Erstaunliches zutage. Der Dokumentarfilm begleitet den Wissenschaftler zu allen zentralen Untersuchungen, die Licht in die Geschichte des Neandertalers bringen sollen. Zum ersten Mal analysierte der Paläogenetiker Svante Pääbo aus Leipzig Zellkern-DNS des namengebenden Fossils, um Aufschlüsse über den Grad unserer Verwandtschaft zum Neandertaler zu erhalten. Knochen eines zweiten Neandertalers, der erst im Jahr 2000 am Originalfundort im Neandertal ausgegraben worden war, datierte Georges Bonani von der Universität Zürich mit Hilfe der 14C-Methode, um herauszufinden, ob der Mann aus dem Neandertal vor 42 000 Jahren Gesellschaft hatte. Auch der Speisezettel des Eiszeitlers ist nun bekannt. Anhand von Isotopenvergleichen mit anderen Lebewesen der Eiszeit ermittelte Mike Richards die genaue Zusammensetzung des Neandertaler-Menüs. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 16.07.2006 ZDF Neuguinea – Im Bann der Steinzeitjäger
Nikola Tesla – Magier der Elektrizität
45 Min.Das Wardenclyffe Labor auf Long Island. Von hier wollte Nikola Tesla Energie um die ganze Welt schicken.Bild: ZDF und Faber Courtial GbRNikola Tesla, seine Ideen prägten unsere Stromnetze, Fernseher und Telefone. Die „Terra X“-Dokumentation zeigt den exzentrischen Lebensweg des Erfinders. Für seine Mitmenschen galt er stets als Sonderling, ausgestattet mit einem großen Selbstbewusstsein. Sein unbändiger Forschergeist, seine genialen Ideen und ein gewisses Showtalent führten ihn aus der Provinz in die High Society New Yorks zum Ende des 19. Jahrhunderts. 1856 im entlegenen kroatischen Dorf Smiljan im damaligen Grenzgebiet des Habsburgerreichs geboren, studiert und arbeitet er zunächst in den Metropolen Europas, bevor er in die USA übersiedelt.Dort will er seiner ersten großen Erfindung zum Durchbruch verhelfen – der ersten effizienten Wechselstrommaschine. Doch der Job bei seinem großen Vorbild Thomas Edison entpuppt sich schnell als Fehlentscheidung. Denn Edison setzt mit seinen Glühlampen auf Gleichstrom. Erst ein Wechsel zu Edisons Konkurrenten George Westinghouse bringt den gewünschten Erfolg. Dieser führt die Erfinder Tesla und Edison jedoch auch in den berühmten Stromkrieg. Erbittert kämpfen beide Seiten bei der Elektrifizierung der USA um die Vorherrschaft „ihres“ Stromsystems. Dank Teslas Technik setzt sich der Wechselstrom durch, der auch heute noch aus unseren Steckdosen fließt. Tesla widmet sich nun seinem neuen Ziel, die Welt kabellos mit Energie zu versorgen. Statt teure Kupferkabel zu nutzen, sucht er nach Mitteln und Wegen, Strom auf natürlichem Wege zu übertragen. Allein die „Nebenprodukte“ seiner Forschung sind bahnbrechend. Mit kabellosen Leuchtröhren verzaubert er sein Publikum und wird durch seine Vorführungen zum Magier der Elektrizität. Er entwickelt die erste Funkfernsteuerung der Geschichte, schafft Grundlagen für die Radiotechnik und das Radar. Doch versteht er es nicht, seine innovativen Erfindungen auch wirtschaftlich zu nutzen. Seine Ideen machen andere reich. Die Arbeiten an seiner „Freien Energieübertragung“ kann er nicht zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Als Tesla keine befriedigenden Fortschritte präsentieren kann, drehen ihm seine Financiers den Geldhahn zu. Als er sich letztendlich eingestehen muss, gescheitert zu sein, erleidet Tesla einen Nervenzusammenbruch. Der geniale Erfinder wird zu einem Schatten seiner selbst. Mit immer seltsameren Ankündigungen ist er bald nur noch Ideenlieferant für Science-Fiction-Geschichten. Seine Exzentrik nimmt immer weiter zu. Tauben werden zu seinen besten Freunden. Er stirbt 1943 einsam und verarmt. Doch zeigen spätere Entwicklungen der Technikgeschichte: Nicht alle Ideen waren Fantastereien. In vielen Dingen war Nikola Tesla seiner Zeit einfach weit voraus. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 03.07.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 07.07.2024 ZDF Noahs Flut – Die Spurensuche im Schwarzen Meer
Nordamerikas versteckte Paradiese
60 Min.Zwei Quadratkilometer des Lake Martin Sees besteht aus offener Wasserfläche.Bild: ZDF und Oliver RichardtDie unberührten Landschaften Nordamerikas zählen zu den schönsten unserer Erde. „Terra X“ entführt in abgelegene, menschenleere und wilde Gegenden in Kanada und den USA. Anja Kindler und Iris Gesang unternehmen eine fantastische Reise zu unterschiedlichsten Landschaften. Vom hohen Norden des nordamerikanischen Kontinents bis weit in den Wilden Westen, den entlegenen Osten und tief in den Süden. Nördlich des Polarkreises führt Schlittenhundeführer Paul Josie als Mitglied der Vuntut Gwitchin First Nation ein freies Leben in klirrender Kälte. Sanfte Hügel und ein riesiges Flusssystem mit unzähligen Seen prägen dieses wilde Gebiet am Porcupine River.Hier trainiert Paul täglich sein zehnköpfiges Husky-Gespann und knüpft mit seiner Familie in Old Crow an Tradition und Kultur der Vuntut Gwitchin an. Vuntut Gwitchin bedeutet „Menschen der Seen“, und auch heute noch lebt Pauls Volk vom Fischen und der Jagd auf Karibus. Im Wilden Westen erforscht Celeste Carlisle wilde Mustangs in der hügeligen Vulkanlandschaft um Twin Peaks. Die Biologin beobachtet verschiedene Mustang-Herden das ganze Jahr über, um mit einer wissenschaftlich überwachten Verhütung auf sanfte Weise die Population zu regulieren. Denn wilde Mustangs galten lange als Plage für die Landwirtschaft und werden bis heute zur Bestandsregulierung gejagt und gefangen. Dabei werden immer wieder Familienverbände auseinandergerissen. Gemeinsam mit Pferdeschützerin Neda DeMayo sorgt Celeste dafür, dass Mustangs verschiedener Blutlinien in kleinen Herden wieder zusammengeführt werden. Neda päppelt einzelne Tiere hoch, und sobald sie gesund und kräftig sind, entlässt sie die stolzen Pferde zurück in die Freiheit in ein angrenzendes weitläufiges Schutzgebiet. Auf diese Art hat sie auch eine Mustang-Herde erhalten, die noch auf die spanischen Eroberer um Padre Kino aus dem 17. Jahrhundert zurückgeht. Im entlegenen Osten haben Lindsey Jones und Sean Todd vom College of the Atlantic ihr Leben den großen Meeressäugern gewidmet. Mount Desert Rock, eine kleine Insel im Golf von Maine, liegt in einem der wichtigsten marinen Lebensräume weltweit. Von dort beobachten und erforschen die Meeresbiologen Wale bis hinauf in die kanadischen Gewässer. Die Temperatur im Nordatlantik ist seit 2005 stark angestiegen. Von dort beobachten und erforschen die Meeresbiologen Wale bis in die kanadischen Gewässer. Die Temperatur im Nordatlantik ist seit 2005 stark angestiegen. So warm wie heute war das Wasser seit 3000 Jahren nicht, das hat ein US-amerikanisches und kanadisches Forscherteam herausgefunden. Fraglich ist, ob die Wale an der Ostküste Nordamerikas künftig noch genug zu fressen finden werden. Ganz im Süden liegt das größte Sumpfgebiet der USA: das Atchafalaya Basin in Louisiana. Eine verwunschene Sumpflandschaft, gespeist vom Atchafalaya, einem 270 Kilometer langen, mäandernden Fluss. Sein Becken ist viereinhalb Mal so groß wie der Bodensee, und neben Alligatoren und Wasservögeln durchstreiften Tiere die Wälder, die man hier nicht erwartet: Louisiana-Schwarzbären. Das verdanken sie Maria Davidson: Seit 28 Jahren leitet die Biologin ein erfolgreiches Auswilderungsprogramm. Galt die Art 1992 noch als gefährdet, hat sich ihr Bestand in Louisiana seit 2016 stabilisiert und sieht nun einer gesicherten Zukunft entgegen. Diese „Terra X“-Folge lädt ein zum Träumen, stellt Sehnsuchtsorte vor und besondere Menschen, die sich mit großer Begeisterung für „Nordamerikas versteckte Paradiese“ einsetzen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 01.01.2022 ZDF Die Nordpol-Verschwörung
45 Min.Vor genau hundert Jahren wurde der Nordpol entdeckt – so steht es in den Geschichtsbüchern. Aber stimmt das wirklich? Damals markiert der Nordpol die letzte große Trophäe im Zeitalter der Entdeckungen, und zwei Konkurrenten liefern sich ein erbittertes Duell: Robert E. Peary, vormals Commander der US-Marine, und Frederick A. Cook, deutschstämmiger Arzt und Abenteurer. Wie bei allen dramatischen Entdeckergeschichten geht es um alles: um Leben oder Sterben zweier Expeditionen, um Triumph oder bittere Niederlage, um den Platz in der Geschichte. Der Unterschied ist: Das Drama um den Nordpol währt bis heute. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 15.11.2009 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.