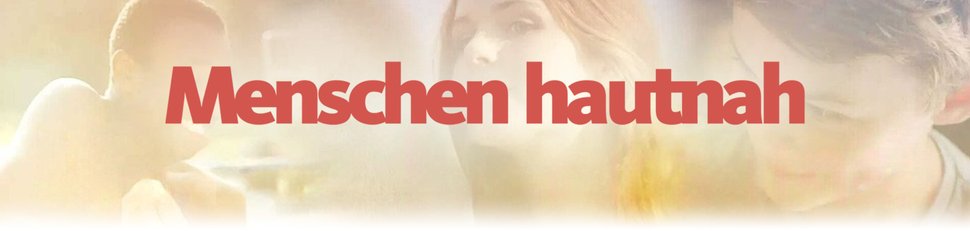2018, Folge 1–18
Geheimnisvolle Krankheiten (1): Woher kommen meine Schmerzen?
Folge 1Erkan, 32, hat seit seiner Kindheit mysteriöse, sehr schmerzhafte Knubbel auf der Haut: manche klein wie eine Erbse, andere groß wie ein Hühnerei. Jahrelang operieren die Ärzte diese Wucherungen einfach weg – doch sie kommen immer wieder. Erkans Schwester Arzu, 33, hat genau die gleichen Knubbel. Und auch die schneiden die Ärzte immer wieder weg. Und diese Wucherungen sind nicht die einzige Mysteriöse: Kein Mann in der Familie von Erkan und Arzu wird älter als 52 Jahre. Und niemand – auch kein Arzt – vermutet lange Zeit einen Zusammenhang.Schließlich sollen ihnen am Uniklinikum Marburg wieder Knubbel weggeschnitten werden. Doch die Chirurgin wird misstrauisch. Sie stoppt die OP und macht Meldung an Professor Jürgen Schäfer. Der leitet an der Klinik das Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE). Professor Schäfer ist eigentlich Kardiologe, seit einigen Jahren aber ist er vollständig freigestellt für die Suche nach mysteriösen Diagnosen. Professor Schäfer gilt als „Arzt, der um die Ecke denkt“ und entdeckt so mit seinem Team von einem Dutzend Spitzenmedizinern Krankheitsursachen, auf die sonst niemand kommt. In den Regalen des „ZusE“ stehen inzwischen rund siebentausend Krankenakten von Patienten auf der Warteliste. Alle von Menschen, die oft schon jahrelang von Arzt zu Arzt laufen, aber niemand findet heraus, woran sie leiden. Für diese Menschen ist Professor Schäfer die letzte Hoffnung. Und bei den Geschwistern Arzu und Erkan macht er eine lebensbedrohliche Entdeckung. Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an unerkannten oder seltenen Erkrankungen. Wenn Symptome nicht zusammen passen oder Medikamente nicht wirken, bekommen sie irgendwann das Etikett „psychosomatisch“ angeheftet. Steht das einmal in der Krankenakte, machen viele Ärzte daraufhin kurzen Prozess: Wieder eine eingebildete Kranke, wahrscheinlich depressiv, am besten geben wir Psychopharmaka. So erging es auch der 32-jährigen Hellen, die seit 14 Jahren an unerklärlichen Bauchschmerzen leidet. Sie läuft zu allen möglichen Ärzten, macht zig Allergietests, stellt ihre Ernährung um. Keiner weiß weiter, bis ein Arzt Psychopharmaka verordnet – die sie nicht nimmt. Sie weiß, dass sie sich nichts einbildet, sondern etwas in ihrem Körper die Schmerzen verursacht. Sie wendet sich verzweifelt ans ZusE. „Es ist nicht einfach, zu wissen, dass wir für viele Patienten die letzte Hoffnung sind“, sagt Professor Jürgen Schäfer. „Vor allem, wenn wir auch selbst denken, verdammt noch mal, was ist das denn? Dann ist das nicht ärztliche Routine. Das nimmt man mit nach Hause.“ Wird er herausfinden, woran Hellen leidet? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 11.01.2018 WDR Geheimnisvolle Krankheiten (2) – Wie werde ich gesund?
Folge 2Zwei Zentren in Marburg und Essen haben sich auf unerkannte und seltene Krankheiten spezialisiert. Diesmal im Fokus: Ist eine Heilung möglich? Zum Beispiel beim fünfjährigen Ole. Als er geboren wird, können seine Eltern ihn nicht im Arm halten, ohne dass er jämmerlich schreit. Lange findet kein Arzt die Ursache für das Schreien und die weiteren Symptome des Jungen: Er ist gehörlos und kleinwüchsig. Seine Knochen sind verbogen, entzündet und brechen schnell. Nach Jahren der Ungewissheit finden die Ärzte am Essener Zentrum für seltene Erkrankungen (EZSE) heraus: Ole ist weltweit das einzige Kleinkind mit dieser Art der Knochenerkrankung.Doch wird man Ole nun auch helfen können? Oles Ärztin, Corinna Grasemann, ist die Leiterin des EZSE. Sie hat sich ein Team aus einem Dutzend Spitzenmedizinern aufgebaut, mit dem sie mysteriöse Krankheiten bei Kindern erforscht. Das Problem bei Ole und vielen anderen kranken Kindern: Meist können die Erkrankungen nicht mit irgendeinem gängigen Mittel behandelt werden. „Wir wollen eigentlich keine Experimente am Patienten machen“, sagt Dr. Corinna Grasemann. „Aber es bleibt uns leider nichts anderes übrig, wenn es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Dann müssen wir uns mit den Eltern zusammen vortasten, was hilft dem Kind und was nicht?“ „Off-Label Use“ ist das Stichwort. Die Verordnung eines Medikaments, auch wenn es für diese Verwendung nicht zugelassen ist. Ein Medikament für Erwachsene könnte Ole helfen. Nur ist es noch nie an einem Kind getestet worden. Was also können die Ärzte tun? Menschen mit mysteriösen Krankheiten zu helfen, das versucht auch Prof. Jürgen Schäfer vom Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE) in Marburg. Professor Schäfer gilt als „Arzt, der um die Ecke denkt“ und entdeckt so mit seinem Team Krankheitsursachen, auf die sonst niemand kommt. Auch Joachim T. braucht die Hilfe des Professors. Joachim leidet seit 40 Jahren an der sogenannten Cerebrotendinösen Xanthomatose, eine erbliche Störung im Fettstoffwechsel, durch die sich Fette im Körper anreichern und an allen Organen ablagern. Erst jetzt wird seine Krankheit diagnostiziert und Professor Schäfer findet mit seinem Team heraus: Die Erkrankung ist verantwortlich für Joachims geistige und körperliche Beeinträchtigungen. Und die sind massiv. Helfen kann ein Medikament. Doch genau dieses soll vom Markt genommen werden. Kann Joachim T. trotzdem geholfen werden? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 18.01.2018 WDR Geheimnisvolle Krankheiten (3): Leben ohne Heilung
Folge 3Nach Jahren voller Ungewissheit, Schmerzen und oft Verzweiflung hoffen Patienten in den Unikliniken Marburg und Essen darauf, endlich zu erfahren, woran sie leiden. Dort haben sich Teams aus Chef- und Oberärzten auf unerkannte und seltene Krankheiten spezialisiert. Doch was ist, wenn die Krankheit endlich feststeht – aber eine Heilung nicht möglich ist? Wie bei Günther. Der 69-Jährige fällt jeden Nachmittag gegen 17 Uhr in eine Art Wachkoma. Dann sieht, hört und fühlt er zwar alles, kann aber noch nicht einmal den kleinen Finger regen. Alle Ärzte sind ratlos. Schließlich bekommt Professor Jürgen Schäfer, Leiter des Zentrums für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZusE) in Marburg, diesen seltsamen Fall auf den Tisch.Prof. Schäfer und sein Team finden nach Monaten tatsächlich heraus, woran Günther leidet. Eine Krankheit, die noch nicht einmal einen Namen hat. Und nicht heilbar ist. Doch gibt es einen Weg, wenigstens die Ohnmachtsanfälle zu bekämpfen? Mit einer schweren Erkrankung muss auch der siebenjährige Friso leben. Schon als er auf die Welt kommt, ist seiner Mutter Inga klar: Da stimmt was nicht. Schließlich wird am Essener Zentrum für seltene Erkrankungen (ESZE) das Prader-Willi-Syndrom diagnostiziert. Die Ärzte sagen eine Lernbehinderung und ungezügelte Wutausbrüche bei Friso voraus. Für seine Mutter bricht die Welt zusammen. „Ich weiß nicht, ob ich das schaffe“, sagt Inga. Doch unterstützt vom Team der Essener Uniklinik versuchen sie und ihr Sohn, die Folgen des schrecklichen Gendefekts zu meistern. Jeden Bissen ihres Sohnes muss Inga kontrollieren, denn seine Erkrankung hat zur Folge, dass Friso kein Sättigungsgefühl hat. Ohne strikte Portionierung würde er alles in sich hineinstopfen. Einladungen zum Kindergeburtstag sind dadurch fast unmöglich. Seine Mutter Inga hat die Sorge: „Er würde die ganze Geburtstagstorte auf einmal aufessen.“ Friso und Günther – zwei Fälle von vielen, die bei den Ärzten in den Zentren für unerkannte Erkrankungen in Essen und Marburg landen. Die Mediziner dort sind für viele Menschen die letzte Hoffnung. Tausende Patienten, die oft schon jahrelang nach einer Diagnose für ihre Beschwerden suchen, stehen bei den „Medizindetektiven“ auf der Warteliste. Doch auch wenn die Diagnose gefunden ist, können Krankheiten oft nicht geheilt, allenfalls Symptome gelindert werden und Schäden, die bereits entstanden sind, bleiben. Dann müssen Patienten Wege finden, wie sie mit der Krankheit leben können. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.01.2018 WDR Wenn aus Liebe Hass wird – Vanessas Leben nach dem Säureattentat
Folge 4Vanessa ist wunderschön, hat einen Job und steht mitten im Leben, als sie im Februar 2016 früh morgens mit ihrem Hund spazieren gehen will. Dann passiert es: Der Ex-Freund lauert ihr vor der Wohnung auf und schüttet ihr hochprozentige Schwefelsäure ins Gesicht. Einen Tag vorher hatte die damals 26-Jährige mit ihm Schluss gemacht. Die Säure frisst sich sofort in ihre Haut. Ex-Freund Daniel F. gibt zu: „Ich wollte sie hässlich machen“. Vanessa wird nun nie wieder so aussehen wie früher. Das halbe Gesicht ist weggeätzt, das linke Ohr zur Hälfte von der Säure aufgelöst, auf einem Auge ist sie blind.Seit dem Anschlag versucht die 28-Jährige ins Leben zurückzukehren. Doch der Täter macht es ihr schwer. Er sitzt zwar seit der Säureattacke hinter Gittern, ist aber trotzdem ständig präsent. Immer wieder schreibt er Vanessa aus dem Gefängnis Briefe, handgeschrieben. Sie liest jeden einzelnen. „Ich kann nicht anders“, sagt Vanessa, die seit dem Anschlag ständig auf der Suche nach dem „Warum“ ist und sich durch die Briefe Antworten erhofft. Das Attentat hat sich auch in Vanessas Seele gefressen. Ein Jahr lang begleitet unser Kamerateam die 28-Jährige auf dem Weg in ein neues Leben. Anfangs überwiegen noch Schmerzen, Trauer und Wut, doch Vanessa blickt nach vorne. Sie erfährt viel Unterstützung aus ganz Deutschland. Unter anderem von Alessandra aus Hövelhof bei Paderborn – auch sie ist Opfer eines Säure-Anschlags. Der gelernten Kosmetikerin Vanessa war ihr Äußeres immer wichtig. Ihr Ex-Freund wusste das. Zwölf Jahre muss er ins Gefängnis. Genauso lange wird Vanessa mit weiteren OPs und Behandlungen zu kämpfen haben, schätzen ihre Ärzte. Gegenüber ‚Menschen hautnah‘ hat sich Täter Daniel F. ausführlich geäußert. In mehreren Briefen beantwortet er die Fragen unserer Reporter nach den Gründen seiner Tat. Spürt er Reue? Der Film zeigt eine starke, junge Frau, die sich zurück ins Leben kämpft. Eine Frau, die für immer entstellt bleibt und trotzdem selbstbewusst durchs Leben geht. Eine Frau, die mit ihrer Geschichte auch anderen betroffenen Frauen Mut machen will. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 15.02.2018 WDR Wir und der Keim – Zwei Frauen kämpfen um ihr Leben
Folge 5Unabhängig, spontan sein und viel von der Welt sehen, so haben sich Simone und Ines ihr Leben vorgestellt. Seit 25 Jahren sind die beiden ein Paar. Simone ist Hundetrainerin. Diesen Job kann die 43-Jährige aber nicht mehr ausüben. Wie so vieles, was ihr bisher wichtig war. Denn ihr Leben wird von multiresistenten Keimen (MRSE) bestimmt. Schon mit Ende 30 bekommt Simone links eine Hüftprothese, der Einbau der zweiten auf der rechten Seite folgt wenig später. Seitdem ist sie nicht mehr schmerzfrei. Über vier Jahre ein zermürbender Ärztemarathon bis die Diagnose kommt: Keimbefall an beiden Hüftprothesen.Die bakterielle Entzündung hat bereits Simones Knochen angegriffen. Die Ärzte sagen, die Keime bekomme man nie mehr vollständig heraus, lediglich reduziert und „stillgelegt“. „Mich hätte das genauso treffen können, jeden kann das sofort treffen, und die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Und da zeigt sich, ob das Team passt oder nicht“, sagt Ines. „Ohne Ines wäre ich ein Sozialfall“, sagt Simone. Die Beziehung des Paares spielt sich lange Zeit nur zwischen Arztpraxis und Krankenhaus ab. Simone muss 24 Operationen über sich ergehen lassen, lebt zwischendurch sogar mit ausgebauten Hüftprothesen und kann nicht gehen. Aber die Beiden geben nicht auf. Noch während Simone im Krankenhaus liegt, beginnt Ines mit dem barrierefreien Umbau ihres Hauses in Sprockhövel – was andere Paare vielleicht erst mit 70 Jahren in Angriff nehmen müssen, machen sie bereits mit Mitte 40. Es gibt immer wieder Rückschläge, aber das Paar lässt sich nicht unterkriegen. Die Autoren Michaela Bruch und Klaus Bergner begleiten die zwei Frauen über ein halbes Jahr. Wie verändert sich das Leben der Beiden? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.02.2018 WDR Uma und wir
Folge 6Seit 2012 begleitet Tabea Hosche das Leben ihrer Tochter Uma mit der Kamera. Uma ist geistig beeinträchtigt, schwerhörig, hat Epilepsie und eine schwere Sprachentwicklungsstörung. „Es hat lange gedauert, bis mein Mann und ich so was wie einen Alltag zustande bekommen haben“, sagt Tabea Hosche. Viel Zeit hat die Familie in den ersten Jahren im Krankenhaus verbracht. Uma musste mehrfach operiert werden, wurde mühsam auf Medikamente eingestellt. Dann kam Umas Schwester Ebba zur Welt – gesund. „Sie war ein Musskind. Augen zu und durch“, so die Mutter. Bei ihr konnten sie und ihr Mann nicht anders, als in der Schwangerschaft darauf zu vertrauen, dass alles gut gehen wird.Zu stark war der Wunsch nach einer größeren Familie. Mittlerweile ist Uma ein Schulkind und zur drei Jahre jüngeren Schwester Ebba ist eine besondere Schwesternbeziehung entstanden. Eigentlich sei die Zeit nun reif, findet das Paar, sich den Herzenswunsch nach einem dritten Kind zu erfüllen. Doch diesmal ist die Angst da: Wie würden sie mit Auffälligkeiten oder Anzeichen für eine Fehlentwicklung umgehen? Kann ihnen die Pränataldiagnostik helfen oder führt sie zu noch mehr Unwägbarkeiten? Wäre Abtreibung denkbar? Woher den Mut nehmen, sich ohne Garantien auf dieses Abenteuer einzulassen? Der Vater möchte im Falle einer weiteren Schwangerschaft größtmögliche Sicherheit, will die medizinischen Möglichkeiten ausschöpfen. Die Mutter möchte am liebsten gar nichts über die Entwicklung des Kindes im Mutterleib erfahren, um nicht vor eine Entscheidung gestellt zu werden, ob noch ein behindertes Kind für die Familie tragbar wäre. Das Risiko, wieder ein behindertes Kind zu bekommen, ist zwar nicht höher als bei anderen Paaren mit 39 Jahren – aber wenn es einen bereits einmal getroffen hat, bleibt das Urvertrauen angekratzt. Wollen sie das Glück noch einmal herausfordern oder begraben sie ihren Traum von einem weiteren Kind? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 08.03.2018 WDR Verliebt in Gott – Warum ein junger Mann Priester werden will
Folge 7„Als ich ein kleiner Junge war, da kam Papst Benedikt nach Deutschland“, schwärmt Nicolas aus Duisburg, „Das hat mich so beeindruckt. Die Szenen, wenn er vor den Leuten gesprochen hat und wie die Menschen ihm zugejubelt haben. Da habe ich gesagt, dann möchte ich auch mal Papst werden. Da wusste ich noch nicht, dass es auch Priester gibt.“ Dieser Tag hat Nicolas Leben verändert. Seitdem will er unbedingt katholischer Priester werden. Er beginnt als Messdiener, studiert Theologie und bewirbt sich um eine Ausbildung zum Priesteramtskandidaten in Münster.Nicolas verspürt einen tiefen inneren Drang, seinen Lebensweg im Auftrag Gottes zu gehen. „Das muss man im Herzen spüren. Das ist so ein bisschen wie verliebt sein, dass man sich angezogen fühlt von Gott.“ Nicolas Eltern und die vier Geschwister sehen seinen Weg kritisch. Seit nun elf Jahren versuchen sie ihm klar zu machen, dass einige traditionelle katholische Werte – wie die Ablehnung gleichgeschlechtlicher Beziehungen – und ein Leben ohne Frau und eigene Kinder überhaupt nicht zu ihm als modernen Menschen passen. Der 23-Jährige sagt selbst, dass er ein absoluter Familienmensch ist. Genauso wie er lange Partynächte liebt und im Vergleich zu seinen Ausbildungskollegen einen großen weiblichen Bekanntenkreis hat. „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen! Das hat der heilige Johannes gesagt und das ist auch mein Motto“. Doch nicht nur wegen Gott und seines Glaubens ist der Duisburger überzeugt, Priester werden zu wollen. In keinem anderen Beruf sei die Arbeit so abwechslungsreich. „Ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte was mit Alten und Kranken machen, ich möchte Familien besuchen, ich möchte von dem erzählen, was ich glaube, was ich lebe, ich möchte auch in die Schulen gehen und da unterrichten. Das macht mir einfach so viel Spaß.“ Der Film zeigt auch, in welchem ständigen Kampf sich Nicolas befindet. Wenn er mal wieder außerhalb der kirchlichen Ausbildungsstätte mit seinen Freunden in den Kneipen Münsters unterwegs ist, sich wieder einmal verliebt und sein Ausbildungsleiter ihn zum Gehorsam ermahnt, während seine Mutter das Zölibat ablehnt und sich etwas anderes für ihren Sohn wünscht. Schafft er es trotzdem, sich seinen Traum zu erfüllen und Priester zu werden? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.03.2018 WDR Die ewigen Singles – Glücklich ohne Partner
Folge 8Britta Müller ist selbstbewusst, gutaussehend – und sie ist Single. Nicht ganz freiwillig: „Wenn man in einem gewissen Alter ist, kann es richtig schwer werden.“ Diese Erfahrung musste die 38-Jährige mehrfach machen. Eine romantische Hochzeit, eine kleine Familie – das ist nach wie vor ihr Traum. Im Freundeskreis sind Kinder selbstverständlich. Doch in zwischen hat Britta auch die Vorzüge ihrer Unabhängigkeit entdeckt: „Ich bin gerade an einem Punkt im Leben, wo ich von der Idee abgehe, einen Partner zu haben, zu heiraten, Kinder zu kriegen.“ Matthias Terhorst hat sich bewusst für ein Leben ohne Partnerin entschieden.Der 36-Jährige ist vor sieben Jahren in einen katholischen Orden eingetreten und lebt seitdem enthaltsam. Zuvor hatte er Beziehungen zu Frauen. Warum hat er sich für diesen „strengen“ Weg entschieden? Wie groß ist der Verzicht wirklich und was kann ihm das Ordensleben stattdessen geben? „Da ist eine Gottesliebe, die ich spüre, die mich dazu motiviert, diese Versprechen zu äußern und danach zu leben.“ Der große Tag steht für Matthias Terhorst nun noch bevor: Er will die Weihe auf Lebenszeit. Machen sich kurz vorher doch nochmal Zweifel breit? „Glücklich ohne Partner“ begleitet zwei Menschen auf ihrem Weg, der von üblichen Lebensmodellen abweicht. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 05.04.2018 WDR Burn-out im Stall? – Milchbauern in der Krise
Folge 9Lange war die Welt in Ordnung auf dem Hof der Familie Probst in der Eifel. Ihre Lebensgrundlage: 65 Milchkühe. Damit kamen sie gut über die Runden. Doch mit dem Fall der Milchquote 2015 kam die große Krise. Bei Preisen von teils 19 Cent pro Liter Milch fiel es Bauer Probst schwer noch zum Arbeiten aufzustehen. „Wir arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung und dabei kommt kein Geld raus, nur Schulden“, sagt Rainer Probst. Seine Frau Gabi denkt mit Schrecken an die vielen zu bezahlenden Rechnungen. Da Rainer und Gabis Sohn den Hof übernehmen will, muss etwas passieren.Aufgeben oder umstellen? Bauer Probst will es nun mit Biomilch und Biohühnern versuchen. Es ist seine letzte Chance, den Hof zu retten, denn die nächste Milchkrise steht schon vor der Tür. Der Milchpreis liegt derzeit bei 23 Cent pro Liter. Sein Freund Kurt Kootz hat vor vier Jahren eine halbe Million Euro in zwei neue Ställe und eine Melkanlage investiert. Der erste Stall ist gerade fertig, da beginnt die Milchpreiskrise. Die Familie kann die Raten nicht bedienen, die Schulden erdrücken sie. Handwerker für den zweiten Stall können nicht bezahlt werden. Deswegen baut Kootz – neben der Arbeit mit dem Milchvieh – selbst weiter. Teilweise habe er 9.000 Euro minus im Monat gemacht, sagt Kootz verzweifelt. Einen Plan B hat er nicht. Seine gesamte Existenz droht zu scheitern. „Die Kühe sind eigentlich genau mein Ding, aber wenn es sein muss, müssen sie halt gehen“, sagt Lambert Stoecker aus dem Bergischen Land. Bisher haben er und sein Sohn die Milchkrise nur überstanden, weil sie selbst noch Kälber aufziehen und schlachten. Auf Dauer reicht das aber nicht. Gemeinsam mit seinem Sohn Matthias macht er sich auf die Suche nach Alternativen. Die Kraft dazu hat er eigentlich gar nicht, seit Jahren hatten er und sein Sohn schon keinen Urlaub mehr und die eigene Erschöpfung wird immer größer. „Mich macht das so kaputt. Wie viele Kumpels haben die Tore schon zugemacht. Wie viele habe ich weinend schon gesehen. Männer, die weinen. Sohn, Haus und Hof verloren. Grausam ist das“, sagt Stoecker. 2016 haben rund 650 Milchbauernhöfe in NRW zugemacht, das sind etwa 10 Prozent. Vater und Sohn fragen sich, wie sie noch motiviert sein sollen für die Zukunft, wenn 2018 bereits die nächste Milchkrise droht? „Menschen hautnah“ erzählt drei Geschichten von Bauern am Rande des Burn-outs: Bei allen Höfen, haben die Söhne entschieden, dass sie ihrer und der Leidenschaft ihrer Väter treu bleiben wollen. Sie sind wütend, dass sie als Produzierende keinen Einfluss auf die Preise haben. Den Hof aufgeben, den Generationen vor Ihnen durch alle Krisen gebracht haben, ist für sie unvorstellbar. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 12.04.2018 WDR Die Chemo Chicas – Leben nach dem Krebs
Folge 10Silke, Stefanie, Jenni und Elke nennen sich die ‚Chemo Chicas‘. Sie haben sich 2016 in der Chemo-Ambulanz im Klinikum Essen kennengelernt. Alle hatten die Diagnose Brustkrebs. Dass sie sich getroffen haben, ist das Beste was ihnen passieren konnte, sagen sie. „Alles ist besser als Tod!“ ist ihr Motto und der Titel der ersten Dokumentation über die Chemo Chicas in der Reihe „Menschen hautnah“. Die vier Frauen haben „Herrn Krebs den Stinkefinger gezeigt“, sagen sie. Aber wie sieht ihr „Leben danach“ nun aus? Seit unserem ersten Film ist ein Jahr vergangen und die Chemotherapien sind vorbei.Die schwere Krankheit hat bei allen vier Frauen an den Grundfesten des Lebens gerüttelt. Sie haben gehofft, das Schlimmste liegt hinter ihnen – jetzt kann das Leben wieder losgehen. Doch keine der vier Frauen kann so einfach zurück ins alte Leben. Es passt nicht mehr. Der Krebs hat die Frauen verändert. Silke hätte nie gedacht, dass der Weg zurück in den Job so schwer wird: „Ich schaffe das im Moment einfach nicht, ich habe keinen Plan, wie es weitergehen soll. Früher wusste ich immer, wo es lang geht, heute lassen mich selbst kleinste Alltagsdinge manchmal verzweifeln.“ Jennis Krebs war hormonbedingt. Sie ist mit 29 Jahren in die Wechseljahre versetzt worden. Es gäbe die Möglichkeit, das rückgängig zu machen, die Behandlung zu stoppen. Jenni will sich nicht als alte Frau fühlen, vielleicht möchte sie auch Kinder haben. Welche Entscheidung ist für sie die richtige? Stefanie will nicht wieder zurück in den alten Trott. Sie hat mit 51 eine Erwerbsminderungsrente eingereicht. Das verschafft ihr zwei Jahre Zeit, Zeit um für sich einen neuen Weg zu finden. In diesem „Leben danach“ sind die Chemo Chicas für einander da. Auch für Elke, bei der der Krebs zurückgekehrt ist. Sie wird bald das erste Mal Oma. Sie möchte nicht vorher sterben. Die Chemo Chicas hatten sich die Zeit nach dem Krebs anders vorgestellt. Die Probleme sind viel größer, als sie dachten. Aber sie haben sich und das hilft. Ihr neues Motto: Leben – genau jetzt! (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 19.04.2018 WDR Marie will frei sein – Erwachsen werden mit Down-Syndrom
Folge 11Marie aus Leichlingen ist 16 Jahre, als sie ihren Kinderwunsch zum ersten Mal spürt. Auch weiß Marie seit vielen Jahren, dass sie Lehrerin werden will. Doch beide Träume sind für Marie kaum zu verwirklichen. Denn Marie hat das Down-Syndrom. Ihre Eltern Martina und Helmut haben Marie und ihre anderthalb Jahre jüngere Schwester Lilly als Babys adoptiert. Auch Lilly hat das Down-Syndrom. Einige Freunde und Verwandte haben damals nicht verstanden, warum die Eltern zwei behinderte Kinder adoptieren wollen. Doch Martina ist Sonderpädagogin und hatte beruflich viel mit Down-Syndrom-Kindern zu tun.Ziel der Eltern ist es, die Kinder bestmöglich zu fördern. Marie soll es auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen und nicht in die Behindertenwerkstatt gehen müssen. Auch Marie will nicht in die Werkstatt: „Ich höre das ja dauernd, alle wollen mich dahinschicken. Aber ich sage nein, ( …), ich gehe da nicht hin.“ Bis heute arbeitet nur etwa ein Prozent der behinderten Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Trotzdem gibt Marie den Kampf nicht auf und versucht, den regulären Hauptschulabschluss zu machen. Ob Marie aber auch eigene Kinder haben sollte? Da sind sich die Eltern nicht so sicher. Sie glauben, dass die Erziehung dann an ihnen hängen bleibt. Martina sagt: „Wir haben uns ausgesucht Marie zu adoptieren, aber wir haben uns nicht ausgesucht ( …) nochmal ein Kind groß zu ziehen.“ Trotzdem gehen ihre Eltern mit Marie zur Frauenärztin und zum Humangenetiker. Sie möchten wissen, welche Risiken eine Schwangerschaft hätte. Fast zehn Jahre lang hat „Menschen hautnah“ Marie und ihre Familie begleitet: Von der Grundschule über die Pubertät, zur ersten Liebe bis hin zum Kampf um einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Schafft Marie es, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten, frei zu sein? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 26.04.2018 WDR Wir kriegen dich! Pfarrer im Visier der Rechten
Folge 12Mitten in der Nacht wird ein Pfarrer in der Nähe von Aachen niedergeschlagen. Pfarrer Charles Cervigne ist dafür bekannt, dass er sich seit Jahren um Geflüchtete kümmert und auch Kirchenasyl organisiert. Als die Flüchtlingswelle ihren Höhepunkt hat, wird Cervigne vor seiner Haustür niedergeknüppelt. Ohne Spuren zu hinterlassen tauchen die Täter ab. Der Angriff ruft die Gemeindeglieder auf den Plan: Sie organisieren sich, um das Pfarrhaus zu bewachen und ihren Pfarrer zu beschützen. Charles Cervigne lässt sich nicht beirren: „Wenn wir die Gnade Gottes erwarten, müssen wir Menschen erst einmal anfangen, selbst gnädig untereinander zu sein.“ In der Südheide wird Pfarrer Wilfried Manneke am frühen Morgen von seinem Sohn auf eine Brandspur am Haus aufmerksam gemacht.Ein Molotow-Cocktail hätte die Familie auslöschen können. Der Geistliche, dem der Anschlag gilt, ist seit Jahren bekannt für sein Eintreten gegen rechts. Vor dem Anschlag ist Pfarrer Manneke EKD-Auslandspfarrer in Südafrika, noch zur Zeit der Apartheid. Was er in Südafrika erlebt, macht ihn sensibel auch für Formen des Rassismus in seiner Heimat Deutschland. „Wir kriegen Dich bald!“, diesen Satz hört Pfarrer Michael Kleim in Gera immer wieder – auch nachts am Telefon. Kleim fühlt sich schon lange bedroht: Sein Briefkasten wird gesprengt, zudem ist er Gewaltaufrufen im Internet ausgesetzt. Der Kampf gegen rechts wird wider Willen zu seinem Lebensthema. Schon in der DDR hatte er sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt. Pfarrer Kleim ist der Meinung: Auch heute lohnt es sich, für Demokratie und Menschenrechte zu kämpfen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 03.05.2018 WDR Meine Jugendliebe
Folge 13Manchmal ist sie 20 Jahre her, manchmal 40 und manchmal sogar 60 Jahre. Es ist eine Liebe, die viele Menschen nie vergessen: die Jugendliebe. Manche Paare begegnen sich irgendwann wieder – auf einem Klassentreffen, durch alte Freunde oder im Internet. Die Leidenschaft von damals flammt wieder auf und die Frage stellt sich: könnte diese alte neue Liebe eine Zukunft haben oder ist alles nur eine Illusion? Ein Traum, der nie dem Alltag standhalten musste? Claudia und Crispin lernten sich vor 32 Jahren im Alter von 19 als Schauspieler in einem deutschen Theater kennen.Es war Liebe auf den ersten Blick, doch schon nach einem Jahr ging Crispin zurück nach London, weil er dort ein gutes Jobangebot bekam. Claudia konnte sich nicht vorstellen, in Großbritannien zu leben. Beide gingen unterschiedliche Wege, bis Crispin Claudia vor eineinhalb Jahren anrief. Er hatte ihre Nummer im Internet gefunden. Es funkte sofort, als ob keine Zeit vergangen wäre. Doch schon nach ein paar Wochen kam der Schock: Crispin hat Krebs. Er kämpft verzweifelt um seine Gesundheit. Das Paar weiß nicht, ob ihre Liebe eine Zukunft haben wird. Die Jugendliebe von den Eltern verhindert Katrin und Roger aus Bornheim waren schon als Teenager ein Paar. Doch ihre Liebe konnten sie nicht ausleben, weil ihre Eltern sie verhinderten. Kathrin dachte schließlich, Roger möge sie nicht mehr und Roger dachte dasselbe von Kathrin. Beide hatten in den folgenden Jahren unterschiedliche Beziehungen, die scheiterten. Als Kathrin und Roger sich nach drei Jahrzehnten wieder treffen, ist schnell klar: sie wollen sich nie wieder trennen. Sie fühlen sich um ihre gemeinsame, vergangene Zeit betrogen und konfrontieren Katrins Mutter mit der Frage, warum sie damals ihre Jugendliebe zerstört hat. Sie musste einen anderen heiraten Auch Hildegard (80) kann ihre Jugendliebe nicht vergessen. Sie verliebte sich 1955 im Alter von 17 Jahren in ihren Tanzschulpartner. Es war ihre erste große Liebe, doch ihre Eltern wollten, dass sie einen anderen heiratet. Hildegards Jugendliebe – von Beruf Handwerker – war ihnen nicht gut genug. Die junge Frau war verzweifelt, fügte sich aber schließlich dem Willen ihrer Eltern und heiratete einen Mann, den sie nicht liebte. Vor vier Jahren starb Hildegards Ehegatte. Seitdem kann sie nur noch an ihre einstige Jugendliebe denken. Ihre Tochter Petra will Hildegard jetzt helfen, ihren Jugendschwarm wieder zu finden. Ist er überhaupt noch am Leben? Wie wird Hildegards Jugendliebe auf die alte Dame reagieren? „Menschen hautnah“-Autorin Katharina Wulff-Bräutigam zeigt in ihrem Film, welche Intensität die Jugendliebe manchmal hat und was aus ihr werden kann. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 17.05.2018 WDR Die Unperfekten – Saskia, Pia und Kevin
Folge 14Saskia, Pia und Kevin – normalerweise lernen sich junge Menschen zwischen 15 und 20 Jahren auf Partys, in Clubs oder auf Festivals kennen. Bei ihnen war es das Krankenhaus. Drei junge Menschen, deren Körper und Seelen schon früh durch Krankheit und Unfall verletzt wurden. Die nicht mehr perfekt sind – in Zeiten, in denen auf Facebook und Instagram mit Millionen Selfies der perfekte Körper gefeiert wird. Aber Saskia, Pia und Kevin wollen sich nicht mehr verstecken. „Warum soll ich mein Leben einschränken, warum soll ich mich verstecken und zurückziehen, nur weil ich Narben habe, und nur, weil es manchen Menschen nicht passen könnte?“ Saskias Bauch ist voller Narben.Ihr Schicksal: eine chronische Darmerkrankung. Als sie 16 war, musste der Dickdarm entfernt werden. Doch der künstliche Darmausgang funktionierte nicht und es folgten zwölf weitere Operationen. Ihre Jugend verpasste sie im Krankenhaus: keine Partys, keine Festivalbesuche, kein Zelten am See. Stattdessen Infusionen und Wasser in der Lunge. Sie verlor ihren Ausbildungsplatz, ihren Freund und stand mit 20 Jahren vor dem Nichts. Lange Zeit hat sie ihre Narben versteckt, aber dann hat der Gedanke gesiegt, dass auch ein unperfekter Körper schön sein kann und Würde ausstrahlt. Dass die Narben (auch) eine Geschichte erzählen, von einem Kampf, den sie überstanden hat. Sie hat das Fotoprojekt „grenzenlos“ ins Leben gerufen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Ihre Freunde Pia und Kevin machen bei den Shootings mit. Saskia (23) und Pia (20) haben sich lange Zeit ein Zimmer im Krankenhaus geteilt. Auch Pia hat keinen Dickdarm mehr. Dazu kommt noch eine sehr seltene Autoimmunerkrankung der Leber. Im Rucksack, den sie immer bei sich tragen muss, steckt die künstliche Ernährung, die sie zum Überleben braucht. Ihr Traum, das durch die Krankheit verpasste Abitur nachzuholen, liegt in weiter Ferne. Sie leidet unter dem Fatigue Syndrom, einem Zustand permanenter Erschöpfung. Die meiste Zeit ihres jungen Lebens verbringt sie im Bett – sie verschläft ihr Leben. Aber an Tagen, an denen es ihr gut geht, wagt sie alles. Kevin hat von den Eltern sein Faible für Motorräder geerbt. Er war gerade 19, als er frontal mit einem Auto zusammen stieß. Er selber kann sich an den Tag des Unfalls nicht mehr erinnern, er ist komplett ausradiert. Seitdem Unglück ist sein linker Arm gelähmt und sein Rücken voller Narben. Er war ursprünglich Linkshänder und musste nun mit rechts alles neu lernen. In seinem alten Beruf als Metzger kann er nicht mehr arbeiten. Auf seinem gelähmten Arm hat er das Datum des Unfalls tätowiert. Auf seinem Rücken einen Flügel und das Wort Freiheit, die das Motorradfahren nach wie vor für ihn bedeutet. Sein Traum: wieder Motorrad fahren. Ein halbes Jahr lang begleiten wir Saskia, Pia und Kevin: Wie schwer fällt es ihnen, sich selbst und ihre Träume einfach auszuprobieren? Wie unbeschwert kann ihr Leben sein – in einer Welt, in der nur das Perfekte geliked wird? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 24.05.2018 WDR Männlich, weiblich – oder was? – Leben mit dem dritten Geschlecht
Folge 15 (45 Min.)Christian, Sandrao und Talisha sind weder männlich noch weiblich, sie sind intersexuell: Sie stehen zwischen den Geschlechtern, besser gesagt, sie haben von beiden Geschlechtern etwas. Wie schwierig das Thema ist, wird schon bei der Anrede oder der Suche nach einer treffenden Bezeichnung klar: Zwitter oder Hermaphrodit oder auch Intersexueller? In keiner dieser Bezeichnung finden sich Betroffene eindeutig wieder. Christian, Sandrao und Talisha sprechen mit uns über dieses Tabuthema, über ihre alltäglichen Hürden und über Geschlechtsoperationen. Denn immer noch werden Intersexuelle im Kindesalter operiert, um den starren Normen von männlich und weiblich zu entsprechen. Dieses Schicksal hatte auch Christian, der offiziell als Junge geboren wurde.Im Alter von einem Jahr haben Ärzte einen Teil seiner männlichen Geschlechtsorgane entfernt. Er sollte als Mädchen aufwachsen. Schon in der Grundschule wird ihm klar, dass er sich als Junge fühlt – trotz Geschlechtsamputation. Talisha ist als Junge aufgewachsen, fühlt sich aber als Frau. Von ihren Eierstöcken hat sie erst mit 29 Jahren erfahren und plant jetzt eine operative Geschlechtsangleichung. Bei Sandrao wurden Penis und Hoden im Kindesalter amputiert. Sandrao ist unfruchtbar und fühlt sich keinem konkreten Geschlecht zugehörig. Drei sehr unterschiedliche Schicksale, die „Menschen Hautnah“ begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 07.06.2018 WDR Hebamme Sonja – Aus einem Abenteuer wird ein neues Leben
Folge 162011 veränderte sich Sonjas Leben grundlegend. Bis dahin war sie Mutter zweier Söhne und Hebamme in Köln. Dann suchte der WDR für eine Sendung Menschen, die ihren Beruf einmal im Ausland ausüben wollten. Zwei Wochen lang. Ein kurzes Abenteuer, dachte Sonja, und ging nach Afrika. In Ghana arbeitete sie mit afrikanischen Hebammen auf engstem Raum und mit einfachsten Mitteln. Solange es bei den Geburten keine Komplikationen gab, ging alles gut. Brauchten die Frauen bei der Geburt aber ärztliche Hilfe, mussten sie per Anhalter zum nächsten Krankenhaus fahren – etwa 30 Autominuten entfernt.Auch mitten in der Nacht und bei sämtlichen medizinischen Komplikationen. Wieder in Deutschland beschloss Sonja, den Frauen in Ghana zu helfen. Unterstützt von ihrem Mann und ihren Kindern sammelte sie Spendengelder und Sachspenden, organisierte den Transport via Seecontainer und konnte den dringend benötigten Krankenwagen nach Afrika bringen. Heute, sieben Jahre nach Sonjas ersten Aufenthalt, hat sich das kleine Dorf in der Voltaregion verändert: mit 200.000 Euro Spendengeldern und der Hilfe von deutschen Architekturstudenten und Handwerkern wurde die Hebammenstation ausgebaut und Sonja wurde zur Königin gekrönt. In ihrem Leben ist seitdem nichts mehr wie es einmal war. Auch in Deutschland engagiert sich die Kölnerin mittlerweile intensiv für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Hebammen. Immer mehr Kreißsäle schließen hierzulande, weil mit Geburten kaum Geld zu verdienen ist. Sonja verlor selbst ihren Job im Krankenhaus. Sie kämpft trotzdem weiter für würdige und sichere Geburten. Zusammen mit Schau-spielerin Hannelore Hoger und Moderatorin Bettina Böttinger initiiert sie die Aktion „ Auf den Tisch hauen für Hebammen“. Sie organisiert Demonstrationen und spricht mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Situation der Hebammen. „Ich musste nach Ghana gehen, um zu merken, dass ich etwas bewirken kann und dass auch in Deutschland Entwicklungshilfe für gesunde Geburten gebraucht wird“ – so lautet ihr Fazit. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.06.2018 WDR Wie ich mein Glück wiederfand – Das zweite Leben der Barbara Pachl-Eberhart
Folge 17 (40 Min.)Barbara hatte ihr Glück eigentlich gefunden: mit ihrem Mann Heli, ihrem sechsjährigen Sohn Thimo und der knapp zweijährigen Fini waren sie eine bunte, fröhliche Familie. Babara und Heli verdienten ihr Geld als Clowns und hatten nebenher viel Zeit für ihre Kinder. Doch von einer Sekunde auf die andere ist alles zu Ende. Vor 10 Jahren verliert Barbara Pachl-Eberhart durch einen schweren Verkehrsunfall ihren Mann und die Kinder. Sie bleibt allein zurück. Wie kann man nach einem solchen Schicksalsschlag weiterleben? Als Clown hat Barbara gelernt, dass die Realität das ist, was man aus ihr macht.Mit all der Phantasie, die einem zur Verfügung steht. Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mit Mut, Offenheit und großer innerer Stärke kämpft sie sich zurück ins Leben. Den Tag des Unfalls bezeichnet sie als Wendepunkt. Denn das bunte Clowns-Leben mit Heli, Thimo und Fini ist unwiederbringlich vorbei. Das Leben, was sie nun gestaltet, ist ein ganz anderes. Vier Monate nach dem Unfall lernt Barbara durch ihre Freundin einen Mann kennen und verliebt sich in ihn. Viele Menschen in ihrem Umfeld irritiert das, sie können nicht damit umgehen. Doch Barbara Pachl-Eberhart lässt sich nicht beirren, sie beginnt ein Buch über ihre Geschichte zu schreiben, das zum Bestseller wird. Hält Vorträge über Resilienz und Trauerbewältigung. Entdeckt das biografische und kreative Schreiben für sich. Nach einiger Zeit zieht sie vom Dorf zu ihrem neuen Freund in die Stadt. Und schließlich, vor eineinhalb Jahren, wird sie noch einmal Mutter. Mit der kleinen Erika bekommt ihr Leben eine ganz neue Richtung. Nun sind sie eine Patch-Work-Familie, sagt Barbara Pachl-Eberhart. Denn Heli, Thimo und Fini sind zwar gestorben, aber im Herzen immer dabei. Menschen hautnah begleitet Barbara Pachl-Eberhart durch ihr zweites Leben, bei der Arbeit, mit ihrer Familie, im Gespräch mit ihrem neuen Mann. Wie kann eine junge Liebe bestehen, wenn die verstorbene Familie ein ständiger Begleiter ist? Und woher nimmt Barbara die innere Stärke das neue Leben zu meistern und zu genießen ohne das alte zu vergessen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 02.08.2018 WDR Rosemarie, 94 Jahre, Beruf: Studentin
Folge 18„Vor allem genieße ich, dass ich jetzt nicht mehr das tun muss, was andere von mir erwarten.“ Rosemarie Achenbach ist fleißig. Dieses Jahr soll sie fertig werden, ihre Doktorarbeit. Mit ihren 94 Jahren ist sie die älteste Studentin an der Uni Siegen. Denn Rosemarie Achenbach hat etwas nachzuholen: Ihr Vater hat sie schon als Kind immer gefordert und gefördert. Er hat ihr Rollschuh laufen, Fahrrad fahren und schwimmen beigebracht und in der Nacht vor dem Abitur französische Vokabeln abgefragt. Rosemarie dachte, alle Männer wären so. Mit 12 Jahren hat sie sich dann im Konfirmandenunterricht in den 24-jährigen Vikar Fritz verliebt.Der Krieg und die gemeinsame politische Haltung gegen das Nazi-Regime hat sie stark zusammengeschweißt. Nach dem Krieg wurde geheiratet und damit war es mit einer akademischen Karriere vorbei. Rosemarie, die so klug, begabt und wissbegierig war, musste kleinbeigeben und ihre Talente in den Schatten ihres Mannes stellen. Über 56 Jahre war sie mit dem evangelischen Pfarrer verheiratet und hat drei Kinder großgezogen. Sie kümmerte sich um den Bürokram der Pfarrei, war Bezirksleiterin der Frauenhilfe, malte Kinderbücher, schrieb Theaterstücke, fotografierte. Sie lernte Sprachen – unter anderem Kisuaheli und Russisch. Französisch und Englisch spricht sie seit Schultagen fließend. Und: sie kennt hunderte Gedichte und alle Lieder im Gesangbuch auswendig. Aber ihren tiefgehegten Wunsch, endlich – so wie ihre drei Kinder – einen akademischen Abschluss in den Händen zu halten, konnte sie sich erst nach dem Tod ihres Mannes erfüllen. Da war sie 79 Jahre alt und voller Tatendrang. Endlich und zum ersten Mal in ihrem Leben, konnte sie alles selber bestimmen, jeden Tag so gestalten, wie ihr es passt. Sie schreibt sich 2004 an der Uni Siegen ein und schafft in der Regelstudienzeit ihren Magister in Philosophie mit der Note „gut“. Die Urkunde hat sie in der Küche aufgehängt. Dadurch beflügelt, hat sie sich entschlossen, eine Doktorarbeit dranzuhängen. Das Thema: „Der Tod in der Philosophie“: Wie geht Sterben? Was kommt danach? Für Rosemarie ist Sterben nichts Romantisches, für sie ist der Tod der letzte Feind. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das weiß, dass es sterben muss. Rosemarie Achenbach hat das schon seit ihrer Jugend fasziniert. Wir haben Rosemarie Achenbach zwei Semester lang begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 09.08.2018 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail