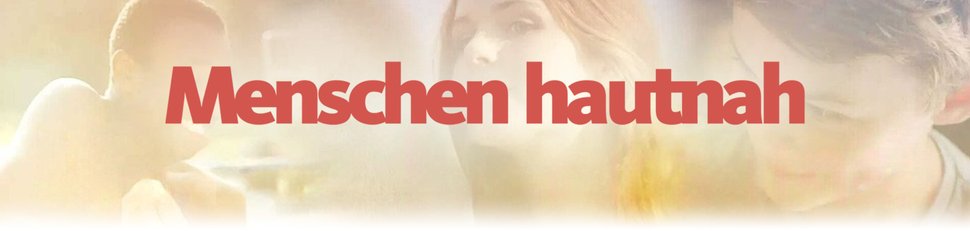2018, Folge 19–35
Zwillinge und die Liebe
Folge 19 (30 Min.)Irina und Marina Fabrizius sind eineiige Zwillinge. Mit ihren 37 Jahren waren sie nie länger als ein paar Tage getrennt und wenn, dann haben sie einander schmerzlich vermisst: „Wenn meine Schwester nicht da ist, dann ist das, als würde ein Teil von mir fehlen.“ Die beiden Frauen haben immer alles miteinander geteilt; ihre Kindheit, den Alltag, eine Wohnung und vor allem ihre Leidenschaft für die Malerei: An ihren großen, leuchtenden Landschaftsbilder arbeiten sie ohne Ausnahme gleichzeitig und gemeinsam. Sie verstehen sich wortlos und haben so eine einzigartige Technik entwickelt. In der Kunstszene sind sie damit konkurrenzlos.Die Kehrseite ihrer engen Beziehung zeigt sich im Privatleben. Sie träumen von einer Familie, wünschen sich beide einen festen Freund, möchten am liebsten gleichzeitig Mutter werden. Um das zu schaffen, wollen sie ihr symbiotisches Leben ändern. Der erste Schritt ist der Umzug in eine neue Wohnung, in der sie erstmals getrennte Schlafzimmer haben, der zweite der Besuch eines Zwillingstreffens in Potsdam. Hier begegnen die Schwestern anderen Zwillingspaaren, denen es ähnlich geht wie ihnen. Die enge Beziehung zum jeweiligen Zwilling ist für andere Menschen oft schwer zu verstehen. Sie lernen ein Zwillingsbrüderpaar kennen – vielleicht wäre das der Ausweg aus der engen Zweisamkeit der Schwestern? Ihre Unzertrennlichkeit ist für die Zwillinge Fluch und Segen zugleich. Einerseits steht sie der Liebe im Weg, andererseits klettern sie dank ihrer ganz besonderen Beziehung die Karriereleiter weiter hoch – ein Bild allein malen, ohne die Schwester, kann keine der beiden. Schaffen sie es, sich trotzdem so weit voneinander zu lösen, dass Platz für die Liebe zu einem, besser zu zwei Männern, entsteht? Und wenn zunächst nur eine von beiden einen Freund findet – was soll dann die andere machen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 16.08.2018 WDR Mama, Papa und die Anderen – In der Galaxie der Liebe
Folge 20Susanne (34) will ihr Leben radikal ändern. Schon lange ist sie unzufrieden mit der Hausfrauenrolle, in die sie nach der Geburt ihrer beiden Töchter mehr und mehr hineingeraten ist. Die Beziehung zu ihrem Ehemann Sascha (39) kriselt. Sie liebt ihre Kinder. Sie möchte Mutter sein, aber eine traditionelle Ehe führen – damit ist jetzt Schluss. Weder Susanne noch Sascha wollen ihre Ehe beenden. Deshalb schlägt Susanne vor, polyamor zu leben. Beiden Partnern soll es erlaubt sein, neben der Ehe weitere Beziehungen zu führen. Ein Experiment mit offenem Ausgang. Susanne lernt Rainer (62) kennen. Der ist zwar fast 30 Jahre älter als sie, aber sie spürt gleich eine „unfassbare Tiefe“, die beide miteinander verbindet.Seither besucht sie Rainer in Berlin oder der kommt für einige Tage ins Haus der Kleinfamilie in Rheinbach bei Bonn. Susanne fühlt den Ausbruch aus einer „Enge, die mir die Luft abgeschnürt hat“. Sie lebt auf, ist euphorisch, entwickelt neue Pläne. Auch jenseits der Liebe möchte sie sich erneuern, vielleicht noch einmal ein Studium anfangen. Vielleicht umziehen nach Berlin, in die Stadt, wo Rainer wohnt. Rainer lebt mit Karin (57) in einer polyamoren Wohngemeinschaft. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet. In der Wohnung lebt auch Holger. Auch mit ihm ist Karin zusammen. Alle haben zudem auch noch weitere Beziehungen. Und alle wissen voneinander: Polyamore Menschen glauben, dass zusätzliche Liebesbeziehungen eine Partnerschaft nicht zerstört, vielmehr diese gar belebt. In Rheinbach haben Susanne und Sascha ihren beiden Töchtern von ihrem neuen Beziehungsmodell erzählt. Denn auch Sascha hat mittlerweile eine weitere Partnerin. Die Kinder kennen die neuen Partner der Eltern und auch seinen Kollegen bei der Polizei wird Sascha davon erzählen. Dann aber verliebt sich Susanne in einen weiteren Mann. Und damit gerät das Gefüge aus dem Gleichgewicht. Menschen hautnah hat Susanne, Sascha und die anderen ein halbes Jahr begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 23.08.2018 WDR Ich bin Sophia! – Leben als Transgender-Kind
Folge 21 (35 Min.)Sophia ist gerade zehn Jahre alt geworden. Sie sieht aus wie ein Mädchen und fühlt sich als Mädchen. Geboren wurde Sophia aber als Junge. Mit gerade mal vier Jahren beschloss sie, kein Junge mehr zu sein. Sie will nur noch Röcke und Kleider tragen und lässt sich die Haare lang wachsen. Am Anfang dachten ihre Eltern, es sei vielleicht nur eine Phase. Doch Sophia ist sich sicher: „Ich bin als Junge auf die Welt gekommen, aber ich war immer schon ein Mädchen. Schon seit ich ganz klein bin!“. Sie reagiert aggressiv, wenn sie mit ihrem alten Namen angesprochen wird. In der Klinik für Kinderpsychiatrie am Universitätsklinikum Münster bekommen die Eltern die offizielle Diagnose für Sophias Verhalten: Sophia ist ein Transgender-Kind.Beratungsstellen in Deutschland beobachten seit Anfang 2000 einen starken Anstieg von Kindern und Jugendlichen, die den Konflikt, im „falschen Körper“ zu sein, erleben. Familien sind mit dieser Situation häufig überfordert. Ein neuer Name, andere Klamotten – das ist meist nur der Anfang. Denn schon früh müssen Entscheidungen getroffen werden, die ein ganzes Leben bestimmen können. Nur das Beste für sein Kind zu wollen, ist plötzlich alles andere als einfach. Vor einem Jahr haben wir bei Menschen hautnah zum ersten Mal über Sophia berichtet. Jetzt steht sie kurz vor der Pubertät und sagt: „Ich wünsche mir, dass ich ganz ein Mädchen bin, dass ich keinen Bart kriege und nicht so eine Stimme bekomme wie ein Mann!“ Schon jetzt fragt sie nach einer „Zaubermedizin“. Sophias Eltern unterstützen sie und wollen verhindern, dass sie die Pubertät eines Jungen erleben muss. „Sie hat panische Angst, sich wie ein Junge zu entwickeln, weil sie sich als Mädchen fühlt. Das Wort Pubertät benutzt sie gar nicht so, aber sie sagt, sie möchte nicht, dass der Körper sich so entwickelt wie bei Papa“, sagt Sophias Mutter. Helfen könnten dabei sogenannte Pubertätsblocker. Sie unterdrücken die Produktion von Sexualhormonen und damit das Einsetzen der Pubertät. Sophia gehört zur ersten Generation von transidenten Menschen, die bereits als Kind ihr Geschlecht ändern dürfen. So sind sie nicht mehr dazu gezwungen, im für sie als „falsch“ empfundenen Körper aufzuwachsen. Aber können sich die Kinder sicher sein, dass sie dauerhaft im anderen, im gefühlten Geschlecht leben wollen? Können sie wirklich schon eine dauerhafte Aussage über ihre Geschlechtsidentität treffen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 30.08.2018 WDR 80 Kilo müssen runter – Guido will Schützenkönig werden
Folge 22In einem kleinen Dorf im Sauerland quält sich Guido Grevener auf dem Bürgersteig einen kleinen Hügel hinauf. Mit jedem Schritt wird er langsamer, er atmet schnell, keucht und schwitzt. Nach 500 Metern bleibt Guido frustriert stehen. „Am Schützenfest muss man hier hoch marschieren, so lange wie die Musik spielt. Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich kein König werden“, sagt der 49-Jährige. Einmal Schützenkönig in seinem Heimatdorf Garbeck sein, das ist Guidos großer Traum. Doch es gibt ein Problem: Guido wiegt fast 200 Kilo. Deswegen fasst Guido vor über einem Jahr einen Entschluss.Bis Juli 2018, wenn das Vogelschießen um die Königswürde stattfindet, will er so fit sein, dass er im großen Festumzug durch das Dorf marschieren kann. 80 Kilo müssen runter. Ein ehrgeiziges Ziel, denn der Disponent eines Chemie-Unternehmens liebt Grillabende mit Freunden und Dorffeten mit viel Bier. Zunächst ist Guido auf einem guten Weg: Er geht regelmäßig zum Sport, achtet auf seine Ernährung und besucht eine Selbsthilfegruppe für Übergewichtige. Die Kilos purzeln. Seine Ehefrau unterstützt ihn, wo sie nur kann. Schützenkönig zu werden, ist im Sauerland etwas ganz Besonderes. „Für mich ist das eine große Ehre“, sagt Guido „Damit bin ich groß geworden.“ In Garbeck feiert das ganze Dorf immer im Juli drei Tage lang Schützenfest. Das Vogelschießen am letzten Festtag ist der Höhepunkt. Für viele der knapp 3.000 Bewohner ist es der wichtigste Termin im Jahr; längst Weggezogene kommen dann in die Heimat zurück, um mit alten Freunden und Bekannten zu feiern. Einige Monate vor dem Schützenfest stürzt Guido in eine Krise. Seine Knie machen Probleme. Er kann keinen Sport mehr machen, fällt zurück in alte Essgewohnheiten und nimmt wieder zu. „Es ist oft nachts, dann gucke ich im Schrank und wenn was da ist, esse ich das auch“, sagt er. „Das ist wie eine Sucht.“ Guidos Ärzte sind besorgt, sein Übergewicht wird immer gefährlicher. Nun geht es nicht mehr nur um die Krone, sondern um sein Leben. Guido hat Angst vor einer Lungenembolie, Angst zu sterben. Und bis zum Schützenfest ist nicht mehr viel Zeit. Wird er es schaffen, bis dahin wieder fit zu sein? Und wird es ohne eine Magenverkleinerung gehen? Diese Operation könnte sein Leben verlängern, aber Guido hat Angst, dass ein kleinerer Magen zu viele Einschränkungen mit sich bringt. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 30.08.2018 WDR Alkoholkinder
Folge 23Am 26. Mai 2016, an ihrem 30. Geburtstag, geht Jenny mit ihrer Tochter Sophie zu einer Untersuchung in die Berliner Charité. Sophie hat eine verminderte Intelligenz, sie entwickelt sich langsamer als Gleichaltrige. Jenny war bereits bei vielen Ärzten, doch keiner konnte eine Ursache finden. Erst in der Charité entdeckt der Kinderarzt Professor Dr. Hans-Ludwig Spohr, was dem Mädchen fehlt. Sophie leidet unter FAS, dem fetalen Alkoholsyndrom, einer Behinderung, die durch Alkoholkonsum ihrer Mutter während der Schwangerschaft verursacht wurde. Jenny erfährt, dass sie allein an den Schwierigkeiten ihres Kindes Schuld hat, und, als wäre das nicht genug, dass sie selbst auch FAS hat.Denn auch ihre eigene Mutter hat in der Schwangerschaft getrunken. FAS geht durch alle Schichten der Gesellschaft. In einer anonymen Befragung in frauenärztlichen Praxen haben jüngst über 58% der Patientinnen zugegeben, während der Schwangerschaft Alkohol getrunken zu haben. Mal ein Glas Wein oder Bier. Bis heute raten viele Gynäkologen werdenden Müttern zu einem Schluck Sekt zur Entspannung, nicht wenige empfehlen vor der Niederkunft gar ein Glas Rotwein, das würde einleitend wirken. Jenny versteht nun, warum ihre Tochter solche Probleme hat, aber vor allem auch, warum sie selbst in ihrem Leben immer wieder gescheitert ist. Alles fiel ihr schwer, nichts hielt: Keine Freunde; keinen festen Job, drei Kinder von drei unterschiedlichen Männern. Den Kontakt zu ihrer Mutter bricht sie ab. Nicht, weil die in der Schwangerschaft getrunken hat, sondern weil die es ihr nie gesagt hat. Wenn sie von FAS gewusst hätte, sagt Jenny, wäre ihr Leben anders verlaufen. So hat sie immer nur geglaubt, sie sei dumm. Jetzt weiß Jenny von FAS, dieser unheilbaren lebenslangen Behinderung, und möchte trotzdem eine gute Mutter sein. Doch Jenny fällt es schwer, den Alltag mit den drei Kindern in den Griff zu kriegen. Sie sucht Hilfe bei Behörden und Ärzten für ihre Tochter und für sich selbst. Obwohl das Jugendamt sie unterstützt, geht es ständig um die Frage: Kann sie mit ihren Kinder allein leben? Jenny hat den Mut, ihre Geschichte öffentlich zu erzählen, weil noch immer viele glauben, ein Glas Alkohol schade dem Kind im Mutterleib nicht. Jenny weiß es besser. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 06.09.2018 WDR Ich will die Amputation – Kann Kevin Prothesensprinter werden?
Folge 24Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit – mit fatalen Folgen. Kevin Kiry ist 24 und steht mitten im Leben, als er auf dem Weg zur S-Bahn mit dem Fuß umknickt. Was er zunächst für eine vergleichsweise harmlose Sprunggelenksverletzung hält, wird zum Alptraum: Vier Operationen in vier Jahren bringen keine Besserung. Immer wieder hofft der einst begeisterte Amateurfußballer auf Heilung, immer wieder wird er zurückgeworfen auf Null. Kevin Kiry ist dauerhaft krankgeschrieben, mit chronischen Schmerzen ans Haus gefesselt, vollgepumpt mit Medikamenten, zum Nichtstun verdammt.Dann beschließt er, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Kevin informiert sich über eine Unterschenkel-Amputation. Freunde und Verwandte reagieren mit Unverständnis, teilweise mit Entsetzen. „Am Anfang hatte ich unheimlich Angst“, sagte seine Mutter. Angst, dass durch die Amputation nichts besser wird. Auch Kevin Kiry ist lange unschlüssig: „Ist das richtig? Ist es falsch? Gehst du den richtigen Weg?“ Ihm ist bewusst: Ob ihm eine Beinprothese wirklich ein aktives Leben ohne Schmerzen ermöglichen kann, wird er erst nach der OP erfahren. Doch rückgängig gemacht werden kann die Amputation dann nicht mehr. Eine Begegnung mit dem Prothesenprinter David Behre bringt schließlich die Entscheidung. Der Olympiasieger aus dem Leichtathletikkader des TSV Bayer 04 Leverkusen verlor bei einem Zugunglück vor zehn Jahren beide Unterschenkel. Doch dann entdeckte er den Sport für sich, ist heute Profisprinter und betreut außerdem ehrenamtlich Unfallopfer vor und nach einer Amputation. Der erfolgreiche Behindertensportler wird für den Kevin zum wegweisenden Mentor: Mit 28 Jahren beschließt er, die Amputation zu wagen. Eine extreme Entscheidung, das ist sich Kevin bewusst: „Das wirkt im ersten Moment auf jeden Menschen erst mal erschreckend. Warum lässt der sich was abnehmen, ist der verrückt?“ Doch er möchte im Leben noch einmal richtig durchstarten und – wie sein Vorbild David Behre – selbst Prothesensprinter werden. Aber ist die Amputation mit all ihren Risiken wirklich der richtige Weg? Und ist Kevins Ziel, bei den nächsten Paralympics zu starten, realistisch? „Menschen hautnah“-Autorin Andrea Schuler hat Kevin Kiry auf seinem Weg in ein neues Leben begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.09.2018 WDR Das Leben auf die Reihe kriegen – Die Jungs vom Ponton
Folge 25Die zwei alten Pontons mitten im ehemaligen Hamburger Freihafen sind umgeben von Containerkränen und Schleusen. Hier wohnen Omar, Siggi und Lennert, drei von insgesamt sechs Jugendlichen zwischen 15 und 18, die in der Wohngruppe Ponton ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen möchten. Eine letzte Chance, um nicht doch abzurutschen. Eine letzte Chance auf einen Schulabschluss. Auf ein Leben auf eigenen Füßen. Werden sie sie nutzen? Auf der Veranda eines der Pontons hängt ein Boxsack, ihn soll die oft tiefsitzende Aggression der Jungs treffen, nicht Andere, wie so oft in der Vergangenheit.„Lennert! Aufräumen! Jetzt!“ ruft eine Stimme. Lennert wohnt seit etwa einem Jahr hier. Wie die anderen Bewohner kommt er aus schwierigen Verhältnissen. Viele mussten schon als kleine Kinder Gewalt, Alkohol und andere Drogen in der Familie erleben. Die meisten der Jungs haben schon mehrere Hilfseinrichtungen hinter sich. Und in der Schule waren Omar, Siggi, Lennert und die anderen seit Monaten oder gar Jahren nicht mehr. Manchmal ist Aufstehen am Morgen schon ein Erfolg. Tom Ricks, einer der Leiter der Gruppe, ist ein erfahrener Intensivpädagoge. Er weiß, dass es dauert, bis Omar es schaffen wird, selbständig, regelmäßig und rechtzeitig für die Schule aufzustehen. Geduldig unterstützt er Siggi bei der Suche nach einem Fußballverein, damit er Stabilität in einem neuen Hobby finden kann. Allen drei Jungs gemeinsam ist der Entschluss, in der Wohngruppe auf dem Ponton dem Teufelskreis aus Schulschwänzen, Drogen und Gewalt zu entkommen. Doch es ist ein langer Weg. Ihr sehnlichster Wunsch: Ein Hauptschulabschluss. Und später mal eine Frau und Kinder. Und ein eigenes Auto. Sechs Wochen lang konnten die „Menschen hautnah“-Autoren Bettina Zbinden und Max von Klitzing das Leben auf dem Ponton begleiten und erleben, ob die drei Jungs ihren Träumen näher gekommen sind. Ihre Dokumentation bietet einen tiefen Einblick in das Leben in der Wohngruppe mit seinem festen Abläufen, Regeln und Pflichten. Eine große Herausforderung für die drei Jungs, die aus ihrer Kindheit und Jugend bisher kaum Grenzen kennen. Ein Film über Siege und Niederlagen und das Erwachsenwerden unter erschwerten Bedingungen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 20.09.2018 WDR Plötzlich blind
Folge 26Orientierungslos gleitet Reiners Hand über die Tastatur des Aufzugs. Er will in den sechsten Stock, aber es sind so viele Knöpfe und ihre Anordnung ergibt plötzlich keinen Sinn mehr. Verzweifelt hält er inne und hofft auf Hilfe. Die bekommt er von seiner Mobilitätstrainerin. Reiner ist blind und zum ersten Mal wieder an seinem alten Arbeitsplatz. Er ist Controller bei einer Versicherung und will dort wieder einsteigen. Nach einer missglückten Rückenoperation hat er vor drei Jahren sein Augenlicht plötzlich verloren und musste sein Leben komplett von vorn beginnen.Mit dem Blindenstock laufen lernen, essen, trinken, kochen, eine Straße überqueren, sich orientieren und die Blindenschrift benutzen. Alls das hat er im Berufsförderungswerk in Düren gelernt. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Art Internat, in dem Sehbehinderte und Blinde Hilfe bekommen. Hier will man ihnen neuen Lebensmut vermitteln, hier lernen sie ihren Alltag zu bewältigen und es gibt spezielle Ausbildungsangebote, wie z.B. zur Masseurin oder Verwaltungsangestellten. Denn nicht jeder kann wie Reiner zurück in seinen alten Job. Auch Stephi hat in der Schule in Düren gelernt, wie sie als Blinde ihren Alltag wieder bestreiten kann. Die 33-Jährige ist Rektorin an einer Mönchengladbacher Hauptschule und hat vor zwei Jahren bei einem Reitunfall ihr Augenlicht verloren. Blindenhund Balou führt sie jeden Morgen sicher in ihr Büro und in die Klasse. Stephi wollte unbedingt wieder an einer Regelschule unterrichten und ist die einzige blinde Rektorin in NRW. In ihrer ersten Probestunde gibt sie ihren Schülern eine besondere Aufgabe: Sie sollen Farben in Worte fassen, für Blinde erklären. „Grün steht für Leben“, „ Bäume“, „Ekel“, beschreiben die Schüler ihr die Farbe. Die Jugendlichen helfen ihrer blinden Lehrerin, wenn sie im Klassenzimmer mal die Orientierung verliert. Noch etwas unsicher gleiten Hacers Finger über die Zeichen der Blindenschrift. Fast jeden Abend schult sie ihren Tastsinn. Ihr Traum: Sie möchte später mal ihren Enkeln Märchen vorlesen. Hacer hat ‚Retinopathia pigmentosa‘, eine Erbkrankheit, die zur Erblindung führt. Sie hat noch fünf Prozent Sehkraft und genießt jede Sekunde, in der sie die Farben der Natur, die Gesichter von Menschen sehend erleben kann. Auch Hacer hat im Berufsförderungswerk in Düren Hilfe gefunden, macht dort eine Ausbildung zur Verwaltungsangestellten. Im Moment lebt sie von Hartz 4, aber sie möchte ihr eigenes Geld verdienen. „Ich möchte kein Parasit sein, ich möchte mein Leben selbst bestimmen“, sagt sie. Der Film zeigt, wie Menschen, die nicht von Geburt an blind sind, mit ihrem Schicksal umgehen, nicht verzweifeln, sondern zurück in ein neues Leben finden. In ein Leben 2.0, wie Reiner es nennt. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 27.09.2018 WDR Markus, 35 Jahre, Kind – In der Welt eines Autisten
Folge 27„Ich will gar nicht normal sein und in der Herde mitlaufen. Ich möchte so leben, wie ich will.“ Markus lebt in Duisburg. Seine Wohnung ist unglaublich vollgestopft – mit Spielzeug, Werkzeug und vor allem mit Bewegungsmeldern, die Geräusche machen: Frösche quaken, Elvis singt, ein Schneemann schimpft: „Kannst du nicht aufpassen, alter Sack!“ Und Markus lacht sich kaputt und spielt mit seinen Figuren, stundenlang. Dazu hört er am liebsten Kinderhörspiele und trinkt Kakao. 35 Jahre alt ist Markus, ein Autist, der wohl nie erwachsen wird und es auch nicht werden will.„Das verstehen die Meisten nicht, auch meine Eltern finden das schlimm“, sagt er. Ein Autist, der auch mal Nähe zulässt, der ungewöhnlich aussieht. Mit Prinz Eisenherz-Haarschnitt, Laserpointer um den Hals und bunten Plastikfiguren in der Hand fällt er auf und eckt an. Vor allem sein Vater findet, dass Markus nur wenig Vernünftiges zustande bringt und wünscht sich, dass sein Sohn endlich erwachsen wird. Seine Mutter kümmert sich sehr um Markus. Sie will, dass er rausgeht, dass er andere Menschen trifft, damit er nicht als Autist vereinsamt. Und so hat Markus die Liebe zu Menschen mit Down-Syndrom entdeckt, seine Downies. „Sie nehmen mich so, wie ich bin. Sie hinterfragen meine Art nicht. Das ist ein schönes Gefühl.“ Ramona ist seine engste Freundin, sie wohnt ein Stockwerk unter ihm und ist oft bei ihm. Die Freude am Spielen, die Geräusche, die Liebe, der Kampf um die Anerkennung des Vaters und die Frage, ob er eine Aufgabe in dieser Gesellschaft finden kann – das sind die Themen, die Markus bewegen. Auf seine ganz eigene Art und Weise. Wir haben Markus ein Jahr lang begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 04.10.2018 WDR Sie haben mir mein Kind genommen – Wenn ein Mord die Familie trifft
Folge 28Marion Waade kämpft. Oft ist sie unterwegs, um sich mit anderen betroffenen Angehörigen zu treffen. Allen ist es wie ihr selbst ergangen: Sie haben ein Kind durch Mord verloren. In der Folge fühlen sich die Opfereltern allein gelassen inmitten einer chaotischen Zeit, in der regelmäßig familiäre Welten einstürzen und Lebensträume zerplatzen. Viele leiden unter jahrelangen Depressionen oder Schuldgefühlen. Oft gilt es zusätzlich, komplexe juristische Prozesse rund um den Tod ihrer Kinder durchzustehen. Eine staatliche Anlaufstelle für solche traumatisierten Angehörigen fehle, klagt Marion Waade, oft würden Opferentschädigungen oder Reha-Maßnahmen gar nicht oder erst nach Jahren gezahlt.Deshalb hat die Berlinerin jetzt selbst einen Hilfsverein gegründet – von Angehörigen für Angehörige von Mordopfern. Eine von ihnen ist Miriam Lutz. Die 48jährige Krankenschwester musste ihren Job aufgeben, um ihre kleine Enkelin zu betreuen. Denn ihre Tochter, die Mutter der Kleinen, wurde letztes Jahr von ihrem eifersüchtigen Ehemann getötet. Nun kämpft die Großmutter darum, dass die kleine Enkeltochter weiterhin bei ihr leben darf. Ein ähnliches Schicksal hat auch Lisa Siewe aus Köln. Die alleinerziehende Mutter verlor ihren 19-jährigen Sohn durch eine Messerattacke nach einer Partynacht. Mittlerweile ist der Haupttäter zu fünfeinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, ein aus ihrer Sicht zu mildes Urteil. Doch schlimmer noch, erzählt sie, sei ihr Kampf zurück ins alltägliche Leben. Wie schafft sie es, ihren zwei jüngeren Kindern wieder ein normales Leben bieten zu könne? Hilfen gebe es so gut wie keine. Ständig müsse sie „um alles betteln“, und immer wieder die „Mordgeschichte“ aufs Neue erzählen. Marion Waade kennt diese Situation aus eigener Erfahrung: „Genau darum brauchen die betroffenen Eltern selbst einen staatlich anerkannten Opferstatus“, erklärt sie, „denn auch sie wurden ja zum Opfer von Gewalt – einer psychischen Gewalt, die sie durch den Tod ihrer Kinder erlitten haben“. Dafür brauche es ein neues gesellschaftliches Bewusstsein und bessere Gesetze, fordert die resolute Berlinerin. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 18.10.2018 WDR Wohnbox für Obdachlose – Nächstenliebe und ihr Preis
Folge 29„Ich frage mich oft, ob ich genauso gehandelt hätte, wenn mir alle Konsequenzen schon damals klar gewesen wären“, sagt Sven Lüdecke (40). Und meint den kalten Wintertag 2016, an dem er nicht wegsah, als eine obdachlose Frau mit ihren Plastiktüten rüde aus einem Bahnhof entfernt wurde. Sven will helfen und spricht sie an. Schließlich baut er ihr, inspiriert von einer Idee aus den USA, aus Europaletten eine 3,2 Quadratmeter große, abschließbare und wetterfeste Unterkunft, ein eigenes Mini-Zuhause. Ehrenamtlich engagiert hatte sich Sven Lüdecke zuvor nie, sein Job als Fotograf für eine Hotelkette füllte ihn aus. Plötzlich aber stehen obdachlose Menschen bei ihm Schlange, die ihn ebenfalls um eine Wohnbox bitten.Und Sven Lüdecke hilft, unermüdlich. Baut ein kleines Team auf, gründet den Verein „little home“. Nach kurzer Zeit bekommt er nicht nur Stress mit seinem Arbeitgeber, sondern auch mit seiner Lebensgefährtin, die ihn kaum noch zu Gesicht bekommt. Die Sorgen und Enttäuschungen durch die Probleme der Obdachlosen belasten ihn zusätzlich und dann sieht er sich plötzlich auch noch dem Vorwurf ausgesetzt, in seinem Verein seien angeblich Spendengelder veruntreut worden. Sven Lüdecke ist heillos überfordert und am Ende seiner Kräfte. Trotzdem will er nicht aufgeben: „Wir haben schon so viel erreicht. Ich stehe das durch.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.10.2018 WDR Eltern hinter Gittern
Folge 30„Manchmal stehe ich nachts auf und wein’ mich tot“, sagt Cristina leise. Seit über einem Jahr sitzt sie in der Untersuchungshaft der JVA Köln – und vermisst ihr Kind. Zusammen mit ihrem Mann wurde sie bei einem ihrer zahlreichen Einbrüche erwischt. Da war sie schon schwanger. Im Gefängnis schließlich entbindet sie ihre kleine Tochter, die heute bei der Großmutter aufwächst. Nur zwei Tage konnte Cristina ihr Baby behalten, dann musste sie es abgeben. Christian, der wegen Raub, Waffenbesitz und Körperverletzung zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde, darf seine beiden Kinder alle zwei Monate sehen.Dann spielt er in einem vorbereiteten Besucherraum mit den Kleinen. Zwei Stunden sind erlaubt, so lange dürfen sie basteln und zeichnen. Wie versuchen Eltern im Gefängnis ihrer Aufgabe gerecht zu werden? Rund 100.000 Kinder in Deutschland haben laut Schätzungen ein Elternteil in Haft. Meist ist es der Vater. Die „draußen“ lebenden Mütter brechen den Kontakt zu den inhaftierten Partnern in aller Regel nach etwa zwei Jahren ab. Die Häftlinge hinter Gittern verlieren dann schnell jegliche Beziehung zu den Kindern, die oft meinen, Papa sei auf Montage, im Krankenhaus oder im Ausland. Für den Film „Eltern hinter Gittern“ besuchten die Autorinnen Sylvia Nagel und Sonya Winterberg inhaftierte Mütter und Väter, die über ihre Verbrechen, ihre verpassten Chancen und über ihre Sehnsucht nach den Kindern erzählen. Im Gespräch mit Seelsorgern und Gefängnismitarbeitern wird deutlich, wie schwierig es ist, im Gefängnis die Bedürfnisse derer in den Mittelpunkt zu stellen, um die es eigentlich geht: die Kinder. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 08.11.2018 WDR Arm trotz Arbeit – Warum viele Frauen so wenig verdienen
Folge 31 (45 Min.)„Manchmal stehe ich am Monatsende vor dem Kühlschrank und denke, hoffentlich gibt es bald Geld. Ich muss dringend was einkaufen!“ Das sagt Susanne. Sie arbeitet hart: An fünf Tagen die Woche reinigt sie Krankenhausbetten. Bis zu 23 Betten muss sie in einer Schicht schaffen. „Ich denk’ mir immer, man muss so arbeiten, als würde man selber in so einem Bett liegen“, motiviert sich die 48-Jährige aus Bochum. Sie hat wegen ständiger Rückenschmerzen eine 90%-Stelle und verdient 1.150 Euro netto im Monat. Ins Restaurant gehen oder ein verlängertes Wochenende planen – das ist fast unmöglich.Wenn zu Hause ein Elektrogerät nicht mehr funktioniert, bekommt sie Angst. Angst, ein neues Gerät nicht bezahlen zu können. Dreiviertel aller Frauen zwischen 15 und 65 Jahren arbeiten in Deutschland. Mehr als die Hälfte von ihnen verdient maximal 1.500 Euro netto im Monat. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit – oft wegen der Kindererziehung – oder in prekären Beschäftigungsverhältnissen. So wie Ulrike aus Neuss. „Ich muss alle möglichen Jobs annehmen, um überhaupt auf 1.500 Euro im Monat zu kommen“, erzählt die studierte Opernsängerin. Zurzeit hat sie neun verschiedene Jobs in drei Städten. Sie arbeitet selbständig, hauptsächlich als Gesangslehrerin. Um Geld zu sparen, fährt die 60-Jährige mit dem Fahrrad von Job zu Job. An manchen Tagen bis zu 75 km. Da muss sie fit bleiben: „Krank werden kann ich mir nicht leisten, da verdiene ich ja dann nichts“, sagt Ulrike. „Der Fehler liegt im System“, findet Janina aus Remscheid: „Ich habe das Gefühl, dass Deutschland noch nicht so weit ist wie andere Länder.“ Vor allem die Wertschätzung von arbeitenden Müttern sei im Ausland viel größer, sagt die Alleinerziehende. Janina hat in den Niederlanden Sozialwissenschaften studiert und nach ihrem Uni-Abschluss sofort einen gut bezahlten Job in Maastricht gefunden. Schließlich entschied sie sich wegen ihrer Familie und des Vaters ihrer älteren Tochter zurück nach Deutschland zu gehen. „Es hat zwei Jahre gedauert, bis ich in Deutschland einen Job gefunden habe. Ich habe bestimmt 280 Bewerbungen geschrieben“, erzählt Janina. Sie arbeitete als Marketingangestellte in Teilzeit und verdiente 1.300 Euro netto. Sie war noch in der Probezeit, als ihre beiden Kinder krank wurden und sie eine Woche zu Hause bleiben musste. Das kostete sie ihre neue Arbeitsstelle. Janina ist jetzt wieder auf Jobsuche und hofft, eines Tages auch in Deutschland einen gut bezahlten Job zu finden. Menschen hautnah fragt: Wie schaffen diese Frauen ihren Alltag – im Job und zu Hause? Wie fühlt sich das an, wie im Hamsterrad zu arbeiten und am Monatsende doch nichts mehr im Portemonnaie zu haben? Warum nur verdienen immer noch so viele Frauen so wenig? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 15.11.2018 WDR Patientinnen kämpfen für Gerechtigkeit – Der Krebsmittelskandal von Bottrop
Folge 32„Dass dieser Mensch zwei Gesichter hat, macht mich sprachlos. Bis heute frage ich mich, war es wirklich reine Profitgier oder was anderes“, sagt Christiane Piontek über den Bottroper Apotheker Peter Stadtmann. Sie ist eine von etwa 3700 Patientinnen und Patienten, die gepanschte Krebsmedikamente erhielten. Sie alle hofften, durch Chemotherapie ihren Tumor besiegen zu können und mussten schließlich erfahren, dass sie in einen der größten Arzneimittelskandale Deutschlands geraten waren: Ihre Präparate waren unterdosiert – oder enthielten gar keinen Wirkstoff.Über ein halbes Jahr lang begleitet der Film die betroffenen Frauen, die als Nebenklägerinnen der Verhandlung gegen den Apotheker folgen. Dabei müssen sie im Gericht schweigen, ihre Erfahrungen und ihre Verzweiflung finden in dem Verfahren keinen Platz: „Wir sitzen alle da, mit Wut bis ganz oben, irgendetwas muss jetzt passieren.“ So beschreibt Heike Benedetti ihre Gefühle, bevor sie sich entschließt, einmal im Monat mit den Frauen vor der „Alten Apotheke“ in Bottrop zu demonstrieren. „Ich war früher nie so eine Kämpferin, der Krebs hat vieles ausgelöst“. Der Film zeigt, wie die betrogenen Patientinnen sich gegenseitig stärken und wie sie sich mit viel Mut politisch einmischen. Ihr Weg führt sie bis zum Gesundheitsministerium in Düsseldorf, wo sie für bessere Kontrollen kämpfen. Damit ein solcher Arzneimittelbetrug, der das Vertrauen in Apotheken und Ärzte weit über Bottrop hinaus erschüttert hat, nicht noch einmal passieren kann. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.11.2018 WDR Hilflose Helden – Whistleblower ohne Schutz
Folge 33Rudolph Schmenger arbeitet als Steuerfahnder im Frankfurter Finanzamt. Ende der 90er Jahre deckt er auf, dass Großbanken ihren vermögenden Kunden helfen, Milliardenbeträge an der Steuer vorbei ins Ausland zu schleusen. Aber sein Chef pfeift ihn zurück und stellt ihn und siebzig weitere Steuerfahnder kalt. „Ziel war diese Beamten moralisch zu zerbrechen.“, erinnert sich Rudolf Schmenger, „sichtbar für alle anderen Kollegen im Behördenzentrum, so dass in Zukunft keiner mehr aufsteht und auf Missstände hinweist.“ Die Strategie gelingt, nach und nach geben alle Steuerfahnder klein bei.Fast alle. Als Einziger kämpft Rudolf Schmenger bis heute. Vor Gericht siegt er in allen Instanzen, aber auf seine berufliche Rehabilitierung wartet er noch. Wie hat er das durchgestanden? Sein Fall ging durch die Presse, Rudolf Schmenger ist einer der bekanntesten Whistleblower der Republik. Könnte sich ein solcher Skandal heute noch einmal wiederholen? Wie sieht die Rechtslage heute aus? Geht es Whist-leblowern heute besser? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.11.2018 WDR Zwei Familien steigen aus – Mit den Kindern in Jurte und Mini-Haus
Folge 34„Wir wollen rauskommen aus diesem Rädchen von Arbeit, Erschöpfung und Konsum“. Katharina und Kolja steigen aus, raus aus dem Konsum. Zusammen mit Tochter Klara ziehen sie in ein selbstgebautes fahrbares Mini-Haus. In das neue Domizil haben sie all ihre Ersparnisse investiert, nun wollen sie mit so wenig Geld wie möglich, aber mit viel Zeit für die kleine Klara leben. Vor allem junge Familien träumen von einem Leben ohne beruflichem Hamsterrad und teurer Miete. Sie wollen flexibel bleiben, sparsam wirtschaften und Zeit füreinander haben.Auch Alina und Flo haben ihren Traum verwirklicht und wohnen mit ihren beiden Töchtern in einer Jurte. Das große Rundzelt mit Ofen ist ihre Heimat – an den verschiedensten Plätzen Deutschlands. „Wir wollen Abenteuer erleben und uns nahe sein“, sagt Alina. Doch ein längeres Leben als „Konsum-Aussteiger“ mit Kindern kann hürdenreich werden. Autor Patrick Stijfhals hat beide Familien über drei Jahre immer wieder besucht und dabei auch die Schattenseiten dokumentiert: „Wir waren damals naiv“, sagt Katharina heute, die zeitweise mit ihrer Familie das Tiny House verlassen musste: „Wir haben gedacht, es gibt so viele grüne Flächen und da stellen wir uns einfach irgendwo hin“. Alina und Flo machen ähnliche Erfahrungen und müssen ihre Jurte immer wieder abschlagen und ihre Ideen auf den Prüfstand stellen. „Es gibt kein Ideal, wir müssen uns immer anpassen“, sagt Alina drei Jahre später. Werden die beiden Familien herausfinden, was sie wirklich zum Leben brauchen – und: Gelingt es ihnen auf Dauer mit wenig Geld mehr Zeit und Freiheit zu gewinnen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 29.11.2018 WDR Diesen Kampf werde ich gewinnen! Krebs bei jungen Menschen
Folge 35Seit Wochen bangt Lisa: „Ich habe Angst vor der finalen Untersuchung. Sie wird zeigen, ob die Therapie angeschlagen hat, ob der Tumor wirklich vernichtet wurde.“ Mit 24 Jahren, kurz vor ihrem Staatsexamen zur Grundschullehrerin machte sich der Lymphdrüsenkrebs bemerkbar. Seit damals steht Lisas Leben Kopf. In Deutschland erkranken jährlich 15.000 junge Erwachsene an Krebs. Eine Diagnose, die auf besondere Weise niederschmetternd ist, weil andere gerade zu studieren beginnen, im Beruf durchstarten oder eine Familie gründen. Während man in langen Therapien auf Heilung wartet, setzen Freundinnen und Freunde die ersten Karriereschritte, die ersten Kinder werden geboren. Bei jungen Krebskranken liegt die Zukunft im Ungewissen.Vielen fehlt die finanzielle Absicherung und nicht selten hat der Krebs in jungen Jahren sogar einen besonders aggressiven Verlauf. Langzeitfolgen und Unfruchtbarkeit belasten die Perspektiven und im schlimmsten Fall kommt die Krankheit wieder. So wie bei Julian (26) aus Mainz und Karolina (20) aus Aachen. Für den Film „Diesen Kampf werde ich gewinnen“ begleiten die Autoren Jens Niehuss und Marcel Martschoke drei junge Erwachsene, die in ihrer Stärke und Zuversicht beispielhaft sind. Sie meistern auf ungewöhnliche Weise ihren Alltag und bauen ihr Leben von Therapie zu Therapie immer wieder neu auf. Jeder der Drei hat einen anderen Weg gefunden, mit dem Jetzt und mit der ungewissen Zukunft umzugehen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 06.12.2018 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.