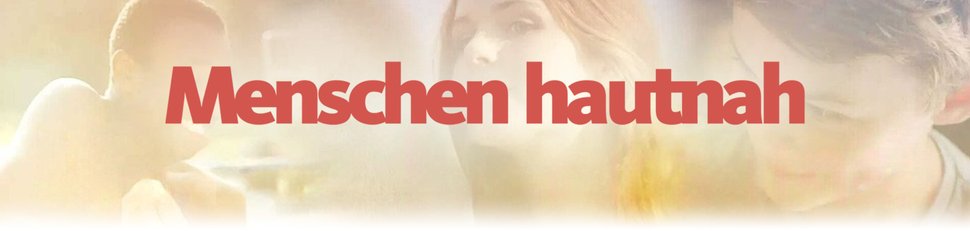2019, Folge 1–16
Ehe aus Vernunft – Geht es wirklich ohne Liebe?
Folge 1Heiraten, Kinder bekommen und mit dem Partner ein Geschäft aufbauen – das war der große Lebenstraum von Susanne Wendel. Doch was fehlte, war der richtige Mann. Mit 35 Jahren hatte sie sich von ihrem langjährigen Freund getrennt. Mit 38 war die Buchautorin immer noch Single und auf der Suche nach dem Richtigen. Während eines Seminars riet ihr die Trainerin, sich doch einfach ein Ziel zu setzen: eine Verlobung. Susanne überlegte nicht lange, machte eine Kandidatenliste und verlobte sich 5 Tage später mit Frank Thomas. Beide waren nicht verliebt, aber beide hatten dieselben Ziele: „Das mit dem Verliebt sein braucht es aus meiner Sicht nicht unbedingt, es braucht nicht dieses Bild vom Traummann, denn es kommt ja auf was ganz anderes an“, ist Susanne überzeugt.Ehe aus wirtschaftlichen Gründen Manuela und Oli haben aus Liebe geheiratet, Romantik war ihnen wichtig, aber im Alltag blieb die Verliebtheit nach und nach immer mehr auf der Strecke. Manuela zog schließlich aus und war ein Jahr lang die Geliebte eines verheiraten Mannes. Irgendwann spürte sie jedoch, dass sie allein in der kleinen Wohnung unglücklich war. Sie entschied sich dafür, zurück in das gemeinsame Haus zu ziehen: „So viel Geld raus zu schmeißen für Miete ist einfach so ärgerlich, da haben wir aus wirtschaftlichen Gründen, dann auch einfach gesagt: Komm wir probieren es zusammen.“ Nun leben sie miteinander und nebeneinander in einem Haus. Die Basis ihrer Ehe: Freundschaft. Heiraten wegen des Kindes Ein Kind war der Grund, dass Sascha und Tanja aus Köln mit 17 Jahren geheiratet haben. Sie war schwanger und seine Mutter bestand darauf, dass die Jugendlichen heiraten. Ein Paar waren sie vorher nie gewesen, nur Freunde. Mittlerweile haben sie zwei weitere Kinder und sind noch immer zusammen – seit 31 Jahren. Sie haben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber Trennung ist für Beide kein Thema: „Das war so eine Vernunftentscheidung. Wir ziehen das Ding durch, das war für mich klar.“ sagt Sascha. „Menschen hautnah“-Autorin Katharina Wulff-Bräutigam zeigt drei ungewöhnliche Beziehungen, die auf ihre eigene Art und Weise funktionieren. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 10.01.2019 WDR Kenos kurzes Leben – Wenn Kinder sterben müssen
Folge 2Im Frühjahr 2010 trifft Menschen hautnah-Autor Jan Schmitt den achtjährigen Keno und seine Mutter Karin zum ersten Mal. Wenige Wochen zuvor hat sie die Prognose bekommen: In spätestens drei Jahren soll Keno tot sein. Ihr Kind, das bislang ganz normal lebte, lernte, spielte. Alles fängt mit einem Schielen an, dann sinken die Leistungen des Jungen in der Schule. Keno wird an den Augen operiert, aber sein Zustand verschlechtert sich weiter. Es folgen Untersuchungen, Tests. Schließlich kommt heraus, dass er an „Adrenoleukodystrophie“ leidet. Die extrem seltene Erbkrankheit führt dazu, dass Kinder nach und nach nicht mehr sehen, hören und sprechen können.Sie verlieren alle Sinne und Fähigkeiten, können sich immer weniger bewegen, werden ans Bett gefesselt. Auch Keno wird sich verkapseln, tief in sich selbst. Seine Mutter erhält Hilfe von einem Kinderpalliativteam. Die Ärzte und Pfleger versorgen Keno, sie sind rund um die Uhr erreichbar. Ohne sie könnte Keno nicht zuhause bleiben. Nur wenige Eltern in Deutschland haben damals diese Unterstützung. Der Autor begleitet Keno und seine Familie jahrelang, in leichten und schweren Momenten, wenn die Krankheit kurz vergessen wird und wenn sie unbarmherzig ihr Gesicht zeigt. In eindrucksvoller Offenheit berichtet seine Mutter von ihren inneren Kämpfen. Sie spricht vom Sterben und beschreibt dabei, was das Leben eigentlich ausmacht. Der Film zeigt, wie sehr Eltern sterbender Kinder auf Hilfe angewiesen sind und welch ein Glück es bedeutet, in den Genuss dieser Hilfe zu kommen, eine Hilfe, auf die eigentlich jeder ein Recht hat. Kenos Sterben wird eine Reise, die für alle viel länger dauert als ursprünglich vermutet und die seiner Mutter alle Kraft abverlangt. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 24.01.2019 WDR Bei diesem Film handelt es sich um eine aktualisierte Version der Doku „Wenn ich sterbe, werde ich ein Adler“ (Erstsendung 26.2.2016).Frauke Petry – Aufstieg, Fall und jetzt?
Folge 3Sie war der Star der rechtspopulistischen Bewegung in Deutschland, Chefin der AfD, das Gesicht der Partei. Eine junge Frau aus dem Osten, als Unternehmerin gescheitert und binnen kürzester Zeit aufgestiegen in die erste Reihe der Politik. Sie war eine Strategin, der man Rücksichtslosigkeit und Machtbesessenheit nachsagte, und die im entscheidenden Moment alles hinschmiss: Frauke Petry. Kurz nach der Bundestagswahl 2017 tritt sie mit einem Paukenschlag aus der AfD aus, setzt alles auf eine Karte. Sie rechnet damit, dass das die Partei zerlegen könnte. Aber kaum jemand folgt Ihr. Die AfD kommt inzwischen sehr gut ohne sie zurecht. Jetzt sitzt sie als Fraktionslose im Bundestag in der hintersten Reihe und kämpft ums politische Überleben.Sie macht weiter mit einer neuen Partei, die kaum einer kennt, mit wenigen Getreuen an ihrer Seite. Ist das das Ende der Karriere der umstrittenen Politikerin oder kommt da noch was? Wir haben Frauke Petry nach ihrem spektakulären Austritt aus der AfD ein Jahr lang exklusiv begleitet, ehemalige Mitstreiter und enge Vertraute befragt, wollten verstehen, was Petry antreibt und wo sie eigentlich politisch hin will. Gibt es für ihr neues konservatives Parteienprojekt überhaupt noch Platz zwischen CSU und AfD? Das Programm ihrer blauen Partei unterscheidet sich kaum von der AfD. Was ist von ihrem Schlingerkurs zwischen vagen konservativen Ideen und neoliberalen wirtschaftspolitischen Vorstellungen zu halten? Lebt sie überhaupt, was sie vertritt? Neben ihrem politischen Projekt managt Petry auch noch eine Patchwork-Wochenendehe mit zeitweilig neun Kindern, fünf eigenen und vier von ihrem zweiten Mann, dem Ex-AfD-Chef von Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell. Wie das alles zusammengeht, weiß Petry manchmal selbst nicht. Ihr Leben ist auf Kante genäht, aber Petry scheut kein Risiko: „Wenn ich etwas umsetzen will, von dem ich mir vorher gut überlegt habe, dass das genauso laufen muss, dann bringt man mich auch nur schwer davon ab.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 31.01.2019 WDR Komm zur Welt, auch wenn Du stirbst – Schwanger mit todkrankem Kind
Folge 4 (40 Min.)Alles läuft zunächst so, wie es Leslie und Tobias sich vorgestellt haben: Nach der Hochzeit wird Leslie schwanger. Sechs Monate lang sind sie überglücklich. Doch dann erfahren die Eltern bei einer Ultraschalluntersuchung, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Zunächst ist nur von „Auffälligkeiten“ die Rede. Nach der Fruchtwasseruntersuchung steht fest: Ihr Kind, das sie Lou nennen, hat Trisomie 13, eine schwere Chromosomenstörung, die unheilbar ist. Ihre Lebenserwartung ist gering, vielleicht wird sie sogar schon im Mutterleib sterben. Die Ärzte raten zu einer Abtreibung. Bei einer solchen Diagnose entscheiden sich die meisten Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch.Leslie und Tobias machen es anders. Sie wollen Lou kennen lernen. Lou soll geboren werden, aber keine lebensverlängernden Maßnahmen erhalten, nur Medikamente gegen die Schmerzen. Eine sogenannte palliative Geburt. Wie lange Lou leben wird, ist ungewiss. Ein paar Stunden oder vielleicht auch ein paar Wochen nach der Geburt, sagen die Ärzte. Wie halten Leslie und Tobias diese extreme Ungewissheit aus? Werden ihre Kräfte reichen, um diesen Weg bis zum Ende zu gehen? Julia und Mario sind den palliativen Weg bereits gegangen. Ihre Tochter Lilli hatte ebenfalls eine tödliche Chromosomenstörung. Nach der Geburt durften Julia und Marion sie noch 30 Minuten lebend in den Armen halten. Dann ist sie gestorben. Im Kinderhospiz konnte sich das Paar von ihrer Tochter verabschieden – eine Zeit, für die sie heute unendlich dankbar sind. Julia wird danach schnell wieder schwanger. Ihr kleiner Merlin ist gesund und entwickelt sich gut. Doch bei aller Freude darüber wollen Julia und Mario ihr erstes Kind nicht vergessen. Durch die kostbaren Momente, die sie mit Lilly erleben durften, bleiben sie mit ihr verbunden. Für „Menschen hautnah“ hat Christian Pietscher die beiden Paare in diesen sehr intimen Lebensphasen ein halbes Jahr lang begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 07.02.2019 WDR Meine Gemeinde, meine Familie
Folge 5Die katholische Kirche in Deutschland leidet an dramatischem Priestermangel. Immer mehr Gemeinden verlieren dadurch ihre Eigenständigkeit, werden zusammengelegt,- dies führt zu heftigen Konflikten in vielen Bistümern. Der Film erzählt aus verschiedenen Regionen der Republik wie versucht wird, diese Situation auf unterschiedliche Weise zu bewältigen. Chiara Pöllen lebt in Essen Margarethenhöhe. Die 22-Jährige studiert Heilpädagogik und engagiert sich nebenbei in der Gemeinde zur Heiligen Familie in Essen. Nachdem die Bistumsleitung entschieden hatte, die eigenständige Gemeinde zu schließen, versuchen nun die Mitglieder ein Modell ohne eigenen Priester.Die Gemeinde organisiert sich durch zahlreiche motivierte Mitglieder wie Chiara seit zwei Jahren selber. „Auf der Margaretenhöhe zu leben und in dieser Gemeinde zu sein, das ist Familie, das ist Freude, das ist Leben, das ist Liebe, das ist wirklich alles für mich!“ Aber wie kann das funktionieren? Johann Thomas ist Teil des Eifler Widerstandes gegen die Reformen im Bistum Trier. Er und seine Mitstreiter sind es leid, dass von oben herab über ihr Gemeindeleben entschieden wird. Nun demonstrieren sie gegen das Bistum in der Hoffnung, eine friedliche Lösung zu finden. Und sie wollen sich entschieden gegen die Zusammenlegung wehren. „Demokratie kennt die Kirche nicht. Darum müssen wir darauf hoffen, dass von oben der Geist kommt.“ Im Bistum Paderborn wie auch an vielen anderen Orten sollen ausländische Aushilfspriester den Priestermangel ausgleichen. Aber ist das Modell erfolgreich? Welche Probleme ergeben sich? Pastor Liju aus dem indischen Kerala ist seit dem Frühjahr 2017 Aushilfspriester in einer westfälischen Gemeinde. Deutschland ist für ihn gewöhnungsbedürftig. Neben der neuen Kultur muss er auch lernen, mit der Sprache und seinem Heimweh klar zu kommen: „Ich vermisse meine Eltern und meine Geschwister, aber auch andere Verwandte.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.02.2019 WDR Wohnen wie im Wilden Westen – Die Indianersiedlung in Köln
Folge 6Im Kölner Süden, zwischen Gleisen und einem Friedhof, liegt eine Siedlung, wie es sie in deutschen Großstadt selten gibt: Ein Dorf mitten in der Stadt, die sogenannte „Indianersiedlung“. Ein kleines Paradies für rund 350 Bewohner. In kleinen Holzhäusern leben Künstler und Lebenskünstler, Lehrer und Manager eng nebeneinander. Erstmals in der Weimarer Republik besiedelt, ging es mit dem Areal immer wieder auf und ab. In den siebziger Jahren zogen Hippies mit Bauwagen und wandernde Musiker auf das wild überwucherte Gelände. Die Siedlung war von Räumung und Abriss bedroht, doch die Siedler widersetzen sich und blieben.Ein Pferdestall mit Koppel und eine Festwiese, auf der die Siedler jährlich ein Festival veranstalten, bilden das Zentrum. Eigenwillig und naturverbunden leben die Menschen hier, ein bisschen wie Indianer, finden sie. Dieser Lebensstil gibt der Siedlung ihren Namen. Doch das Paradies ist wieder einmal bedroht, die „Siedler“ müssen kämpfen: Die Stadt Köln hat Pläne mit der großen, noch freien Gemeinschaftsfläche inmitten der Siedlung. Es ist eine „Sahneschnitte“ in Köln, wo Wohnungsmangel herrscht wie in allen deutschen Großstädten. Wohnraum soll auf der Freifläche entstehen, ein Investor möchte dort bauen. Die Siedler fürchten um den einzigartigen Charakter ihrer Siedlung und entwickeln einen Plan: Sie wollen selber bauen, für Alte und Behinderte, für sozial Schwache und Flüchtlinge. Eine Riesenherausforderung und eine Idee, die nicht alle gut finden und die Siedler spaltet. Der Film porträtiert die unterschiedlichen Menschen, die sich in dieser für eine deutsche Metropole einzigartigen Siedlung zusammen gefunden haben. Über ein Jahr haben die Menschen hautnah-Autoren Michael Müller und Martin Kießling sie begleitet, in ihrem Alltag und bei ihrem Ringen um die Zukunft. Ein Jahr Leben, fast wie im Wilden Westen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 21.02.2019 WDR Kinder sind wie Licht – Jenny kämpft für Roma-Familie
Folge 7Jennys Geschichte beginnt mit einem Zufall. Im Winter 2007 entdeckt sie während einer Rumänienreise einen Slum in der Nähe von Sibiu-Herrmannstadt. Die Kinder sind unterernährt. Viele Babys schweben in Lebensgefahr. Es gibt keinen Strom, kein fließend Wasser, nur Hütten, Dreck und Krankheiten. Jenny, damals 23 Jahre, ist erschüttert. Sie beschließt vor Ort zu helfen. Zurück in Deutschland, gründet sie eine Hilfsorganisation und zieht kurz darauf mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern nach Rumänien. Jenny möchte vor Ort helfen.Sie beginnt mit dem Elementarsten und versorgt die Roma mit Essen und warmer Kleidung. Und sie übernimmt Verantwortung für die 40 Kinder im Slum. Mit Spendengeldern aus Deutschland und der Schweiz gründet sie ein Tageszentrum mit einer angegliederten Schule für Analphabeten. Die ersten Jahre sind schwierig. Die Kinder, die bisher ein elendes Bettlerleben führten, sind traumatisiert. Und dennoch: Mit der Zeit fassen sie Vertrauen zu Jenny. Der 16-jährige Dani zum Beispiel wurde von seinem Vater nach dem Tod der Mutter verlassen. Damit seine beiden jüngeren Schwestern nicht in ein Heim müssen, baut er mit anderen Jugendlichen aus der Siedlung ein kleines Haus und übernimmt Verantwortung für die Mädchen. Mittlerweile besuchen viele der Kinder weiterführende Schulen oder erlernen einen Beruf. Sie haben das Kommando in der Siedlung übernommen. Die erste Generation, die wieder Lust auf Leben entwickelt. Die Dokumentation erzählt die Geschichte einer Frau, die unermüdlich kämpft: für ein besseres Leben der Roma-Kinder, für weniger Leid, für Gerechtigkeit und Chancengleichheit. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 07.03.2019 WDR Heute euphorisch, morgen depressiv – Arno ist bipolar
Folge 8Arno W. leidet an einer bipolaren Störung – seine Stimmung schwankt zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Seit mehr als 15 Jahren stellt die Krankheit sein Leben immer wieder komplett auf den Kopf. Als die „Menschen hautnah“-Autoren Arno kennenlernen, ist er in einer manischen Phase. Da wirkt er wie ein leicht überdrehter, freiheitsliebender, kreativer Künstlertyp. Er spricht offen über seine bipolare Störung, aber er selbst empfindet sich nicht als krank: „Also, ich würde es auch nie als krank bezeichnen, sondern als eine Range, die meines Charakters, meiner hormonellen Versorgung im Kopf entspricht.“ Er fühlt sich von seinen Eltern verfolgt und ist deswegen in einem Schrebergarten untergetaucht: „Ich habe Angst davor, von meinen Eltern in die Psychiatrie gebracht zu werden.Oder, von meinen Emotionen weggehalten zu werden und dann meiner Krankheit ausgesetzt zu werden. Der Kranke zu sein. Stigmatisiert zu werden.“ Wann die übersteigerten Stimmungsschwankungen kommen, ist nicht vorhersehbar. Es gab schon Jahre, in denen Arno krankheitsfrei war und dann wieder wechseln Depression und Manie in kürzerer Zeit. In der manischen Phase ist Arno besonders aktiv und euphorisch. Er redet viel, ist sehr kontaktfreudig, braucht kaum Schlaf, lässt sich durch die Stadt treiben, will sein Leben intensiv spüren und genießen. Bei seinem Ego-Trip denkt er selten an ein Morgen. Irgendwann verlässt Arno den Schrebergarten. Die Eltern wissen oft nicht, wo er ist. Die letzte Nachricht kommt aus Berlin – da klingt Arno bereits sehr verwirrt und fühlt sich von der Polizei verfolgt. Dann bricht der Kontakt zu ihm ab. Seine Eltern geben die Hoffnung fast auf und beginnen sich damit auseinanderzusetzen, dass sie ihren Sohn dieses Mal vielleicht nicht mehr lebend wiedersehen. Bis er sich eines Tages meldet: aus der Psychiatrie. Er will den Kontakt zu seinen Eltern wieder suchen. Die haben sich monatelang Sorgen um ihren Sohn gemacht. Mal wussten sie gar nicht, wo er ist und was er macht. Dann wiederum terrorisierte er sie vor allem mit nächtlichen Telefonanrufen. Sein Vater erzählt: „Das war die längste Phase, die ich je erlebt habe, und auch die extremste Phase. Mit extremen Beschimpfungen. Die Persönlichkeit ist absolut weg. Es ist ein ganz anderer Mensch!“ Nun zieht Arno, der nach dem Psychiatrieaufenthalt wohnungslos ist, zurück zu seinem Vater. Die Mutter wohnt ein paar Autokilometer entfernt. Beide stehen ihm zur Seite. Mit 40 Jahren hat Arno die bislang längste manische Phase hinter sich. Er hat keine Arbeit, Schulden, keine eigene Wohnung und scheut den Kontakt zu alten Freunden und Bekannten. Er fühlt sich völlig energielos und weiß, die Depression wird kommen. Wie lange wird sie ihn diesmal außer Gefecht setzen? „Menschen hautnah“ hat Arno und seine Eltern 1½ Jahre auf dem Weg raus aus der Krankheitsphase und dem Ringen nach so etwas wie „Normalität“ begleitet. Sie geben einen Einblick in ein Leben mit einer der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen in Deutschland, von der Arno stark betroffen ist. Jeder sechste bipolar Erkrankte nimmt sich das Leben, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen. Auch Arno hat vor vielen Jahren versucht, sich in einer depressiven Phase umzubringen: „Und jetzt muss man versuchen, dass ich zumindest nicht mehr in so tiefe Depressionen gerate, dass es so weit kommt“, erzählt er. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.03.2019 WDR Über mein Ende will ich selbst entscheiden
Folge 9Jürgen (50) ist nach einem Hirnstamminfarkt komplett gelähmt. Es geschah von einer Sekunde auf die andere. Aus dem sportlichen Mann wurde ein Schwerstbehinderter, der seither kaum mehr als den Kopf bewegen kann. Er war damals 36 Jahre alt. Auch Harald (48) braucht rund um die Uhr Betreuung. Er leidet unter Multipler Sklerose. Die Krankheit verlief in Schüben, heute ist er bis zum Hals gelähmt. Wenn Harald und Jürgen ihr Leben nicht mehr ertragen können, wollen sie die Freiheit haben, es zu beenden. Doch das wird nicht ohne fremde Hilfe gehen.Darüber, ob unsere Gesetze das zulassen, wird zurzeit heftig gestritten – auch vor Gericht. Erst 2015 ist der Paragraph 217 StGB in Kraft getreten, der die „geschäftsmäßige“ Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Er wendet sich vor allem gegen Sterbehilfevereine – möglicherweise aber auch gegen Ärzte, die einem langjährigen Patienten bei einem solchen Schritt helfen würden. Dem Palliativmediziner Benedikt Matenaer, Jürgens Arzt, würde dann Gefängnis drohen. Mit anderen Medizinern hat er daher Verfassungsbeschwerde gegen den § 217 eingelegt. Und Harald hat sich an den Rechtsanwalt Robert Roßbruch gewandt, der seit Jahren für die Patientenautonomie am Lebensende streitet. Der hat für ihn ein todbringendes Betäubungsmittel beim Bundesinstitut für Arzneimittel in Bonn beantragt. Wird er es bekommen? Harald und Jürgen, zwei Schwerstkranke, kämpfen darum, das Selbstbestimmungsrecht über ihr Leben zu behalten – wozu für sie auch gehört, dem Ganzen ein Ende setzen zu können. Beide haben Angst vor der Zukunft – aber wer weiß, was kommt? Jürgens Leben verändert sich völlig unerwartet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 21.03.2019 WDR Gasthof zum neuen Leben – Eine Familie kämpft für sich und das Dorf
Folge 10Es ist voll auf dem Dorfplatz in Fürstenberg. Alle sind heute gekommen: der Spielmannszug, der Karnevalsverein, der Bürgermeister, die Jagdhornbläser. Denn alle wollen sich bei Franz Hartong bedanken. In der siebten Generation seiner Familie ist der 69-Jährige Gastwirt in dem kleinen Ort in Ostwestfalen. Aber heute ist Schluss, Franz Hartong schließt seine Gaststätte. Restaurant, Kneipe, Versammlungsort für Vereine, Proberaum für den Chor, ob nach Beerdigungen oder bei runden Geburtstagen – der Gasthof Hartong war die zentrale Anlaufstelle in Fürstenberg.Lange sah es so aus, als würde die Gaststätte für immer schließen müssen. Niemand wollte die viele Arbeit als Dorfgastwirt auf sich nehmen. Eine Katastrophe für das Dorfleben. Aber dann meldete sich völlig überraschend Familie Klaaßen. Mutter Ruth arbeitet als Erzieherin, Vater Reimund als Industriemechaniker. Sie haben kaum Erfahrung in der Gastronomie. Doch gemeinsam mit den drei Kindern wollen sie versuchen, den Gasthof zu retten – und damit vielleicht auch sich selbst. Denn die Klaaßens haben eine harte Zeit hinter sich. Ein halbes Jahr zuvor haben sie ihre zweitälteste Tochter Hannah (17) bei einem Autounfall verloren. Jetzt fragt sich Ruth Klaaßen, wie sie nach dieser familiären Katastrophe weitermachen sollen. Da kam ihr die Idee mit dem Gasthof. Könnte das der Neuanfang sein, den die Familie jetzt brauchte? „Hannah hätte das großartig gefunden“, glaubt die Mutter. Also wagt die Familie den Schritt und kauft die Gaststätte. Nun haben sie nach dem Abschied des Vorgängers nur einen Monat Zeit, um die neuen Dorfwirte zu werden. Obwohl Reimund Klaaßen geborener Fürstenberger ist, ahnt er, dass es schwierig werden könnte. „Wir müssen uns das Vertrauen der Gäste neu erarbeiten.“ Der Film begleitet die Klaaßens durch eine aufregende Zeit voller großer und kleiner Dramen, voller Hoffnungen und Rückschläge. Sie müssen unter Zeit- und Gelddruck den Gasthof umbauen, das Zimmer der toten Tochter ausräumen und dann mitten in der stürmischen Anfangsphase den Jahrestag des Unfalls durchstehen. Wird das Dorf sie bei ihrem mutigen Neustart unterstützen? Wie stehen sie die stressige Zeit gesundheitlich durch? Schafft die Familie den erhofften Neustart? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 28.03.2019 WDR Vater unbekannt – Anonym gezeugt
Folge 11Ihren biologischen Vater kennt Anja nicht – sie wurde mithilfe einer Samenspende gezeugt. Seit ihre Eltern ihr das offenbart haben, sucht sie diesen Unbekannten. Nicht zu wissen, von wem sie abstammt, welche Eigenschaften dieses fremden Mannes sie geerbt hat, treibt sie um: Sie will diese Leerstelle füllen. Als Anja 2015 die Suche nach ihrem biologischen Vater aufnahm, haben wir sie mit der Kamera begleitet. Gerald ist als junger Mann so ein Samenspender gewesen. Er sieht Anjas Geschichte im WDR-Fernsehen bei ‚Menschen hautnah‘ und nimmt Kontakt zu Anja auf. Sie könnte doch seine Tochter sein! Er hat damals in eben der Arztpraxis gespendet, in der Anja gezeugt wurde.Heute ist Gerald ein glücklich verheirateter Familienmensch. Damals war die Samenspende für ihn ein Nebenjob, mit dem er sich ein Klavier verdient hat. Doch spätestens durch Anjas Geschichte ist dem 50-Jährigen bewusst geworden, dass er als biologischer Vater mit Menschen verbunden ist, von denen er bislang nichts weiß. Menschen, die ihm genauso ähnlich sein können wie seine drei Söhne. Er möchte den Kindern, die durch seine Samenspende entstanden sind, die Möglichkeit geben, ihn zu finden. Und ihn kennen zu lernen, wenn sie das möchten. Doch das ist schwierig: Damals, als Gerald Samenspender war und Anja gezeugt wurde, geschah das anonym. Die Reproduktionsmediziner sagen, dass es deshalb keine Unterlagen mehr gibt, die biologische Väter und Samenspenderkinder bei der Suche helfen könnten. Aufgeben aber wollen Gerald und Anja nicht. Anja reicht wie viele andere Samenspenderkinder ihre DNA in Gendatenbanken ein. Darüber lassen sich überall auf der Welt Verwandte finden. Und vielleicht findet sich auch eine Spur zu ihrem biologischen Vater. Und auch Gerald ist über diese Datenbanken jetzt als biologischer Vater zu finden … (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 04.04.2019 WDR Mama auf Zeit – Eine Familie für Babys in Not
Folge 12Wenn das Jugendamt bei Familie N. in der Eifel anruft, muss alles schnell gehen. Dann wird ein Kind aus seiner Familie genommen und zu Michaela N. und ihrem Mann gebracht. Diesmal ist es ein sieben Wochen alter Säugling. Es besteht Verdacht auf Kindesmisshandlung. Von seiner Mutter wurde er gerade noch gestillt, nun muss er sich an völlig fremde Menschen gewöhnen. Von jetzt auf gleich in ein neues Zuhause. Familie N. ist eine sogenannte Bereitschaftspflegefamilie. Solche Familien nehmen Kinder in akuten Notsituationen für einen bestimmten Zeitraum auf. Meistens ist zu diesem Zeitpunkt nicht rechtlich geklärt, ob das Kind irgendwann wieder zu den leiblichen Eltern zurückkehren kann.„Erstmal brauchen die Kleinen ganz viel Liebe und körperliche Nähe“, weiß Pflegemama Michaela N.. Der Kleine ist ihr 18. Baby auf Zeit. Zusammen mit ihrer Familie wird sie von nun an 24 Stunden am Tag für ihn da sein – bis das Jugendamt eine langfristige Lösung findet. Das dauert manchmal Monate, manchmal auch mehr als ein Jahr. Zeit, in der das Kind und die Familie immer weiter zusammenwachsen. Selten kommen Kinder dann zurück zu den leiblichen Eltern, meistens wird eine Familie gesucht, in der das Kind dauerhaft bleiben und aufwachsen kann. Nach sechs Monaten hat das Jugendamt neue Pflegeeltern für das Baby gefunden. Nun heißt es Abschied nehmen für Familie N., das gehört zur Bereitschaftspflege dazu. Weh tut es trotzdem: „Da fließen jedes Mal Tränen“, so die Notfall-Mutter. Aber es ist ein Loslassen über mehrere Wochen. Die neuen Pflegeeltern besuchen Familie N. und den kleinen Jungen immer wieder, damit er sich an sie gewöhnen kann.“Menschen hautnah“ hat das Baby, die Bereitschaftspflegefamilie und die neuen Pflegeeltern auf ihrem emotionalen Weg begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 11.04.2019 WDR Erwachsen werden mit Querschnittslähmung
Folge 13Kevin aus Lünen war 14 Jahre alt, als er sich im Freibad zwei Halswirbel brach. Kopfüber war er eine Rutsche heruntergerutscht und auf dem Beckengrund aufgeschlagen. Er überlebte, ist aber seither vom Hals abwärts gelähmt. Marc aus Marl war 16, als er sich in Holland beim Kitesurfen schwer verletzte. Auch er kann sich vom Hals ab nicht mehr bewegen. Ein halbes Jahr lang teilten sich beide ein Zimmer im Uniklinikum Bergmannsheil in Bochum. Dort lernte Menschen hautnah-Autorin Justine Rosenkranz sie und ihre Familien vor 10 Jahren kennen. 2009 entstand daraus die Dokumentation „Unglück am Wasser“.In den vergangenen 10 Jahren hat Justine Rosenkranz die beiden weiter mit der Kamera begleitet und konnte beobachten, wie sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden mit ihrer Behinderung umgehen und ihr Leben meistern. „Die schlimmste Zeit war der Anfang zuhause“, sagt Kevin heute. Inzwischen ist er 24 Jahre alt und lebt immer noch in Lünen, 24 Stunden am Tag betreut von Pflegekräften. Kevin hat zwar gelernt, mit seiner Behinderung umzugehen. Doch er fühlt sich oft isoliert und will, dass sich sein Leben ändert. Jetzt hofft er, an einer wissenschaftlichen Studie der Uniklinik Bochum teilnehmen zu können. Deren Ziel es ist, querschnittgelähmten Menschen den Alltag zu erleichtern. Sie sollen einen Rollstuhl allein mit der Kraft Ihrer Gedanken steuern können. Wird Kevin das gelingen? Der mittlerweile 26 Jahre alte Marc hat seinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und sucht nach immer neuen Herausforderungen im Leben, die er trotz seiner körperlichen Einschränkungen bestehen kann. Sein Traum wäre ein Fallschirmsprung – mit seiner Behinderung eigentlich unvorstellbar. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.04.2019 WDR Anastasia – Oberstleutnant, Kommandeurin, Transgender
Folge 14Anastasia Biefang ist die erste Transgender-Kommandeurin in der Geschichte der Bundeswehr. Erst im Alter von 40 Jahren wagt sie den Schritt, sich ihrem Arbeitgeber gegenüber zu öffnen. Sie sagt ihm, dass sie transgender ist und künftig als Frau angesprochen werden möchte: „Ende 2014 habe ich für mich entschlossen, einen Schlussstrich unter mein männliches Leben zu setzen. ( …) Also es war mir völlig egal wie nach einem Outing, insbesondere im Beruf dann die Bundeswehr mit mir umgeht, was passiert. Für mich war einfach wichtig, dass es mir wieder gut geht – persönlich“, erzählt die heute 44-Jährige im Film.Bis dahin war sie bei der Bundeswehr als Soldat tätig. Ihrer Karriere hat das Outing nicht geschadet. Seit Oktober 2017 leitet Anastasia Biefang das Informationstechnikbataillon als Kommandeurin. Über 700 Soldaten und Soldatinnen hören auf ihr Kommando. Sie hat Glück, ihr damaliger Vorgesetzter zeigt viel Verständnis für ihre Situation und unterstützt sie. Privat ist es schwieriger: Ihre Ehe geht in die Brüche. Doch Anastasia Biefang verfolgt ihren Weg weiter. Sie lässt ihr äußeres Geschlecht ihrem gefühlten inneren Geschlecht angleichen und findet auch eine neue Partnerin. Mit Samanta ist es Liebe auf den ersten Blick. Sie steht ihr während der gesamten medizinischen Eingriffe eng zur Seite. Auch ihre Eltern, die nun plötzlich eine Tochter statt eines Sohnes haben, unterstützen sie. Die Soldaten und Mitarbeiter des Bataillons sind hingegen erstmal skeptisch: „Die Vorurteile waren eben ’Ach – jetzt kriegen wir hier so eine Transe. Was soll denn das werden und das für unserer Bataillon, uns trauen sie ja viel zu, dann haben wir ja bald die Regenbogenflagge dran“, so ihre künftige Sekretärin. Auch Anastasia Biefang ist nervös, ob sie in dieser Männerwelt als Transgender-Frau und Vorgesetzte akzeptiert wird. Die ersten Wochen sind ein gegenseitiges Abtasten und dann kommt auch schon die nächste Herausforderung: Afghanistan. Menschen hautnah begleitet Anastasia Biefang von ihrem Dienstantritt als Kommandeurin eines Bataillons bis zur Abreise in einen Auslandseinsatz nach Afghanistan. Autor Thomas Ladenburger geht dabei der Frage nach, ob Anastasia Biefang sich als Kommandeurin durchsetzt und Anerkennung findet und wie die Soldat*innen mit ihr umgehen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 02.05.2019 WDR Meine Liebe aus Kerala – Hochzeit mit Hindernissen
Folge 15 (45 Min.)Maria aus Weingarten am Bodensee und Gabriel aus Kerala in Indien lernen sich auf einer Studentenparty kennen und werden ein Paar. Nach acht Jahren Fernbeziehung über 7400 Kilometer wollen die beiden heiraten. Doch Gabriels Eltern sind entsetzt. Eine Heirat aus Liebe ist in Indien die Ausnahme. Noch immer werden 90 Prozent der Ehen von den Eltern arrangiert. Der Traum vom gemeinsamen Leben in Deutschland ist mit immer neuen Problemen verbunden. Die deutschen Behörden verweigern Gabriel das notwendige Ehevisum. Sie verlangen Urkunden und Zeugnisse, die man in Indien nicht kennt, und werfen die Hochzeitspläne über den Haufen. Ein Jahr später als erhofft kann Gabriel endlich nach Deutschland einreisen. Aber auch dann läuft für die beiden nicht alles glatt. Gabriel findet keinen Job in Oberschwaben und ist in vielem von Maria abhängig. Die neue Rollenverteilung wird zur Herausforderung für das Paar. (Text: WDR)Deutsche TV-Premiere Do. 09.05.2019 WDR Das will ich dir noch sagen – Wenn junge Eltern sterben
Folge 16Als Andrea Bizzotto erfährt, dass er eine unheilbare Krebserkrankung hat, ist seine Frau Maria gerade im fünften Monat schwanger. Heute ist ihre gemeinsame Tochter Giulia zwei Jahre alt, doch der 33-Jährige wird nicht miterleben, wie sie aufwächst. Andrea will Giulia etwas Bleibendes hinterlassen und tippt im Krankenbett seine Lebensgeschichte ins Handy. Kapitel für Kapitel entsteht seine Autobiografie. „Ich hoffe, dass Giulia eines Tages dieses Buch in den Händen hat. Damit sie weiß, wer ich war.“ Auch Gabi und ihr Mann tun alles, damit die vierjährige Tochter Lena eine möglichst unbeschwerte Kindheit hat.Als Gabi mit 38 Jahren Brustkrebs bekommt, ist Lena noch ein Baby. Durch Zufall stößt sie auf das Hörbuch-Projekt von Judith Grümmer, eine Radiojournalistin, die für schwer erkrankte junge Eltern Audio-Biografien herstellt. „Das Hörbuch sagt auch viel über meinen Charakter aus, und bringt ihr näher, wer ihre Mama war“, hofft Gabi. „Wenn ich nicht mehr da bin, gibt es niemanden, der Lena diese Geschichten über mich erzählen kann.“ Der Film begleitet schwer kranke Eltern dabei, wie sie um ein „gutes“ Lebensende ringen. Wie sie ein Vermächtnis vorbereiten, mit dem sich ihre jetzt noch kleinen Kinder später an sie erinnern können. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 06.06.2019 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail