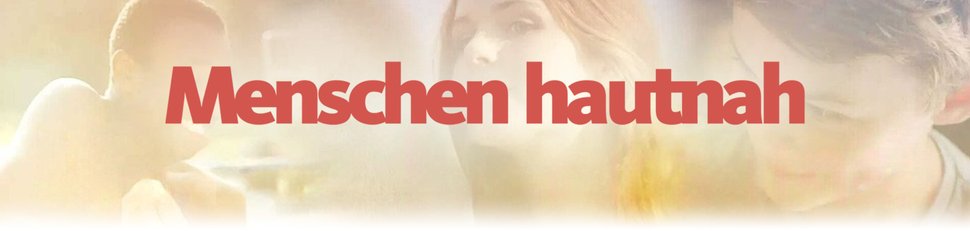2019, Folge 17–32
Mama, ich lass’ Dich nicht im Stich – Wenn Kinder die Eltern pflegen
Folge 17Michelle ist 20 Jahre jung und hat ihr Abitur gemacht. Auf Ausgehen und Freunde treffen musste sie oft verzichten. Denn seit 10 Jahren kümmert sie sich rund um die Uhr um ihre Mutter, seit diese an Lungenkrebs erkrankt ist. Michelle kocht, wäscht und hilft der Mutter beim An- und Ausziehen. „Ich bin schon manchmal traurig und denke an meine Freunde, die nicht so viel zu tun haben. Aber ich will ja die Mama nicht im Stich lassen“. Dass die Pflege der Eltern das eigene Leben total verändert, hat auch Julika erlebt. Julika war zwei, als ihre Mutter an multipler Sklerose erkrankte. Schon als kleines Mädchen musste sie sich um sie kümmern, da ihr Vater arbeitete. Mit sieben hievte sie die Mutter in den Rollstuhl, half ihr beim Anziehen und wechselte die Urinbeutel.„Das war nicht schön, besonders für ein Kind. Ich fühlte mich so dreckig.“ Die ständige Sorge um die Mutter hinterließ bei der heute 37-jährigen Julika tiefe Wunden. Wie Michelle und Julika pflegen rund 480.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland ihre Angehörigen. Wie die Studie der Universität Witten/Herdecke ergab, betrifft das vor allem Kinder, bei denen durch Trennung oder Arbeit nur ein Elternteil zuhause ist. Der Film zeigt den Balanceakt von Michelle und Julika zwischen Alltag und Pflege, dem Wunsch, ein selbständiges Leben zu führen und der ständigen Sorge, die Mutter im Stich zu lassen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.06.2019 WDR Unter Nackten – Tantra und die Suche nach Veränderung
Folge 18 (45 Min.)Vor Wildfremden nackt dastehen, die letzten Hüllen fallen lassen – das wird für die meisten Tantraneulinge eine große Hürde sein. Für Gudrun aus Hamburg, die nach einer Brustamputation und Gebärmutterentfernung auf der Suche nach ihrer Weiblichkeit ist. Für den Finanzberater Peter aus Köln, der mit seiner Freundin schon Tantra-Berührungsabende durchgeführt hat, aber eben nur zu zweit. Und für Michael und Ellen aus Schleiden. 60 Jahre alt, seit zwei Jahren ein Paar und nach dem Zusammenziehen nun in der ersten Krise. „Wir hoffen, dass wir uns durch Tantra wieder näherkommen“, erzählen die Beiden vor dem Seminar.Es sind völlig normale Menschen, die sich beim Tantra-Seminar einer Kölner Anbieterin angemeldet haben. Viele verbinden Tantra zunächst mit Gruppensex, Superorgasmus oder einer esoterischen Art von Prostitution. „Genau diese Vorurteile hatte ich, als ich zu einer ersten Tantra-Massage gegangen bin“, erzählt Visagistin Gudrun, „doch danach hat sich bei mir etwas Neues geöffnet.“ Sie wollte mehr über Tantra erfahren und entdeckte eine jahrtausendealte, indische Entspannungslehre, die sexuelle Energie als göttliche Lebenskraft betrachtet und Liebe als Basis des Lebens. Das Motto: Lernt euren Körper ganz neu kennen und lieben, indem andere Menschen ihn wertschätzen. Keine Häme, keine komischen Blicke, sondern gegenseitige Berührungen und Streicheleinheiten auch an erogenen Zonen. Das Ziel: Zufriedenheit und neue Leichtigkeit. Mehrere Tage lang tauchen die Teilnehmer immer tiefer in die tantrische Begegnung ein. Zuerst nur mit den Augen, dann vorsichtig mit den Händen bis zum Höhepunkt am letzten Tag: Die gegenseitige Massage im Genitalbereich. „Ich fühle mich irgendwie unter Erfolgsdruck“, meint Peter, dessen Partnerin Anjali schon viel mehr Erfahrung hat als er. „Ich dachte, ich berühre Frauen richtig, aber nun bin ich mir nicht mehr so sicher.“ Gudrun scheint von Tag zu Tag glücklicher zu werden. Ganz im Gegensatz zu Michael und Ellen, die so optimistisch in den Workshop starten und dann ein einziges Gefühlskarussell durchleben. Kann Tantra helfen, dem Alltagstrott etwas entgegenzusetzen, kranken Menschen ein neues Körpergefühl zu geben oder ein Paar wieder zu vereinen? Werden die Teilnehmer mit neuer Leichtigkeit oder mit neuen Problemen in ihren Alltag zurückkehren? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 11.07.2019 WDR Vom Glück, ein Huhn zu retten
Folge 19 (45 Min.)Hanne Mattersberger liebt Hühner. Ihr kleiner Bauernhof bei Reichshof in Nordrhein-Westfalen ist ein Hühnerparadies, in dem der schöne Hahn George mit einer Schar von fast zwanzig Hennen ein glückliches Leben führt: den ganzen Tag picken, scharren, im Staub baden, in der Sonne liegen. Und ab und zu mal ein Ei. Für Hanne Mattersberger ist das Frieden, Trost und heile Welt. Doch nicht alle ihre Hühner hatten von Anfang an ein schönes Leben. Einige waren einst Legehennen aus der Massentierhaltung, aus Eierfabriken. Sie wurden, wie Tausende ihrer „Schwestern“ von dem Verein „Rettet das Huhn“ vor dem Schlachthof bewahrt und mit Einverständnis der Eierproduzenten an private Hühnerhalter wie Hanne Mattersberger vermittelt, die den Tieren ein neues Leben in artgerechter Haltung ermöglichen.Es sind Hühner, die nie Licht, Gras, Wind oder Körner erlebt haben. Die oft ausgelaugt sind, kaum noch Federn haben, wenn sie die Legebetriebe verlassen. Sie existieren nur zu einem Zweck: möglichst viele Eier zu produzieren. Mit durchschnittlich18 Monaten werden sie dann als Abfall der Legeindustrie im Schlachthof für wenige Cent pro Huhn entsorgt und vorwiegend zu Tierfutter, Brühwürfeln oder billigen Fleischprodukten verarbeitet. Jährlich werden so allein in Deutschland über 51 Millionen Hühner aus Boden-, Freiland-, und auch Biohaltungs-Betrieben getötet und durch junge Hennen ersetzt. In dem Film begleitet „Menschen hautnah“-Autorin Annette Zinkant mehrere Hühnerhalter wie Hanne Mattersberger und auch Robert Becker vom Verein „Rettet das Huhn“ bei einer sogenannten „Aus-Stallung“: 1.200 Hühner aus einem Legebetrieb werden in ein neues Zuhause gebracht. Für manche Hühnerhalter ist der Zustand ihrer Schützlinge ein Schock. „Wenn meine Hühner so aussehen würden wie diese Legehennen, dann hätte ich morgen das Veterinäramt hier und im Dorf würde keiner mehr mit mir reden“, sagt Hanne Mattersberger. „Aber in der Lebensmittelindustrie ist das legal!“ Für die ausgedienten Legehennen soll jetzt alles gut werden. Hühnerställe werden möglichst komfortabel eingerichtet und Hühnerpullover liegen bereit. Die Hühner sollen sich erholen und wenn alles gut geht, dann werden diese Eier-Arbeiterinnen nach einem Sommer schöne, glückliche Hennen sein. So wie auf den Eierpackungen der Supermärkte. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.07.2019 WDR Klassentreffen – 25 Jahre nach dem Abitur
Folge 20 (30 Min.)Bernd kommt aus New Hampshire, Jessika aus Wien und Philipp von der Ostsee angereist. Seit Jahren haben sie sich nicht gesehen. Jetzt treffen sie sich in Castrop-Rauxel – zum Klassentreffen. Vor 25 Jahren haben sie dort Abitur gemacht. Jörn und David haben monatelang recherchiert und organisiert, um das Jubiläumstreffen auf die Beine zu stellen. Gemeinsam wollen sie mit den alten Mitschülern in Erinnerungen schwelgen, die Geschichten von damals wieder aufwärmen. Vielleicht die erste Liebe wiedertreffen? Im Juni 1994 haben sie alle am Adalbert-Stifter-Gymnasium in Castrop-Rauxel 85 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur gemacht.Einige sind in der Stadt geblieben, bei anderen verliert sich die Spur. Mindestens 50 Ehemalige sollen kommen. Philipp, inzwischen Marineoffizier, lebt mit seiner Familie an der Ostsee und hat bereits zugesagt, denn für ihn ist heute klar: „Das war eine der schönsten Zeiten meines Lebens, ich hab zu der Zeit richtige gute Freunde gehabt, die ich heute noch habe und ich hab damals meine Frau kennengelernt.“ Er und die anderen wollen erfahren, was aus den Mitschülern von einst geworden ist. Aber auch noch einmal in die Vergangenheit einzutauchen. Studium, Beruf, Familie, aber auch geplatzte Träume oder gescheiterte Ehen – wie haben sich die ehemaligen Mitschüler verändert? Die Organisatoren Jörn und David erhoffen sich von dem Revival, dass die alte Vertrautheit schnell wieder da ist. Sie wollen das Gemeinschaftsgefühl und die Unbeschwertheit von damals wieder wecken. Es soll eine tolle Wiedersehensparty werden, bei der es nicht um „mein Haus, mein Auto, mein Boot und mein Pferd“ geht. Ob das funktionieren wird? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 01.08.2019 WDR Erst mal Abi – Und dann?
Folge 21An Paulines Zimmertür hängt ein riesiger Kalender mit Feldern zum Durchstreichen. Noch 24 Tage, bis es richtig ernst wird, dann steht für ihre Freundin Emilia und sie die erste Abitur-Klausur in Mathe an. Der Countdown läuft – und der Druck steigt, denn die Abinote ist das Ticket in ihre Zukunft. An die Zeit rund ums Abitur kann sich jeder erinnern, der es mal gemacht hat, egal wie alt er ist. Die Schulzeit ist zu Ende, das Erwachsensein fängt an. Eine Zeit voller Hoffnungen, Fragezeichen und banger Erwartungen. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle: erst die Prüfungen und die damit verbundenen Versagensängste, dann das unbeschreibliche Gefühl von Freiheit – endlich keine Schule mehr, endlich fängt die Zukunft an.Aber auch die Frage: Was will ich im Leben? Pauline ist klar: Sie möchte eine 1 vor dem Komma haben. Mit ihren Leistungskursen Mathe und Physik will sie später auf jeden Fall studieren. „Maschinenbau finde ich interessant, ich möchte ein bisschen in Männerberufe reinschnuppern, zeigen, dass Frauen das auch können.“ Für ihre Freundin Emilia sieht das anders aus. Sie möchte unbedingt Hebamme werden, hat sich schon vor ein paar Wochen in Mainz um einen Ausbildungsplatz beworben. „Ich werde immer gefragt: Abi – und was studierst du dann? Und wenn ich sage: gar nichts, ich mach’ eine Ausbildung, dann ist die Antwort – ahh, OK. Ich höre dann schon, dass sie denken, der Schnitt war nicht gut genug. Aber ich möchte Hebamme werden und mir ist egal, was die anderen denken.“ Für Emilia und Pauline wird es der letzte gemeinsame Sommer sein. „Menschen hautnah“-Autorin Susanne Böhm folgt den beiden bei ihrem Aufbruch in ihr neues Leben. Und lernt dabei junge Menschen kennen, die sich nicht nur Gedanken um ihre Noten machen, sondern auch eine ganze Menge über den Zustand der Welt nachdenken. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 08.08.2019 WDR Zwangsgeräumt – Eine Familie kämpft um ihr Zuhause
Folge 22 (45 Min.)Knapp 400 Quadratmeter groß, vier Etagen, Fliesen aus Italien: 1990 ließen sich Gabriela und Martin in Königswinter ihr Traumhaus bauen. „Jedes Fenster eine Maßanfertigung“, schwärmt Gabriela noch heute. Das teure Haus konnten sie sich damals leisten. Die Geschäfte liefen gut. Über ihren Buchvertrieb belieferten sie Buchhandlungen mit Schachliteratur. Das Paar lebte mit den beiden Töchtern auf den oberen drei Etagen des Hauses. Unten, im Bürobereich, arbeiteten sie – erfolgreich, bis das Internet kam. Bücher wurden inzwischen online gekauft, ihr Geschäft geriet in eine Krise. Der Umsatz ihrer Firma sank schließlich gegen null und die Ratenzahlungen für ihr Haus wurden zum Problem.Schließlich leitete ihre Bank die Zwangsversteigerung ein. Für weniger als 300.000 Euro wurde das Haus schließlich versteigert. Das Ergebnis ist für die Eheleute eine Katastrophe. „Ich werde den Tag nie vergessen. Ich saß bei der Versteigerung und konnte gar nicht begreifen, was dort passierte“, sagt Martin. „Der Ausgang der Zwangsversteigerung ist für uns dramatisch und unerklärlich. Für ein Haus wie unseres hätte man mindestens das Doppelte bekommen müssen“, so Gabriela. Jetzt sucht das Paar Gründe für das schlechte Ergebnis und Schuldige. Ihrer Meinung nach haben zwei angesetzte Versteigerungstermine und ein falsches Gutachten zu diesem für sie existenzvernichtenden Ergebnis geführt. Deswegen weigern sie sich aus dem Haus auszuziehen und wollen, dass ihr Zwangsversteigerungsverfahren überprüft und neu aufgerollt wird. „Unsere Akte beim Amtsgericht umfasst inzwischen über 1.000 Seiten. Ich werde nicht aufhören, für unser Recht zu kämpfen“, so Martin. Einen Zwangsräumungstermin konnten die Eheleute schon abwenden, aber der nächste Räumungstermin rückt immer näher. „Menschen hautnah“-Autorin Nathalie Suthor hat das Paar in den letzten Wochen vor der Zwangsräumung begleitet: Werden die Eheleute in ihrem Zuhause bleiben können? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 12.09.2019 WDR Der Traum vom Bio-Bauernhof – zwischen Idylle und Knochenjob
Folge 23 (45 Min.)„Ich bin da ganz schön naiv ran gegangen“, erzählt Anja (38). Gemeinsam mit ihrem Mann Frank (35) zieht sie aufs Land. Schafe wollen sie halten, natürlich Bio und eine Frischkäserei gründen. Voller Elan stürzen sie sich in das Abenteuer. Drei Jahre später haben sie eine kleine Käserei aufgebaut, aber ihr Traum gemeinsam mit ihren drei Kindern ein zufriedenes Leben in der Natur zu führen, wird trotzdem zur ständigen Herausforderung. Die Arbeit frisst sie auf, Zeit für das Familienleben ist selten. Dem jungen Paar geht langsam die Kraft aus und ihre Liebe wird auf die Probe gestellt.„Mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich das so nicht noch einmal machen“, sagt Lukas (30). Schon während seiner Ausbildung zum Bio-Landwirt pachtet er einen alten Hof. Er will es mit der Bio-Haltung von Kühen und Hühnern schaffen. Auch seine Frau Miriam (31) möchte, dass Tochter Helene in der Natur groß wird, will aber auch ihr Studium zu Ende bringen. „Das ist für mich total wichtig. Ich will nicht nur die Frau an seiner Seite sein.“ Drei Jahre später fehlt Lukas trotz harter Arbeit und vieler neuer Ideen immer noch aus-reichend Kundschaft. Miriam ist mit dem zweiten Kind schwanger, ihr Studium hat sie unterbrochen. Der Traum vom Leben auf dem Bio-Bauernhof wird zur Belastungsprobe. „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, weil sonst steh’ ich bald ohne Frau und Kinder da.“ „Menschen hautnah“ begleitet die zwei Familien während der Gründungsphase ihrer kleinen Bio-Bauernhöfe. Und besucht sie drei Jahre später noch einmal: Halten sie durch oder platzt ihr Traum? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 19.09.2019 WDR Das Verlangen bleibt – Liebe, Sex und Krebs
Folge 24Angela ist alleinerziehend und sehnt sich nach Nähe, Geborgenheit, Verlangen. Doch seit ihrer Brustkrebserkrankung und mehreren Operationen fühlt sie sich verletzt. Eine Brust musste amputiert werden, mit einer plastischen OP wurde an ihrer Stelle aus Bauchfett eine Brust nachgebildet. Ohne Brustwarze und ohne das dazugehörige Empfinden. Jetzt hat sie Narben am Bauch und an der Brust, sieht ihren Körper als Feind und traut sich nicht mehr, Männer an sich heran zu lassen. Doch die Sehnsucht nach körperlicher Nähe wird immer größer.Sie meldet sich für eine Datingreise an. Aber falls sie auf der Reise einen Mann kennen lernt, mit dem sie sich mehr vorstellen kann: Wie und wann soll sie ihm sagen, dass sie todkrank ist und vernarbt? Und wird sie einen finden, der trotzdem bei ihr bleiben will? Wie ihr geht es vielen Menschen, die schwer oder tödlich erkrankt sind und deshalb mit einem veränderten Körper leben müssen. Ihr Bedürfnis nach Sexualität wird in der Gesellschaft meistens ausgeblendet. Dabei sehnen sie sich wie jeder andere danach, sich weiterhin gewollt und attraktiv zu fühlen. Christian war bis zu seinem 47. Lebensjahr ein Womanizer. Frauen charmant für sich zu gewinnen und auch ins Bett zu kriegen, war kein Problem. Es ist seine Art, Nähe herzustellen und Beziehungen zu knüpfen. Sex ist für ihn immer sehr wichtig. Doch dann wird Prostatakrebs bei ihm festgestellt, er muss operiert werden und ist damit für den Rest seines Lebens impotent. Ab jetzt ist alles anders und nichts mehr selbstverständlich. Spätestens wenn er mit einer Frau im Bett landet, entsteht eine peinliche Situation. Christian ist verzweifelt. Der Mann, der er mal war, den wird es nicht mehr geben. Doch ohne Sex will er nicht leben – wie findet er einen Ausweg? Und eine Frau, die damit umgehen kann und trotz Impotenz bei ihm bleibt? Die 31-jährige Kathrin lebt in einer festen Beziehung, als sie die Diagnose Brustkrebs erhält. Kathrin werden beide Brüste amputiert und nur eine wieder aufgebaut. Auch sie muss mit den Narben und dem Missempfinden leben. Dazu kommt noch eine Antihormontherapie, die ihr Lustempfinden ausbremst. Ihr Freund steht an ihrer Seite – doch auch bei den beiden ist jetzt nichts mehr selbstverständlich. Was können sie tun, um Sex und Nähe aufrechtzuerhalten? Menschen hautnah hat Angela, Christian und Kathrin sechs Monate lang begleitet. Werden sie trotz unheilbarer Krankheit und tief greifender körperlicher Veränderung wieder einen Weg zu einem glücklichen Liebesleben finden? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 26.09.2019 WDR Später Vater, glücklicher Vater?
Folge 25Später Vater, glücklicher Vater? Wie ist das, wenn man sich nach einem erfolgreichen Berufsleben im Ruhestand noch den Wunsch nach einem Kind erfüllt? Radikale Selbstverwirklichung oder eine große Verantwortung in einer Lebensphase, in der andere nach Ruhe suchen? Wie ist er, der späte Vater: überfordert oder ganz besonders zugewandt? Und wie ist der Blick der deutlich jüngeren Frau und des Kindes auf den Partner und Vater im Rentenalter? 75 Jahre liegen zwischen der einjährigen Lauren und ihrem Vater Bernhard. Der hat die ganze Welt gesehen, frönte ausgefallenen Hobbys und lebte die meiste Zeit allein.Ein Kind war nie sein Plan, bis er in Afrika die Frau traf, für die er sein Leben radikal auf den Kopf stellte. Wie ist das, wenn man sich mit Mitte 70 auf ein schreiendes Kleinkind einstellen muss, das gerade Zähne bekommt? Jetzt trägt Bernhard plötzlich für eine Kleinfamilie die volle Verantwortung. Wie geht es ihm damit? Sind das zu viele Aufgaben und Verpflichtungen für einen 76-Jährigen? Roland war 66, als seine Tochter Wilma auf die Welt kam. Er und seine Freundin Elena kannten sich da noch nicht allzu lange. Von einem Kind war in ihrer Beziehung nie die Rede gewesen. Wilma war nicht geplant. Jetzt ist sie da und wird heiß geliebt. Aber das „Entspannt-in-den-Tag-hineinleben“ geht zu Ende. Der Musiker Roland geht mit seiner Band wieder auf Tournee und Elena beginnt ein Studium in einer anderen Stadt. Wie kriegen sie das hin? Konzerte, Studium, das aufreibende Leben mit einem Kleinkind, der eine 67, die andere Ende 20. Auch Lisa, Petra und Gary stehen vor großen Aufgaben: Erst vor wenigen Jahren hat die Familie im Westerwald einen Reiterhof gekauft. Der wird jetzt renoviert. Alle packen mit an: die 17-jährige Lisa, ihre Mutter Petra und Gary. Der passionierte Westernreiter ist schon 82 und steht immer noch mitten im Leben: Stallarbeit, Reitstunden. Als Lisa auf die Welt kam, war er 64. Gary zeigt Lisa, wie man Traktor fährt und Koppeln anlegt. Das ist ihm wichtig. Denn es könnte ja sein, dass sie und ihre Mutter schon in ein paar Jahren allein die Verantwortung übernehmen müssen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 10.10.2019 WDR ursprünglich für den 06.06., dann für den 05.09.2019 angekündigtHirschhausen im Knast
Folge 26Was bedeutet es, entscheidende Jahre des Lebens hinter Gittern zu verbringen? Wie können Beziehungen aufrechterhalten werden, wenn die Freiheit fehlt? Eckart von Hirschhausen möchte herausfinden, was Männern wichtig ist, die lange in Haft sind. Er bezieht für zwei Tage eine Zelle in der Justizvollzugsanstalt Meppen und unterwirft sich den Gefängnisregeln: „Innerhalb weniger Momente verschwindet mein bisheriges Leben in einer kleinen Kiste und einem Kleidersack. Am Dresscode merkt man: Mit der Welt da draußen habe ich ab jetzt nichts mehr zu tun.“ Er trifft Menschen, die in Jahrzehnten denken. Rainer, Chef der Gefängnisküche, ist 65 und hat bald 30 Jahre Knast hinter sich, aufgeteilt in verschiedene Haftstrafen.Er hat elf Kinder und Jutta, seine Frau, die ihn jede Woche besucht. Vier Stunden Eheleben pro Monat – Eckart von Hirschhausen erfährt, wie viel Entbehrung dies bedeutet. Oft sind es die Angestellten des Gefängnisses, die zu Vertrauenspersonen werden – so wie die JVA-Beamtin Sonny. Oder es sind die Angebote der Gefängnisseelsorge, die emotionale Stütze gegen die Einsamkeit bieten. Im von Insassen gestalteten Gefängnisgarten erzählen die Gefängnispastoren, warum ein Vater-Kind-Tag unter freiem Himmel ein Segen ist – nicht nur für diejenigen, die hinter Gittern leben. Von den Menschen getrennt zu sein, die einem am Herzen liegen – es ist genau das, was viele der Inhaftierten als ihre größte Herausforderung und Strafe empfinden. Und es ist gleichzeitig die größte Motivation, das eigene Leben zu ändern, Reue zu empfinden und einen Neustart zu versuchen. So geht es Florian, der Eckart von Hirschhausen auf seine Zelle einlädt und ihm erzählt, dass er seine Tochter bisher nur auf Fotos gesehen hat. Oder Michael, der die Bibliothek im Gefängnis verwaltet. Er hat erst kürzlich im Gefängnis geheiratet und ist froh, dass im Langzeitbesuchsraum ein wenig Rückzug und Intimität möglich ist. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 17.10.2019 WDR Hirschhausen im Hospiz
Folge 27Was wird wichtig, wenn man nur noch wenige Tage zu leben hat, wenn einem die eigene Endlichkeit bewusst wird? In einer sehr persönlichen Reportage sucht Eckart von Hirschhausen im Bochumer Hospiz St. Hildegard nach Antworten. Er spricht mit Menschen, die hier ihre letzten Tage verbringen, er trauert mit Angehörigen, wenn sie Abschied nehmen müssen. Zwei Tage lebt der Arzt und Wissenschaftsjournalist unter den elf Bewohnern der ehemaligen Industriellenvilla. Beim Frühstücksdienst trifft er Zita, die mit Humor ihrem na-hen Ende entgegenblickt.Er begleitet Rosita und ihre Familie beim schmerzvollen Einzug ins Hospiz und wacht mit Edeltraut am Bett ihres Mannes. Er lernt eine Welt kennen, in der der Tod allgegenwärtig ist – und die doch voller Leben steckt. „Leben bis zum Schluss“, so beschreiben es ihm viele im Haus. Statt Intensivmedizin gibt es auf den Gängen Musikkonzerte, in den Zimmern Hundebesuche, im großen Garten Feste. Und eine Trauergruppe trifft sich bei Waffeln und Kuchen zum lockeren Austausch. Bei seinen Gesprächen mit Pflegenden, Ärzten und Ehrenamtlichen stellt Hirschhausen fest: „Ausgerechnet die Menschen, die durch ihre Arbeit jeden Tag mit dem Tod in Kontakt sind, haben am wenigsten Angst vor ihm. Das hat mich menschlich auf eine tiefe Art beeindruckt und versöhnt.“ Die Palliativärztin Dr. Bettina Claßen erzählt ihm von ihrer Beobachtung, dass die meisten mit einem Lächeln auf dem Gesicht sterben: „Das ist kein reiner Muskelreflex. Ich glaube, dass Tod am Ende eine ganz gute Sache ist.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 24.10.2019 WDR Der lange Weg aus dem Koma – Johannes und Stefan finden zurück ins Leben
Folge 28„Auf einmal ist gar nichts mehr wie es mal war“- diese Erfahrung macht Heike, als ihr Lebensgefährte Stefan nach einem Motorradunfall ins Wachkoma fällt. Der Mann, den sie liebt und der sie ständig zum Lachen brachte, ist bewusstlos, obwohl er die Augen geöffnet hat. Bewegungsunfähig sitzt er in einem Rollstuhl und muss künstlich ernährt werden. Auch Johannes hat einen Unfall, als er gerade 18 Jahre alt ist. Er steht zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Abitur und will Arzt oder Pilot werden. Nun erhält er die Diagnose Wachkoma. „Die Prognose war eine Katastrophe“, sagt Johannes Mutter, die Johannes täglich mit dem Vater in der Klinik besucht.Johannes und Stefan teilen ein ähnliches Schicksal. Ihre Chance, je wieder zurück ins Leben zu finden, sei gering, prognostizieren die Ärzte anfangs. Ein Kamerateam hat die beiden Familien über fünf Jahre begleitet und dokumentiert, wie die Diagnose Wachkoma das Leben für Betroffene und Angehörige verändert. Stefan erlangt schließlich das Bewusstsein zurück und macht winzige Fortschritte. Doch Heike ahnt, dass er ein Pflegefall bleiben wird. Und dass Johannes es schafft, sein Schicksal zu akzeptieren und wieder ein fast normales Leben zu führen, hätte nach dem Unfall niemand zu hoffen gewagt. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 07.11.2019 WDR Wenn Menschen Puppen lieben
Folge 29 (45 Min.)Vorsichtig hievt Michael seine Sina in seinen selbstgebauten Fahrradanhänger. Sina ist aus Silikon, 1,65 Meter groß, knapp 35 Kilo schwer. Eine Puppe. Michael will den Nachmittag mit Sina an einem See verbringen. „Ich wäre gern viel öfter draußen mit ihr“, sagt der 49-Jährige. Zärtlich streicht er Sina eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sein Leben lang hat Michael davon geträumt, seine Traumfrau zu finden. Doch er ist schüchtern. Schon als Jugendlicher ist er ein Einzelgänger, seine Beziehungen sind nie von Dauer. Durch einen Fernsehbericht stößt Michael auf sogenannte „Real Dolls“: Puppen aus Silikon, lebendigen Frauen täuschend echt nachgebildet.Michael ist sofort fasziniert. Er nimmt einen Kredit auf und kauft sich seine erste Liebespuppe – für 3.600 Euro. Mittlerweile lebt er mit sieben Puppen zusammen. „Na, mein kleiner Levi-Schatz! Jetzt wollen wir dich mal umziehen!“ Behutsam hebt Maria ihre Babypuppe aus der Wiege und streicht ihm liebevoll über das Köpfchen. Dann legt sie den Kleinen auf dem Wickeltisch ab und zieht ihm vorsichtig einen neuen Strampler an. Maria ist 40 Jahre alt und „Mutter“ von zwölf „Reborn-Babys“, lebensecht aussehende Babypuppen aus Vinyl und Silikon. Vor sieben Jahren stieß sie auf die Babys, weil sie einen Schicksalsschlag verarbeiten musste – bei ihnen fand sie Trost, Ruhe und Geborgenheit. Maria ist eine resolute, entschlossene Frau. Sie steht zu ihren Puppen. Das war nicht immer so: „Ich lebe in einem Dorf am Niederrhein. Man ist sofort im Gespräch, wenn man nicht in die Norm passt.“ Zwar akzeptieren Marias Mann und ihre Kinder ihre Leidenschaft. Doch ins Dorf traut sich Maria mit ihrem Puppenwagen noch nicht. Die Doku taucht ein in die Lebens- und Gefühlswelt von Maria und Michael. Beide führen Beziehungen mit lebensechten Puppen – Maria als „Mama“ ihrer Reborn-Babys, Michael als „Partner“ von Silikonpuppen. Was bringt einen Menschen dazu, sich in Liebe und Zuneigung einer Puppe zuzuwenden? Können die Puppen ein Ersatz für echte Menschen sein? „Wenn Menschen Puppen lieben“ erzählt die Geschichte zweier Menschen mit einer Leidenschaft abseits der Norm. Hinter diesem besonderen „Hobby“ verbergen sich Gefühle, die jeder Mensch kennt: das Bedürfnis nach Nähe, Geborgenheit und bedingungsloser Liebe. Was Maria und Michael verbindet, ist ihr unkonventioneller Weg, mit diesen Bedürfnissen umzugehen – und ihr Mut, sich mit den Puppen in die Öffentlichkeit zu trauen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.11.2019 WDR Leonora – Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor
Folge 30„Dein eigenes Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein und findet das auch noch cool. Das zieht dir so den Boden unter den Füßen weg!“ Als Maik Messings Tochter Leonora im Jahr 2015 plötzlich verschwunden ist, ändert sich alles für den Vater aus Sachsen-Anhalt. Der Film ‚Leonora – Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor‘ erzählt mit einer außergewöhnlichen Nähe den verzweifelten Kampf eines Vaters um seine Tochter, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien angeschlossen hat. Vier Jahre lang weiß Maik Messing nicht, ob seine Tochter Leonora überleben wird.Vier Jahre begleiten Reporter den Vater – während er – der einfache Bäcker aus der Provinz – syrische Schleuser trifft, mit Terroristen verhandelt und gleichzeitig versucht, in Deutschland weiter ein normales Leben zu führen. Von der Radikalisierung seiner 15-jährigen Tochter hatte ihr Vater Maik nichts mitbekommen. Er wusste zwar, dass Leo sich für den Islam interessierte, nicht aber, dass sie bereits vor Monaten konvertiert war. Leo pflegte abgeschirmt ein virtuelles Islamisten-Leben im Internet, auf Facebook und in WhatsApp-Gruppen. „Islam war dann Trend, sag’ ich mal“ erzählt Leonora später den Reportern, „man hat gemerkt, in Deutschland und Großbritannien konvertieren viele zum Islam. Und dann bin ich in eine Facebook-Gruppe reingeraten“. Im analogen Leben las sie im Pflegeheim Seniorinnen und Senioren vor, war Klassensprecherin, hatte einen YouTube-Kanal mit Beauty-Tipps und tanzte als Funkenmariechen im knappen Röckchen auf der Fastnachtssitzung – eine Vorzeigetochter, die sich vor dem Gang in den Hühnerstall fürchtete, weil es dort Mäuse geben könnte. Vor dem Leben im Terrorstaat hatte sie keine Angst. Nach ihrer Flucht aus Deutschland heiratet Leo den hochrangigen deutschen IS-Terroristen Martin Lemke, der beim IS-Geheimdienst Karriere macht. Über ihn wird ein anderer Rückkehrer später sagen: „Er foltert nicht selbst – er lässt foltern.“ Leos Vater versucht ab 2015 alles, um seine Tochter zurück nach Deutschland zu holen: „Das ist absolute Lebensgefahr. Das ist uns vollkommen klar“. Die Rettungsversuche sind schwierig, weil der IS nicht nur die Stadt Rakka, sondern jeden Einzelnen unter Kontrolle hat. Die psychische Anspannung und Belastung führen Maik Messing zwischendurch an den Rand des Selbstmordes: „Du bist gedanklich auf der Leiter und da ist der Strick. Du schaffst das nicht. Und du bist dann einfach an einem Punkt, wo du dir sagst: Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus.“ Als Drittfrau des IS-Terroristen Lemke lebt Leonora im Zentrum der IS-Hauptstadt Rakka. Sie meldet sich regelmäßig in Audio-Nachrichten und Chats bei ihrer Familie in Deutschland und berichtet aus dem Alltag im selbsternannten Kalifat. „Hallo Papa, ich versuche euch jetzt ein Sprachmemo zu schicken. Und ja, also mir geht es sehr, sehr gut. Wir haben hier eine große Wohnung, sehr groß“. Das ändert sich. „Gestern war so schrecklich und richtig viele Bomben. Über 12 Stück. Hatte so noch nie Angst und habe mich nur noch an der Matratze festgekrallt.“ So verbindet das Handy Tochter und Vater miteinander, und damit die beiden grundverschiedenen Welten: hier die deutsche Provinz, dort das Kriegsgebiet. Der Film wirft ein Licht auf das Innenleben des Islamischen Staates. Manchmal brutal, manchmal aus der blauäugig-verschobenen Perspektive der Teenagerin Leonora, die auch mal mitten im umkämpften Rakka Helene Fischer hört. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 21.11.2019 WDR Ich, ich, ich – Narzissmus und seine Opfer
Folge 31Sie sind meistens dominant, egomanisch, eitel, manipulativ und wenig empathiefähig: Narzissten. Donald Trump ist wohl der bekannteste unter ihnen und auch der neue britische Premier Boris Johnson wird in der Presse immer wieder als Narzisst bezeichnet. Narzissten begegnen uns im Alltag in Form von Politikern, Chefs, Kollegen, Partnern. Narzissmus kann auch krankhafte Züge annehmen: Der 35-jährige Leonard hat nach einem Test die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung erhalten und ist einer der ganz wenigen, die in die Öffentlichkeit gehen.Im Arbeitsleben hatte er jahrelang Schwierigkeiten, sich unterzuordnen. „Ich konnte keine Kritik annehmen, ich wusste immer alles besser“, sagt er. Immer wieder verlor er deshalb seinen Job. Auch seine Beziehungen zu Frauen sind problematisch. Erst als er Manuela trifft, glaubt er, dass nun alles anders werden könne. Er versucht, seine Wutausbrüche im Zaum zu halten, Probleme vernünftig zu diskutieren, aber er fällt immer wieder in die alten Muster. Leonard glaubt, auch seine Mutter sei Narzisstin. Deshalb empfindet er sich selbst als Opfer, hat ein Buch über seine Krankheit geschrieben und leitet heute mehrere Selbsthilfegruppen. Maria hat jahrelang unter narzisstischem Missbrauch gelitten, ohne das Muster dahinter zu erkennen, sagt sie. Vier verschiedene Beziehungen habe sie gehabt, in denen sie extrem gedemütigt worden sei. Als sie einem ihrer Partner akribisch nachweist, dass er sie regelmäßig betrogen hat, erklärt er sie für verrückt. Erst durch ihre Recherche im Internet lernt sie, dass dies eine typische Manipulationsmethode von Narzissten ist, die ihre Opfer schließlich an sich selber zweifeln lassen. Mit ihrem neuen Wissen befreit sich Maria schließlich. „Ich hab meine Grenzen nicht früh genug aufgezeigt“, sagt sie heute. Auch sie sieht viele Gründe dafür schon in ihrer Kindheit. Sie habe immer „Leistung bringen“ müssen und Gewalt erlebt. Inzwischen ist Maria vorsichtiger geworden. Ob sie nochmal eine enge Beziehung zu einem Mann eingehen und zu ihm ziehen würde, lässt sie offen, auch wenn es da jemanden gäbe. Der Psychotherapeut Eckhard Roediger sagt, er sehe insgesamt eine Zunahme narzisstischer Problematiken, weil immer mehr Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft die Bereitschaft zur Rücksichtnahme einschränke. Und: Menschen im Umfeld von pathologischen Narzissten bekämen viel zu wenig Unterstützung. „Menschen hautnah“ hat Leonard und Maria mehrere Monate begleitet und zeigt, was hinter der Diagnose „Narzisstische Persönlichkeitsstörung“ steht und wie schwierig der Umgang mit Narzissten ist. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 28.11.2019 WDR Vom Hartz-IV-Kind zum Elite-Studenten – Jeremias will es schaffen
Folge 32Hat ein Kind, das in Armut aufwächst, trotzdem eine Chance im Leben erfolgreich zu sein? Jeremias aus Kaiserslautern will es schaffen. Im Alter von elf Jahren trifft er eine Entscheidung, die sein Leben für immer verändert: er verlässt seine Familie. Die Eltern sind langzeitarbeitslos, das Geld ist immer knapp, die häusliche Situation schwierig. Jeremias will mehr vom Leben und sucht sich ein neues Zuhause. „Dieser Tag war rückblickend der Tiefpunkt meines Lebens, aber gleichzeitig auch ein Höhepunkt“, sagt Jeremias heute. Er lässt seinen Zwillingsbruder und seine Eltern zurück und kämpft sich seitdem alleine nach oben.Fünf Jahre lang lebt er in einem SOS-Kinderdorf bevor er es mit 16 Jahren als Stipendiat auf ein internationales College in Freiburg schafft, um dort sein Abitur zu machen. Dabei hatte man ihm in der Grundschule nicht mal das Gymnasium zugetraut. Wenn er auf sein altes Leben blickt, ist sich Jeremias sicher: „Kinder aus armen Verhältnissen haben in der Regel nicht dieselben Chancen wie andere, ich bin die absolute Ausnahme.“ Deshalb sieht er sich als Vorkämpfer für mehr Chancengleichheit und gegen Kinderarmut: „Man muss viel offener darüber sprechen, wie ausweglos die Lage für Millionen von Kindern in Hartz IV ist. Wer, wenn nicht ich, kann die Stimme für Kinder und Jugendliche sein, denen es so geht wie mir damals?“ Dieser Film erzählt die Geschichte vom Aufstieg des Hartz-IV-Jungen Jeremias zum Studenten einer Privat-Universität in den USA. Autor Hendrik Fritzler zeigt, wie der Junge sich in den Jahren verändert hat und was das mit der Beziehung zu seiner Familie gemacht hat. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 05.12.2019 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.