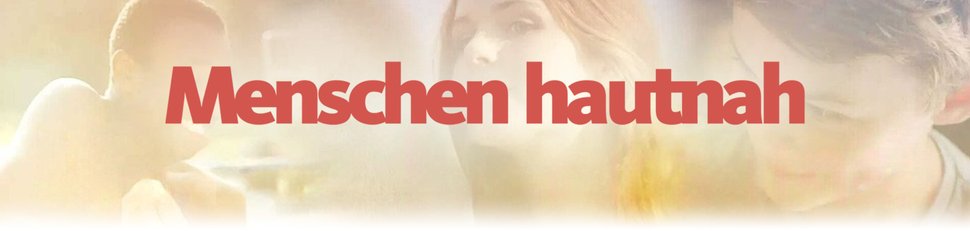2017, Folge 17–32
Klassenfahrt in den Terror – Deutsche Schüler ein Jahr nach dem Nizza-Anschlag
Folge 17Am 14.7.2016 rast ein Laster auf der Promenade des Anglais in Nizza in die feiernde Menschenmenge. Der Attentäter Mohamed Lahouaiej Bouhlel tötet binnen Minuten 86 Menschen. Darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule aus Berlin, die den französischen Nationalfeiertag mitfeierten wollten, direkt am Strand von Nizza. Weitere deutsche Jugendliche werden schwer verletzt. Eine wundervolle Klassenfahrt endet in einem Alptraum. Ein Jahr nach dem Anschlag von Nizza sprechen die überlebenden Jugendlichen und Lehrer bei Menschen hautnah über diese Nacht und ihre Folgen, erstmals im deutschen Fernsehen.Die Filmautoren Harriet Kloss und Markus Thöß sind selbst betroffen, denn ihre Tochter war bei der Klassenfahrt dabei und hat den Anschlag überlebt. Es sind Geschichten von Zufällen, die über Leben und Tod entscheiden, von Panik und Verzweiflung, aber auch von großer Anteilnahme und Unterstützung – auch durch die Anwohner in Nizza, die nach dem Anschlag den Jugendlichen Schutz und Hilfe bieten. Für die Berliner Schülerinnen und ihren Lehrer folgen in dieser Nacht lange Stunden des Bangens und Hoffens. Bis schließlich eine Ahnung zur furchtbaren Gewissheit wird. Zuhause in Berlin muss die Schulleitung verzweifelten Eltern und Angehörigen vom Tod ihrer Kinder und der Lehrerin berichten. Wie haben die Schülerinnen und Schüler, der überlebende Lehrer und die Angehörigen das Jahr danach erlebt, wie den Anschlag in Berlin, bei dem ebenfalls ein Attentäter einen LKW in eine Menschenmenge lenkte? Der Film begleitet sie, zeigt wie sie mit dem Trauma umgehen, jeder auf eine andere Art. „Die Angst ist da, sie ist überall“, sagt die Mutter einer der verletzten Schülerinnen. „Ich fühle mich in Berlin-Neukölln nicht mehr sicher“. Die Schülerinnen und Schüler stecken in diesen Wochen mitten in den Abiturprüfungen. Sie werden in Kürze einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Wie auch ihr Lehrer Fuad Z., der ab dem kommenden Schuljahr für drei Jahre an der deutschen Schule in Istanbul unterrichten wird. Zusammen mit seiner Kollegin Sylvia S., die bei dem Anschlag ums Leben kam, hat Fuad Z. die Klassenfahrt begleitet. „Ich selbst versuche jetzt die Schüler durch das Abitur zu bringen, alle. Das ist meine Aufgabe“, sagt der Lehrer. Wenn er alleine ist und die Bilder der Opfer sieht, die bei ihm Zuhause hängen, dann kommt die tiefe Traurigkeit zurück. „Das schlimmste war, als ich den Koffer von Sylvia packen musste“ erinnert er sich. Doch er will den Anschlag hinter sich lassen, irgendwie. Und wünscht sich für seine Zukunft: „Ich will nicht weiter wütend sein.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.07.2017 WDR Hochstapler und ihre Opfer
Folge 18Harald S. behandelte zwei Jahre lang 160 Patienten in drei florierenden Praxen. Einige Menschen kamen mit schweren Erkrankungen zu dem freundlichen Mitt-50er. Niemand schöpfte den Verdacht, dass „der Herr Doktor“ im weißen Kittel in Wirklichkeit gar kein Arzt, sondern nur gelernter Fußpfleger ist. Ein Zufall brachte das Kartenhaus dann zum Einstürzen. Für seine Taten saß der Hochstapler fünf Jahre lang im Gefängnis. Als „Arzt“ genoss er Wohlstand und freute sich über Kontakt zu High Society. Doch das liegt lange zurück. Heute ist er einsam und arm.Trotz des tiefen Vertrauensbruchs, den die falsche Identität von Harald S., bei Freunden und Bekannten verursacht hat, gerät seine ehemalige Praxis-Angestellte noch heute ins Schwärmen, wenn sie über die menschlichen Fähigkeiten ihres Chefs berichtet: „Er hat die Patienten in seinen Bann gezogen und konnte die Leute von sich überzeugen.“ So hielt Harald S. im feinen Anzug und mit höflichem Auftreten sogar Vorträge vor medizinischen Fachleuten. Stets kam seine „Kompetenz“ gut an. Zu seiner Entschuldigung sagt er heute: „Ich hab niemanden gefährdet oder abgezockt.“ Auch der 30-jährige Marcel R. genoss die Anerkennung und das Ansehen als Arzt. Auch er glänzte durch Fachwissen, selbstsicheres Auftreten und gewinnendes Wesen. Er präsentierte sich in Hannover als Facharzt für Palliativmedizin und täuschte damit Familien mit todkranken Kindern. Denn: Marcel R. ist gar kein Mediziner. Sein Plan war die Eröffnung eines Kindertageshospizes, das Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern entlasten sollte. „Ich habe nicht an mich gedacht“, behauptet Marcel R. heute nach seiner Entlassung aus der Haft. „Ich musste nur den Arzt spielen, um dieses gute Konzept nach vorne zu bringen.“ So schmückte sich der zierliche Mann mit diversen Titeln: „Dr. med. univ. Mag. Psych.“ Je mehr Titel er sich gab, umso einfacher habe er seine Ziele erreicht. Tatsächlich hat er nie studiert, sondern die Realschule abgebrochen. Was treibt diese Menschen dazu, sich als etwas auszugeben, was sie gar nicht sind? Und was empfinden die Opfer, wenn ihnen klar wird, dass sie getäuscht worden sind? ‚Hochstapler und ihre Opfer‘ ist ein Film über die Kunst der Täuschung im Arztkittel, das Spiel mit der Macht und den Gefühlen der Opfer. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 20.07.2017 WDR Mädchen oder Junge? – Aufwachsen als Transgender-Kind
Folge 19Sophia ist acht Jahre alt. Sie sieht aus wie ein Mädchen, sie fühlt sich als Mädchen. Geboren aber wurde Sophia als Philipp. Doch mit gerade mal 4 Jahren beschließt sie, kein Junge mehr zu sein. Sie will nur noch Röcke und Kleider tragen, lässt sich die Haare lang wachsen und nennt sich wie die Prinzessin aus ihrer Lieblings-Fernsehserie. Am Anfang denken ihre Eltern, das sei vielleicht nur eine Phase. Doch Sophia scheint genau zu wissen, wer sie ist. Sie sagt nicht, dass sie ein Mädchen sein möchte.Sie sagt, dass sie ein Mädchen ist. Wenn sie mit Philipp angesprochen wird, reagiert sie aggressiv. Schließlich überzeugt sie ihre Eltern und ihre drei Brüder, sie als Tochter und Schwester zu akzeptieren. Heike hatte immer die Tochter, die sie sich gewünscht hat. Seit vier Jahren heißt ihre Tochter nun Fynn. Der Transjunge hatte mit 14 sein Coming-out. Die Mutter sagt, es sei nicht leicht gewesen, sich von der Tochter zu verabschieden und einen Sohn zu bekommen. Heute geht es ihr vor allem darum, dass Fynn die Unterstützung erhält, die er braucht. Er hat gerade sein Abitur gemacht und hat jetzt nur einen Wunsch: eine Operation, um sich die Brüste abnehmen zu lassen. Aber wieviel Veränderung muss wirklich sein, um ein glückliches Leben als Trans-Mensch führen zu können? Saskia Fahrenkrug leitet die Spezialambulanz am UKE in Hamburg. Mit ihrem Team betreut die Psychotherapeutin fast 500 transidente Kinder und Jugendliche. Nachdem sie die Diagnose zur sexuellen Identität gestellt hat, übernimmt der Hormonspezialist Achim Wüsthof die medizinischen Maßnahmen. Gerade mit dem Einsetzen der Pubertät, wenn sich Brüste oder Barthaare entwickeln, beobachtet der Endokrinologe bei vielen Patienten Verzweiflung und Depressionen. Manche haben sogar Suizidversuche hinter sich. Eine Hormonbehandlung zu unterlassen und abzuwarten, sei meist keine Option, sagt Wüsthof. Denn die als falsch empfundene Pubertät würde den Leidensdruck deutlich verstärken. Auch der 14-jährige Alexander und die 15-jährige Klara sind bei ihm in Behandlung. Beide haben vor wenigen Monaten mit der gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung begonnen. Durch das Testosteron verändert sich Alexander äußerlich langsam zum Mann. Seine Stimme wird tiefer, die Schultern breiter und die Körperbehaarung nimmt zu. Bei Klara sorgen die Östrogene dafür, dass ihre Formen weicher werden und langsam das Brustwachstum einsetzt. Beide Teenager haben das Gefühl, sich nicht mehr verstecken zu müssen und endlich auch körperlich das zu erleben, was sie fühlen. Die Jugendlichen selbst stehen im Zentrum einer kontroversen Diskussion: Können sie wirklich schon eine dauerhafte Aussage über ihre Geschlechtsidentität treffen? Ist Transidentität bei Kindern und Jugendlichen eine Laune der Natur oder nur eine Phase? Und wie wird sich das Kind weiterentwickeln? Sophia, Klara, Alexander und Fynn: zwei Transmädchen und zwei Transjungen zwischen acht und 19 Jahren. Menschen hautnah begleitet sie und ihre Familien auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Identität. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 27.07.2017 WDR Leben in der Landkommune – Städter wagen den Neuanfang
Folge 20 (45 Min.)Weit und breit ist – nichts. Fast nichts. Nur Vogelgezwitscher und höchstens mal ein neugieriger Spaziergänger oder ein geräuschloser Segelflieger auf dem Gelände nebenan. Und die Gemeinschaft „Lebensbogen“. Die hat sich im Sommer 2015 mitten in einem Naturschutzgebiet angesiedelt, 20 Kilometer entfernt von Kassel. 18 Erwachsene und zwei Kinder leben in der Gemeinschaft – eine junge Familie sowie Paare und Singles aus ganz Deutschland. „Wir sind wie eine Großfamilie, die sich bei allem unterstützt“, sagen sie. Zwischen zwei und 70 Jahre alt sind sie, von Beruf Schreiner, Heilpraktiker oder Prokuristen.Einige arbeiten außerhalb, die meisten jedoch im Projekt, wo sie ein Café und ein Tagungshaus betreiben. Wichtige Entscheidungen werden einmal pro Woche gemeinsam im Plenum getroffen, das Geld, das sie verdienen, fließt in einen gemeinsamen Topf. Gemeinschaftsökonomie nennen sie das. Wer Vermögen hat, kann es gerne einbringen, Pflicht ist das aber nicht. Allerdings muss es dann ruhen, damit alle die gleichen Lebensbedingungen haben. Es gibt hier auf dem Dörnberg viel zu tun für die Bewohner. Die lange leerstehenden Gebäude und das große Gelände haben sie vor zwei Jahren für rund 1,2 Millionen Euro als Genossenschaft gekauft. Das ehemalige Altenheim mit dem Beton-Charme der 60er Jahre ist von außen grau und hässlich, hat aber eine ideale Struktur mit reichlich Platz. Denn die Gemeinschaft soll noch wachsen, am liebsten auf 50 Erwachsene plus Kinder. Wer Teil davon werden möchte, kann zu Kennenlern-Wochenenden kommen, nach mindestens zwei Wochen wird dann auf beiden Seiten entschieden, ob es Stück für Stück weitergeht. Inka hat diese Kennenlern-Phase hinter sich. Die 34-Jährige ist gerade mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern eingezogen, hat an ihrem bisherigen Wohnort Heidelberg Eltern und Freunde zurückgelassen. „Es gibt noch Abende, da will ich einfach nur in meinem Zimmer bleiben und will niemanden sehen. Und dann wache ich morgens wieder auf und denke, juhuu, schön, dass ich hier bin.“ Sie hat schon lange von einer Veränderung in ihrem Leben geträumt – und jetzt endlich gewagt, den letzten Schritt zu machen. Raus aus der Stadt mit den anonymen Nachbarn. Raus aus der Kleinfamilie, die alles alleine stemmen musste. Inka freut sich auf ihre Zukunft hier draußen auf dem Land. Und sie hofft, dass auch ihre Familie hier gut aufgehoben ist. „Unser ganzes Familienleben ändert sich. Wir wollen hier in der Gemeinschaft die Beziehung Ehe und Eltern und Kind aufrechterhalten, aber trotzdem ist es eben keine Kleinfamilie mehr.“ „Menschen hautnah“ hat Inka und ihre Familie in ihren ersten Wochen in der Landkommune begleitet. Hält der Traum von Veränderung, was er verspricht? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 03.08.2017 WDR Gisela on the road: Mit 75 unterwegs im Wohnmobil
Folge 21 (45 Min.)Endlich wieder unterwegs: Gisela H. steigt in ihr blaues Wohnmobil. Sie kommt gerade von ihrer Tochter, die sie einmal im Jahr, meist zu Ostern, besucht. Übernachten unter einem festen Dach – für die 75-Jährige ist das die Ausnahme. Denn Gisela ist immer on the road. Den Winter tourt sie durch Marokko, denn das Klima dort tut ihr gut. Bis vor acht Jahren war sie fast ein Pflegefall, mit Aussicht auf ein Leben im Rollstuhl. Doch seit sie ihr geliebtes Wohnmobil besitzt, ist alles anders. Lange führte Gisela ein ganz normales Leben.Sie lernte Bürokauffrau, heiratete mit Anfang 20, bekam eine Tochter, wurde Hausfrau. Die Ehe zerbrach nach ein paar Jahren. Gisela suchte sich eine Arbeit, um für sich und ihre Tochter zu sorgen. Doch dann setzte ihr eine rheumatische Autoimmunerkrankung immer mehr zu. Sie konnte sich kaum bewegen und wurde mehrmals operiert. Umzug ins Wohnmobil – mit 67 Jahren Mit 67 Jahren beschloss Gisela, sich keiner weiteren OP mehr zu unterziehen. Sie änderte ihr Leben radikal, stellte ihre Ernährung um, verkaufte ihr Haus in Wuppertal und legte sich einen Fiat zu, den sie zu einem Wohnmobil umbauen ließ. Seitdem lebt sie auf der Straße. Einige Freunde und Verwandte schütteln nur den Kopf. Sie können nicht nachvollziehen, dass man so leben kann – schon gar nicht in ihrem Alter. Den Winter verbringt Gisela immer in Marokko, wegen ihrer Knochen, wie sie sagt. Von dort geht es dann im März ganz gemächlich Richtung Deutschland. Hier besucht sie ihre Tochter samt Familie, Freunde und ihren Bruder, der sie immer wieder überreden möchte, endlich wieder sesshaft zu werden – vergeblich. Von Deutschland geht es weiter. Ihre letzte Sommertour führte Gisela durch die Schweiz, Österreich, Kroatien, Slowenien und Ungarn. Eine Reise nach Polen – auf den Spuren ihrer Vergangenheit 2017 ist für Gisela ein ganz besonderes Jahr, denn sie macht sich auf in ihre Vergangenheit. 1945, sie war gerade drei Jahre alt geworden, musste Ihre Familie aus Ostpreußen fliehen. Die Mutter zog allein mit 10 Kindern los, eine traumatische Erfahrung. Giselas jüngster Bruder Wolfgang erfror auf der Flucht. Obwohl Gisela damals erst drei Jahre alt war, hatte sie bis zu ihrem 23. Lebensjahr Albträume davon. Eine ihrer älteren Schwestern hat ihr später die „Geschichte des Überlebens“, wie Gisela sie nennt, erzählt. Alle anderen Geschwister konnten nie darüber reden. Dieses Jahr nun fährt Gisela ihre Fluchtroute nach. Eine Reise in die Vergangenheit – frühesten Erinnerungen und der Geschichte ihrer Familie auf der Spur. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 10.08.2017 WDR Der Traum vom neuen Leben – …und seine Schattenseiten
Folge 22Einfach alles hinschmeißen – und endlich das tun, was man immer schon wollte. Viele kennen diesen Gedanken. Doch nur wenige trauen sich, ihr Leben tatsächlich über den Haufen zu werfen und etwas Neues zu beginnen. Karen L. und das Ehepaar Gabi und Robert E. haben es getan. Die 54-jährige Karen hatte eigentlich alles, um glücklich und zufrieden zu sein: Familie, Gesundheit, einen tollen Job als Geschäftsführerin eines Unternehmens mit über 200 Beschäftigten. Trotzdem beschlich sie das Gefühl, an sich vorbei zu leben, nicht das zu tun, was ihr wichtig ist.Irgendwann wird ihre Unzufriedenheit größer als alle Zweifel und Ängste. Sie kündigt ihre Stelle, ohne zu wissen, was danach folgen soll. „Es war wie ein Sprung ins total kalte Wasser. Ich habe es noch nicht einmal vorher meinem Mann gesagt, dass ich es am nächsten Tag tun würde.“ Statt neu loszulegen wird sie erst einmal krank. Dann hat sie die Idee zu einem Startup: Erlebnisübernachtungen an besonderen Orten – in einem besonderen Bett. Auch Gabi und Robert hatten auf den ersten Blick alles, was ein gutes Leben ausmacht: Geld, gute Jobs, Freunde. Doch die tägliche Tretmühle und die Aussicht, dass die nächsten zehn Jahre so dahinplätschern könnten wie die zurückliegenden zehn, deprimieren sie zunehmend. Die Mittvierziger beschließen, alles aufzugeben. Sie kündigen ihre Arbeitsstellen, verkaufen ihren gesamten Hausrat und reisen mit dem verbliebenen Hab und Gut, das in zwei Rucksäcke passt, Richtung Asien. Hier wollen sie als ‚digitale Nomaden‘ leben und arbeiten. Bringt der Neubeginn tatsächlich mehr Zufriedenheit und Erfüllung? Peter Podjavorsek hat die Aussteiger mehrere Monate lang begleitet – und festgestellt, dass der Traum vom neuen Leben auch seine Schattenseiten hat. Karen macht zwar endlich ihr eigenes Ding. Doch ihr Startup verursacht auch enormen Stress und finanzielle Risiken. Gabi und Robert leben nun zwar dort, wo andere Urlaub machen: in Thailand. Ihre neue Freiheit geht aber einher mit den Verlust von Freunden und der Schwierigkeit, fernab der Heimat seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Gabi sagt heute: „Mir war auch von Anfang klar: es hat seinen Preis, sein Leben so umzukrempeln. Also deswegen will ich jetzt auch nicht so rumjammern. Aber es hat definitiv einen Preis.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 17.08.2017 WDR Neustart im Alter – Zwei Frauen müssen ihr Leben ändern
Folge 23Barbara hat noch viel vor im Leben. Die Sozialarbeiterin ist 62 Jahre alt und kurz vor der Pensionierung. Als ihr Mann sie nach dreißig Jahren Ehe wegen einer jüngeren Frau verlässt, bricht ihre Welt zusammen, aber Barbara ist auch klar: sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie sucht sich neue Freunde, neue Hobbys und zieht in eine günstigere Wohnung. Parallel zur Scheidung wird Barbara pensioniert. Vierzig Jahre lang hat sie als Sozialarbeiterin im Bezirksamt gearbeitet, nun hat sie plötzlich sehr viel Zeit! Als Single und Rentnerin weiß sie zunächst nicht, wie sie ihre langen Tage füllen soll. Barbara will das Alleinleben und ihre Rente aber nicht nur mit Hobbys und Freunden verbringen, sie sucht nach einer neuen Aufgabe, sie will mithelfen, die Welt ein wenig besser zu machen.Und dann hat Barbara die zündende Idee: Sie möchte einer Partei beitreten! Aber wird Barbara der Neuanfang wirklich glücken und wie geht sie mit der Einsamkeit um? Inge und Barbara kämpfen gegen die Leere Inge ist gebürtige Kölnerin und lebt seit einigen Jahren im westfälischen Arnsberg. Die 73-Jährige war einmal verheiratet, aber das ist schon lange her. Über eine Heiratsanzeige lernt sie als reife Frau die Liebe ihres Lebens kennen. Mit ihrem gleichaltrigen Freund teilt Inge die Leidenschaft fürs Segeln, in hohem Alter kaufen sich die beiden ein Segelschiff und unternehmen wochenlange Turns. Inge ist überglücklich! Dann folgt der Schock. Inge muss entdecken, dass ihr Freund 18 Jahre lang ein Doppelleben führt, er ist verheiratet. Sie trennt sich schweren Herzens von ihm. Kurz darauf erkrankt Inge an Blasenkrebs. In einer stundenlangen Operation wird ihr eine künstliche Blase genäht. Sie ist dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen. Jetzt will die 73-Jährige sich neu erfinden! Inge plant eine Initiative gegen Einsamkeit, gibt Computerkurse für Senioren und hilft Grundschulkindern bei den Hausaufgaben. Außerdem eröffnet sie eine Praxis für Stressmanagement und bildet sich im psychologischen Coaching weiter fort. Inge will ihr Wissen nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Aber die Erinnerung an ihren Freund lässt sie nicht los. Der Neuanfang hat viele Hürden. In der Sendereihe „Menschen hautnah“ begleitet der Autor Florian Aigner zwei Frauen, die gezwungen werden, im Alter einen Neustart zu wagen. Barbara und Inge wollen sich nicht unterkriegen lassen und kämpfen darum, wieder glücklich zu werden. Denn beim Glück spielt das Alter keine Rolle! (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 24.08.2017 WDR Vertrieben aus dem Paradies
Folge 24Sieben Jahre lang lebte Rolf Tepel, der sich Ketan nennt, auf einer städtischen Baubrache mitten in Köln. Zwischen ausrangierten Zirkuswagen und selbstgebauten Holzhäusern träumte er davon, eine bessere Welt zu errichten. In seinem „Paradies“, einem 3.600 Quadratmeter großen Gelände ohne fließendes Wasser und ohne Strom, wollte er einen Ort für mehr Miteinander und weniger Konsum erschaffen, für mehr Kreativität und weniger Konformität. Mit seinen idealistischen Plänen lockte er die unterschiedlichsten Menschen an – vom großzügigen Kunstmäzen über die Aussteigerin aus der Computerwelt bis hin zum drogenabhängigen Obdachlosen.Und dann der Schock: Eines Tages rücken die Bulldozer an. Ketan und seine Freunde müssen gehen. Sein „Paradies“ wird zur Großbaustelle. Auf seiner Brache soll das neue Stadtarchiv errichtet werden. Ketan wird sesshaft Was viele als das Scheitern eines großen Projekts sehen würden, verbucht Ketan als eine weitere Erfahrung in seinem reichen Leben. Denn schon vor über 30 Jahren hat sich Ketan aus dem bürgerlichen Leben verabschiedet, seither schlägt er sich durch, ohne Krankenversicherung, ohne geregelte Arbeit, lebt vorwiegend von Spenden und lehnt staatliche Sozialleistungen ab. Er versteht sich als Künstler und Lebenskünstler. Aus dem „Paradies“ vertrieben, zieht er zu einem alten Freund, den er bis in den Tod begleitet. Und dann entscheidet er sich für etwas, das er sich lange nicht hatte vorstellen können: Er wird sesshaft. Ketan wohnt von nun an bei seiner Freundin im Bergischen Land. Zugleich betreibt er mit großem Enthusiasmus die Verschönerung des Eierplätzchen-Platzes in der Kölner Innenstadt, fegt ihn regelmäßig und presst aus den gefundenen Kronkorken eine eigene Währung, die die Verschönerung finanzieren soll. Für Ketan ist das Paradies kein Ort mehr, sondern eine Haltung. In unserem Film „Mein Leben im Paradies“ haben wir 2014 über Ketans Lebenstraum berichtet. Nun zeigt „Menschen hautnah“ Ketans Vertreibung aus dem „Paradies“ und sein Leben, nachdem der Traum geplatzt ist. Wie erlebt Ketan seine dauernden dramatischen Veränderungen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 31.08.2017 WDR Wo ist mein Kind? – Verzweifelte Eltern und das Spiel mit der Hoffnung
Folge 25Eigentlich ist es ein ganz normaler Tag im Oktober 1998. Die 15-jährige Tanja aus Wuppertal geht zur Schule, ihre Mutter zur Arbeit. Doch am Nachmittag kommt Tanja nicht nach Hause. Bis heute ist sie verschwunden. Jede Suche, alle Ermittlungen bleiben erfolglos. Jahrelang hofft Tanjas Mutter Elisabeth K., dass ihre Tochter irgendwann zurückkommt. 14 Jahre nach Tanjas Verschwinden meldet sich dann plötzlich ein fremder Mann bei ihr. Patrick O. sitzt damals wegen Betrugs und Körperverletzung im Gefängnis. Er behauptet, Tanja zu kennen und zu wissen, wo sie ist. Mit großen Erwartungen fährt Elisabeth K. zu ihm ins Gefängnis. Gibt es neue Hoffnung oder spielt Patrick O. nur mit der Not der Mutter? Diese Frage muss sich auch Joachim G. immer wieder stellen.Seit fast drei Jahren sind seine beiden Söhne – damals 19 und 23 Jahre alt – verschwunden. Sie wollten sich der Terrororganisation IS anschließen und reisten nach Syrien. Seitdem versucht Joachim G. alles, um seine beiden Söhne zurückzubekommen. Bereits 20 Mal ist er in die Türkei und nach Syrien geflogen, um sie zu suchen. Immer wieder bezahlt er Schleppern und angeblichen Informanten viel Geld, damit sie ihm dabei helfen. Bisher jedoch ohne Erfolg. „Menschen hautnah“ erzählt die Geschichte von Eltern, die in ihrer Verzweiflung alles tun würden, um ihre Kinder wiederzufinden und die Geschichte von Menschen, die das schamlos ausnutzen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.09.2017 WDR Zwei Schwestern, ein Leben – Ohne meinen Zwilling geht es nicht
Folge 26 (45 Min.)Irina und Marina sind eineiige Zwillinge. Mit ihren 37 Jahren waren sie nie länger als ein paar Tage getrennt. Die beiden Frauen teilen alles miteinander: den gesamten Alltag, die Kleidung, ihre kleine Wohnung in Düsseldorf und vor allem die Leidenschaft für das Malen. In der Kunstszene gelten sie als konkurrenzlos, da sie jedes Bild gemeinsam malen – eine einzigartige Technik, die bei Kritikern und Käufern sehr gut ankommt. Die Kehrseite ihrer engen Beziehung zeigt sich beim Thema Männer. Beide wünschen sich einen festen Freund und möchten am liebsten gleichzeitig Mutter werden.Doch bisher konnte es noch kein Mann akzeptieren, nicht die Nummer eins zu sein. Irina und Marina wissen, dass sie etwas ändern müssen, und wollen aus ihrer gemeinsamen Isolation ausbrechen. Der erste Schritt ist der Umzug in eine neue Wohnung, in der sie erstmals getrennte Schlafzimmer haben. Um Freunde und vielleicht sogar Männer kennenzulernen, wollen sie unter Gleichgesinnten suchen und fahren zu einem Zwillingstreffen nach Potsdam. Dort müssen sie sich und ihre Beziehung aber auch hinterfragen: Sind sie normal? Und wie eng ist zu eng – selbst für eineiige Zwillinge? Gleichzeitig klettern sie die Karriereleiter weiter hoch und werden von ihrer Kunst immer wieder gemeinsam vor die Leinwand gezwungen. Denn ohne die Schwester malen, das kann keine der beiden. Sie haben große Träume und wollen am liebsten in allen großen Städten der Welt ausstellen. Doch welche Opfer müssen sie dafür bringen? Sie müssen sich entscheiden: Können sie sich voneinander lösen, so dass Platz für andere Menschen entsteht, oder steht ihre Kunst über allem und macht sie gemeinsam einsam? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 16.11.2017 WDR Erstausstrahlung ursprünglich für den 28.09.2017 angekündigtMutter auf schmalem Grat
Folge 27Gudrun wagt sich in die steilsten Wände, kämpft sich durch ewiges Eis auf die höchsten Gipfel. Seit 1988 ist sie Bergführerin – die erste Frau in Deutschland, die diese Männerdomäne erobert. Als sie mit 34 Jahren auf dem Gipfel ihrer Karriere Mutter wird, fehlt ihr plötzlich jede Antriebskraft. Sie kann keine Beziehung zu ihrer Tochter Lisa aufbauen und gibt dem Baby die Schuld, dass sie nicht mehr in die geliebten Berge kann. Es vergehen sechs Monate, bis Gudrun erkennt, dass sie unter einer postpartalen Depression leidet.Ihr Umfeld glaubt, dass sie sich nur an das neue Leben mit Kind gewöhnen müsse. Doch Gudrun fühlt sich komplett überfordert. Immer öfter beschleicht sie eine Wut über ihr „Versagen“, das eigene Kind nicht lieben zu können. Sie, die bisher gewohnt war, alles über Disziplin und Leistung zu erreichen, lernt Schritt für Schritt durch ihre Tochter, wie wichtig emotionale Nähe ist. Und eines will sie noch unbedingt von ihrer mittlerweile 21-jährigen Tochter lernen: Gelassenheit. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 05.10.2017 WDR Mein Mann und der Alkohol – Wenn Liebe nicht reicht
Folge 28Alkoholsucht – fast jeder hat jemanden in seinem Bekanntenkreis, der davon betroffen ist. Mindestens acht Millionen Angehörige von suchtkranken Alkoholikern gibt es in Deutschland, schätzen Experten. Und das Tabu, darüber zu sprechen, ist riesengroß. Doch was tun, wenn der liebste Mensch Alkoholiker ist? Jeden zweiten Donnerstag treffen sich in Dorsten die Frauen von Alkoholikern in der Selbsthilfegruppe vom Blauen Kreuz. Drei von ihnen lernen wir näher kennen: Luise, Sigrid und Agnes. Alle drei gehen ganz verschieden mit der Alkoholsucht ihrer Männer um. Luise ist 65 Jahre alt. Erst vor kurzem hat sie sich von ihrem geliebten Mann Peter getrennt und sich eine kleine Wohnung in Marl gesucht – nach 39 Jahren Ehe.Zum Schluss trank Peter bis zu zwei Flaschen Rum am Tag. Luise konnte nichts dagegen tun, wollte ihren Mann aber auch nicht verlassen – so dass die geliebte Tochter Miriam den Kontakt abbrach. Das gab Luise den letzten Anstoß, sich zu befreien. Nun muss sie sich den Vorwürfen ihrer Tochter stellen. Sigrid hat bis zum Ende gekämpft und doch verloren. Immer dachte sie, sie kann ihren geliebten Frank retten, durch unerschöpfliche Liebe und Geduld. Doch nichts half. Noch schwerkrank mit dem Rollator geht Frank zur Tankstelle um sich „Stoff“ zu besorgen. An Sigrid nagt ein Zweifel: Hätte sie ihm helfen können, wenn sie mehr Grenzen gesetzt hätte? Nachdem Agnes – zum zweiten Mal – klar wird, dass Heinrich alkoholsüchtig ist, zeigt sie sofort Flagge: Sie wird ihn verlassen, wenn er nicht in Therapie geht. Heinrich nimmt seine Frau ernst. Er holt sich Hilfe und ist seit vier Jahren trocken. Und doch hat der Alkohol viel Vertrauen zwischen ihnen zerstört. Bis heute kämpfen sie um ihre Beziehung. „Menschen hautnah“ zeigt das Portrait dreier Frauen, die mit schonungsloser Offenheit über ein Thema reden, das bis heute stark tabuisiert ist: Alkoholsucht und die Folgen für die Angehörigen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 12.10.2017 WDR 50 Kilo bei 1,89 Meter – Wenn Männer magersüchtig sind
Folge 29„Die Magersucht ist meine beste Freundin“, sagt der 15-jährige Tim. Zusammen mit seiner Therapeutin soll er beim Bäcker ein Stück Kuchen bestellen. Doch Tim kann das Gebäck kaum anschauen, er findet es ekelhaft. „Ich habe Angst vor den Kalorien. Das ist pures Fett“, sagt Tim. Magersucht – typisch Frau? Essstörungen gelten häufig als Mädchenkrankheit. Doch Schlankheitswahn und Körperkult lassen auch Männer magersüchtig werden. Bislang ist das oft ein gesellschaftliches Tabu. Die Betroffenen fühlen eine doppelte Stigmatisierung: Sie leiden an einer psychosomatischen Erkrankung und obendrein an einer Frauenkrankheit.Das führt dazu, dass die Krankheit leichter übersehen wird, die Dunkelziffer dementsprechend hoch ist. Der 15-jährige Tim aus Bayern war früher zu dick, dann hungert er sich ins Untergewicht. Im Februar kommt Tim in eine Klinik am Chiemsee – mit starkem Untergewicht. Die Ärzte sagen, er muss 15 Kilogramm zunehmen. In verschiedenen Therapien soll Tim lernen, wieder selbstständig zu essen. Nach mehr als vier Monaten in der Klinik darf Tim wieder nach Hause, soll bald wieder zur Schule gehen. Obwohl er gerne seinen Abschluss machen will, fürchtet er sich vor diesem Schritt. Auch Tims Mutter Tanja hat große Angst und sie plagen Schuldgefühle. Obwohl sie alles für ihren Sohn tun würde, fühlt sie sich ohnmächtig. Wie geht es zuhause für Tim und seine Mutter weiter? Kann Tim das, was er in der Klinik gelernt hat, im Alltag umsetzen? Oder wird er wieder an Gewicht verlieren? Raimund ist 27 Jahre alt und kommt aus Nordrhein-Westfalen. Seine Magersucht geht schon sein halbes Leben, erzählt er. Als er 13 Jahre alt ist, sieht er eine Werbung mit herausstehenden Wangenknochen – so möchte er auch aussehen. Es folgt ein jahrelanger Kampf mit sich selbst – mit guten und schlechten Phasen. Raimund fällt es schwer, Hilfe anzunehmen, seine Krankheit war jahrelang sein Geheimnis: „Ein Mann ist stark, hat keine Probleme“, denkt er. Als Raimund schließlich doch von seiner Magersucht erzählt, erfährt er Unverständnis. „Magersucht können Männer doch gar nicht haben“, habe man ihm gesagt. Doch in diesem Sommer beschließt der gelernte Koch sich endlich Hilfe zu holen – der Weg aus der jahrelangen Krankheit? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 26.10.2017 WDR Das Messie-Haus, meine Familie und ich
Folge 30 (45 Min.)Frieder hat sein Elternhaus in Ludwigshafen geerbt, ein Haus ohne Licht und Strom. Die Räume zugemüllt vom Keller bis zum Dach. Hier lebte sein älterer Bruder Karl die letzten zwölf Jahre allein. Im Juni 2016 verständigten die Nachbarn die Polizei. Seit Tagen war der Briefkasten nicht mehr geleert worden. Der Notarzt fand die Leiche des Bruders inmitten von Müll. Die Nachbarn informieren auch Frieder, den einzigen noch lebenden Verwandten. Nachdem die Mutter 2004 starb, hatte Frieder das Haus nicht mehr betreten. Und nun das: Zwischen Stapeln von Zeitschriften, Büchern, Knäckebrot, Radios, VHS-Kassetten, CDs und Fernsehern nur schmale Gänge, auf denen man sich bewegen kann.Ein bestialischer Gestank in der Luft. Überall Mäusekot. Gemeinsam mit Freunden versucht Frieder, sich durch die Müllberge zu wühlen – mit Handschuhen und Atemschutzmaske. Monatelang trennen sie Papier, Plastik, Elektroschrott und lassen es abtransportieren. In dem Chaos finden sich Reichsmark, Plastikbehälter mit gesammeltem Urin, Geld, Waffen, Würmer, aber auch: Tagebücher und Briefe des Vaters, der Mutter, des Bruders. Hunderte von Familienfotos und Video 8-Bänder, die der Bruder mit einer Kamera aufgenommen hat. Ein riesiges Archiv der Familie wird langsam sichtbar. Und eine riesige Aufgabe liegt vor Frieder, der 1970 sein Elternhaus im Streit verlassen hat. Plötzlich ist die Familiengeschichte und mit ihr das, was in seinem Leben schiefgelaufen ist, allgegenwärtig. Die Schläge, die Wut, die Trauer, die Rebellion. Die schwierigen Beziehungen zu den Eltern, zu dem Bruder, all die Zurückweisungen, Verletzungen und das tief sitzende Gefühl, ausgeschlossen gewesen zu sein. Ein Jahr lang begleitet Menschen hautnah Frieder bei seiner Reise in die Vergangenheit und bei dem schmerzhaften Unterfangen, sich der eigenen Familiengeschichte zu stellen. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 09.11.2017 WDR Meine Tochter und ihre Peiniger – Das Horrorhaus von Höxter
Folge 31Fast jeden Dienstag sitzt Sigrid K. im Saal 205 des Landgerichts Paderborn und blickt in die Gesichter der mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter. Seit über einem Jahr. Sie ist Nebenklägerin im Prozess gegen Wilfried und Angelika W., die im sogenannten „Horrorhaus von Höxter“ Sigrids Tochter Anika gequält und misshandelt hatten. Anika ist nicht das einzige Opfer. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord durch Unterlassen und gefährliche Körperverletzung in weiteren Fällen. Die Aussagen der Angeklagten sind für die 76-jährige Sigrid K. oftmals kaum zu ertragen.Doch sie will wissen, was ihrer Tochter zugestoßen ist und Erklärungen finden, wie es dazu kommen konnte. Und sie will wissen, was das für Menschen sind, die ihrer Tochter Anika so etwas angetan haben. Das, so glaubt sie, ist sie ihrer Tochter schuldig. In den Nachrichten hatte Sigrid Ende April 2016 durch Zufall das Haus im Saatweg in Höxter-Bosseborn gesehen und erfahren, dass dort Frauen brutal misshandelt worden sein sollten. „Mein Gott, „ dachte sie, „das ist doch das Haus, in dem Anika lebt.“ Sie rief die Polizei an und erfuhr das Unfassbare: Ihre Tochter lebte nicht mehr – zu Tode gequält, die Leiche zersägt und in einem Ofen verbrannt. Anika war 33, als sie starb. Als sie Wilfried durch eine Zeitungsannonce kennenlernte, lebte sie mit ihrer Mutter in einem Haus in Uslar. Die beiden hatten ein inniges Verhältnis, bis Wilfried Anika drängte, zu ihm nach Höxter zu ziehen. Danach verlor Sigrid nach und nach den Kontakt zu ihrer Tochter. Sie erfuhr nicht einmal von der Hochzeit mit Wilfried und erhielt nur noch sporadisch SMS. Darin beteuerte Anika immer wieder, wie glücklich sie mit ihrem Mann sei. Wie Sigrid K. erst lange nach ihrem Tod erfuhr, kamen die SMS gar nicht von ihrer Tochter, sondern von der Angeklagten Angelika W. Sigrid quält die eine Frage: Hätte sie den Tod ihrer Tochter verhindern können? War es richtig, das Recht der Tochter auf ihr eigenes Leben zu respektieren? „Menschen hautnah“ hat die Mutter während des Prozesses begleitet. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 30.11.2017 WDR Sowas wie Angst – Eine Suche mit Anke Engelke
Folge 32Nach den beiden journalistischen Reisen „Sowas wie Glück“ und „Sowas wie perfekt“ geht Anke Engelke in dieser 75-minütigen WDR-Reportage dahin, wo die Angst sitzt. In „Sowas wie Angst. Eine Suche mit Anke Engelke“ beschäftigt sich die Schauspielerin mit einem Gefühl, das unsere Gesellschaft fest im Griff zu haben scheint. In ihrer Heimatstadt Köln sind nach der Silvesternacht die Anträge auf kleine Waffenscheine von rund 400 auf 4.000 im Jahr gestiegen, Angststörungen gehören mittlerweile zu den Volkskrankheiten, und immer mehr Menschen schließen sich den Preppern an – so nennen sich die Leute, die sich auf alle denkbaren Katastrophen vorbereiten.Um zu verstehen, wovor und warum Menschen sich fürchten, reist Anke Engelke zunächst nach Wuppertal. Der Berliner Platz in Oberbarmen gehört zu den 33 sogenannten Angstorten, die es dort nach einer offiziellen Erhebung gibt. Die Bürger meiden den Platz aus Angst vor Überfällen. Zurecht? Statistisch gesehen ist es hier nicht gefährlicher als anderswo. Und trotzdem haben die Menschen dieses Gefühl. Anke Engelke begleitet Streetworker, Sozialarbeiter und Künstler, die versuchen, dem Platz ein neues Image zu verpassen. Menschen haben Angst, aber sind sie tatsächlich in Gefahr? Der Soziologie-Professor Ortwin Renn sortiert die Risiken und weiß, was statistisch wirklich Gefahren für Leib und Leben sind und was überschätzt wird. Nicht Mord und Totschlag bedrohen uns, sondern die vier Volkskiller Rauchen, Trinken, schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung. In der Tagesschau ist davon allerdings wenig zu sehen. Anke hält sich selbst für relativ furchtlos. Als Kind fürchtete sie lediglich, dass jemand ihr Fahrrad klaut. Harmlos, verglichen mit dem, was ihr Kinder einer Hagener Grundschulklasse erzählen. Heute fürchten sich Kinder vor Klimakatastrophen, Kriegen und Weltuntergang. Anke Engelke stellt sich in der Bochumer Uniklinik einer Angstdiagnose. Professor Jürgen Margraf bescheinigt ihr eine erstaunliche Angstfreiheit – bis auf eine leichte Höhenangst. Er unterzieht sie einem Test und besteigt mit ihr einen Bochumer Kirchturm. Mutig ist nicht der, der sich alles traut, sondern der, der die Angst besiegt. Was ist mit den Menschen, die zufrieden ein gutes Leben zu führen scheinen, jedoch unter etwas leiden, das niemand sieht: unter einer Angststörung. Die junge Casey berichtet über das Leben mit der ständigen Angst. Am Ende ihrer Reise zu Menschen, die über ihre Ängste sprechen, zieht Anke Engelke ihr Fazit: „Ängste muss man ernst nehmen, wir müssen darüber reden. Doch wenn eine subjektive oder unbegründete Angst uns im Griff hat, kann das gefährlich sein. Ängste sind oft gefährlicher für unser Leben als das, was wir meinen, fürchten zu müssen. Wer hätte das gedacht: Nicht hinter jeder Ecke lauert das Böse!“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.12.2017 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.