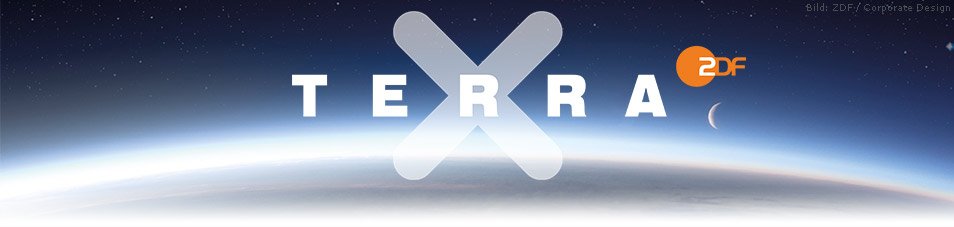1524 Folgen erfasst (Seite 60)
Wem gehört die Welt? – Eine Geschichte des Reichtums: 2. Von Fürsten und Kaufleuten
45 Min.In der zweiten Folge forscht Dirk Steffens nach den Ursachen, die den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Europas seit dem Mittelalter möglich machten. Woran lag das? Das Geheimnis der europäischen Erfolgsgeschichte ist die Konkurrenz. Dank ambitionierter Herrscher über vergleichsweise kleine Länder entwickelt sich in Europa eine Dynamik, die in kühne Expeditionen und technische Revolutionen mündet. Treibende Kraft ist zunächst der Adel. Könige bezahlen Gefolgschaft und Kriegsdienst von Adeligen mit der Vergabe von Land, zu dem im Mittelalter auch Dörfer, Siedlungen und die Menschen gehören, die darin leben.Daraus entstehen schon damals gewaltige Vermögen. So weist die älteste Steuerliste der Welt, das englische „Domesday Book“, den bretonischen Adligen Alain den Roten als stolzen Besitzer von 11 000 Pfund aus – nach heutigem Wert etwa 103 Milliarden Euro. Am unteren Ende der Gesellschaftsleiter stehen damals die Bauern. Sie müssen zwischen 30 und 40 Prozent ihrer Erträge an die Grundbesitzer abführen. Darüber hinaus muss der Bauer auch Frondienste leisten, also an einer Reihe von Tagen im Jahr unentgeltlich auf den Adelsgütern arbeiten. In fast jedem Dorf gibt es aber auch die „Allmende“, Grund und Boden, auf dem die Bauern gemeinschaftlich Erträge erwirtschaften und behalten können. Wirtschaftswissenschaftler haben den Begriff von der „Tragik der Allmende“ geprägt. Denn Gemeinschaftseigentum wie heutzutage etwa die Hochsee, leidet darunter, dass es immer Menschen gibt, die versuchen, den größten Eigennutzen daraus zu ziehen – zum Nachteil der Allgemeinheit. Die mittelalterliche Ständeordnung gründet letztlich auf den Zufall der Geburt. Wer sich heutzutage darüber empört, kommt aber ins Grübeln, wenn die Frage nach der gerechten Besteuerung eines Erbes gestellt wird. Denn auch das Erbe fällt einer Person zufällig zu. Noch immer wird in Deutschland Arbeit höher besteuert als ein Erbe. Ist das gerecht? Verhaltensexperimente demonstrieren eindrucksvoll einen psychologischen Mechanismus, der bei Erben greift: Sie halten es nach kurzer Zeit für „verdient“. Mit dem zunehmenden Warenverkehr und der Ausweitung der Geldwirtschaft im späten Mittelalter werden Kaufleute zum Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Manche der oft neidisch als „Pfeffersäcke“ bezeichneten Vertreter ihrer Zunft können es an Reichtum schon bald mit Adelsdynastien aufnehmen, wie etwa die Familie Fugger aus Augsburg. Sie versorgen Kollegen auf Kredit mit Baumwolle und Flachs und sicheren sich dadurch Anteile an den fertigen Tuchen, die sie mit Gewinn verkaufen. Damit kommt ein entscheidendes Element ins Spiel, das bis heute die Weltwirtschaft beherrscht – das Kapital. Auch der Zahlungsverkehr erfährt unter den Fuggern eine Neuerung: Man kann ihn bereits bargeldlos abwickeln. Ein großer Fortschritt in Zeiten, in denen noch Räuberbanden und Piraten den Kaufleuten auflauern. Dank der Fugger wird das beschauliche Augsburg im ausgehenden Mittelalter zu einem Zentrum des europäischen Wirtschaftslebens: Die Fugger betätigen sich als Bank für Päpste, Kaiser und Könige, besitzen zeitweilig das römische Münzrecht und handeln mit unterschiedlichen Gütern von Kupfer bis Nachrichten – über Kontinente hinweg. Ein Spross der Familie, Jacob Fugger, genannt „der Reiche“, besitzt am Ende ein Vermögen von umgerechnet 400 Milliarden Euro und nimmt damit einen Spitzenplatz im Ranking der Superreichen aller Zeiten ein. In der frühen Neuzeit wird Geld zum dominierenden Faktor im Wirtschaftsleben und ist schon damals mit denselben Problemen behaftet wie heute. Seit Spanier und Portugiesen aus ihren Kolonien in Mittel- und Südamerikas Silber in Hülle und Fülle nach Europa importierten – bis zu 220 Tonnen im Jahr – wird der europäische Markt mit billigem Geld überschwemmt. Damals tritt ein gefürchtetes Phänomen zum ersten Mal in großem Ausmaß auf: die Inflation. Sie entsteht dadurch, dass die Gesamtmenge aller Waren im Vergleich zur Geldmenge zu gering ist. Dadurch verliert das Geld an Wert. Das zu vermeiden, ist bis heute eine der wichtigen Aufgaben der Zentralbanken. In Bezug auf die Wirtschaftskraft stand Europa noch bis in die frühe Neuzeit im Schatten von China. Das lag an der Größe des Landes, der hohen Bevölkerungszahl, einer hoch entwickelten Kultur und nicht zuletzt an einer leistungsfähigen Bürokratie. China war lange Zeit ein Innovationsgigant: Schwarzpulver, Papier, Kompass – das alles war in China schon lange erfunden, bevor es die Europäer kannten. Auch die Landwirtschaft war im 12. Jahrhundert bereits so produktiv wie die europäische erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Doch seit dem 16. Jahrhundert ändern sich die Kräfteverhältnisse. Ausgerechnet das kleine Europa läuft anderen Kontinenten den Rang ab. Woran lag das? Durch Reichtum allein entsteht kein Wachstum oder Fortschritt. Das Geheimnis der europäischen Erfolgsgeschichte ist die Konkurrenz. Geografisch zergliedert und voll ambitionierter Herrscher über vergleichsweise kleine Länder entwickelt sich in Europa eine Dynamik des Wettbewerbs, die in kühne Expeditionen und technische Revolutionen mündet. Mit Geld und königlichen Privilegien ausgestattete Abenteurer machen sich auf den Weg und erobern mit einer Handvoll Soldaten halbe Kontinente, während geniale Zeitgenossen zuhause beginnen, der Natur ihre Geheimnisse zu entlocken. Alle diese Entwicklungen sind noch Leistungen einer Gesellschaft, in der eine kleine Kaste von Privilegierten, Adel und Klerus, die Geschicke von Millionen bestimmen. Das ändert sich Ende des 18. Jahrhunderts, zunächst mit der Unabhängigkeitserklärung der USA und dann durch die Französische Revolution. Eigentum und Besitz, Reichtum und Wohlstand sollen keine Frage der Abstammung mehr sein, sondern eine Frage der Leistung. Ein jeder hat das Recht auf das „Streben nach Glück“, wie es in der amerikanischen Verfassung heißt. Die dadurch geschaffenen bürgerlichen Freiheiten aber setzen eine Entwicklung in Gang, die alle vorherigen weit in den Schatten stellen wird: Die vielen innovativen Talente, die sich jetzt freier entfalten können, und das Kapital der alten Eliten wie in England münden in den Prozess der Industrialisierung. Sie verändert nicht nur Eigentumsverhältnisse, sondern letztendlich das Gesicht der Erde dauerhaft. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 19.05.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 20.05.2021 3sat Wem gehört die Welt? – Eine Geschichte des Reichtums: 3. Von der Macht des Marktes
45 Min.In der dritten Folge verfolgt Dirk Steffens den Aufstieg des Kapitalismus von seinen bescheidenen Anfängen bis zur weltumspannenden unangefochtenen Wirtschaftsordnung unserer Tage. Der Siegeszug des Kapitalismus begann in England. Zur treibenden Kraft hinter der britischen Welteroberung wurden vor allem Unternehmen – insbesondere in einer Form, die im 17. Jahrhundert entstand und bis heute die Wirtschaft beherrscht: die Aktiengesellschaft. Das Erfolgsgeheimnis der Aktiengesellschaft ist die Verteilung der Geschäftsrisiken auf viele Schultern und die Möglichkeit, Kapital für Investitionen einzusammeln.Eine Variante dieser Geschäftsidee stellen heute Investmentfonds wie die amerikanische Firma Blackrock dar. Sie verwaltet ein Vermögen von über sieben Billionen Dollar. Über globale Unternehmensbeteiligungen hat sie mehr Einfluss auf die Wirtschaft als manche Regierung – ein „heimlicher Herrscher“ wie einst die Britische Ostindienkompanie. Marktwirtschaft und freier Handel sind relative moderne Ideen. Erst im ausgehenden 18. Jahrhundert kommt der Schotte Adam Smith auf den damals revolutionären Gedanken, dass nur ein freier Markt Wohlstand für viele sichern und steigern könne. Grundlage dafür ist eine natürliche, wenn auch keine besonders sympathische Anlage des Menschen: sein Streben nach Eigennutz. Aber wenn jeder innerhalb gesetzter Grenzen seinen Eigennutz verfolge, diene das am Ende der Gesellschaft als ganzer, so die zentrale Botschaft in Adam Smiths „Der Wohlstand der Nationen“ (1776). Diese Idee fällt in eine Zeit, in der der Siegeszug der Dampfmaschine beginnt. In Großbritannien hält sie zunächst in der Textilindustrie Einzug, danach folgen Lokomotiven. Die Eisenbahn wird zur wichtigsten Triebkraft der Industrialisierung. Der dadurch geweckte Hunger nach Kohle und Stahl befeuert ein nie dagewesenes Wachstum von Bevölkerung, Städten und Wirtschaft. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen die USA mit dem Bau transkontinentaler Bahnlinien. Mit seiner „Central Pacific Railroad Company“ wird der für rüde Methoden bekannte Leland Stanford zu einem reichen Mann. Sein Vermögen steckt er unter anderem in die Gründung einer Universität, der Stanford University. Denn der Selfmademan weiß, dass die wichtigste aller Ressourcen die menschliche Kreativität ist und gefördert werden muss. Ein Jahrhundert später wird der Campus in Kalifornien zur Keimzelle der nächsten technologischen Revolution: Die im Umfeld der Universität angesiedelten Unternehmen wie Intel, Apple, Facebook, Google und dergleichen sind die Nachfolger der innovativen und risikobereiten Stahl- und Eisenbahngiganten früherer Zeiten. Ihre Gründer zählen heute zu den reichsten Menschen der Welt. Auch der Hunger nach Rohstoffen hat immer schon Milliardäre hervorgebracht – wie John D. Rockefeller, der mit einem Vermögen von 350 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Geschichte ist. Er verdankt seinen Reichtum dem „schwarzen Gold“. Bis heute deckt Öl 40 Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs. Das soll sich in Zukunft zwar ändern, aber die alternative Elektromobilität eröffnet einen neuen Wettlauf um Rohstoffe wie etwa Kobalt, einer der wichtigsten Bestandteile von Batterien. Sein Preis hat sich binnen weniger Jahre verdreifacht. Da die größten Kobalt-Vorkommen im Kongo liegen, ist unter Investoren ein neuer „Wettlauf um Afrika“ entbrannt. Der Kontinent, der jahrhundertelang von Europäern ausgebeutet wurde, ist bis heute das weltweite Schlusslicht der ökonomischen Entwicklung. Dort ist Armut – wie auch in vielen anderen Weltgegenden – eine generationenübergreifende Erfahrung. Aktuell jedenfalls verfügen die sieben führenden Wirtschaftsnationen über 90 Prozent der globalen Ressourcen, obwohl in ihnen nur zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Berühmtester und schärfster Kritiker der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ist bis heute Karl Marx (1818–1883). Für ihn ist die menschliche Geschichte ausschließlich durch unterschiedliche „Produktionsverhältnisse“ und die damit fast immer verbundene ungerechte Verteilung von Wohlstand bestimmt. In seiner Zeit sind es die Proletarier, die weitgehend rechtlosen Fabrikarbeiter, die den Reichtum der Fabrikbesitzer mehren und selbst im Elend leben. Anders als Adam Smith ist Marx der Meinung, dass Privateigentum keinen Wohlstand für alle schafft, sondern die sozialen Gegensätze im Gegenteil noch verschärft. Seine Lösung: die klassenlose Gesellschaft, in der Privateigentum weitgehend abgeschafft ist. Doch die politische Umsetzung seiner Ideen ist fast überall auf der Welt gescheitert, und der Kapitalismus ist als einzige dominierende Wirtschaftsform übriggeblieben. Zweifellos kann die freie Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Industriestaaten auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurückblicken. Sie hat eine Mittelschichtsgesellschaft geschaffen, in der erstmals die Mehrheit der Bevölkerung auch über einen Großteil des Vermögens verfügt. Doch inzwischen gibt es immer mehr Anzeichen dafür, dass der Zenit dieser Erfolgsgeschichte überschritten ist: Die Schere zwischen Arm und Reich nimmt wieder zu. Verdienten US-Chefs 1980 im Schnitt rund 30 Mal mehr als ihre Angestellten, liegt ihr mittleres Einkommen heute rund 300 Mal höher. Wenn Menschen die Gelegenheit haben, sich zu bereichern, sinkt bei den meisten nachweisbar die Moral. Das zeigen vielfältige verhaltenspsychologische Tests. Die Finanzmärkte, die mehr und mehr von der Realwirtschaft entkoppelt sind, verstärken nicht nur die Schere zwischen Arm und Reich, sie erschüttern durch ihre zyklischen Krisen auch das Vertrauen in die Marktwirtschaft insgesamt. Nicht nur die Erderwärmung stellt die auf Wachstum basierende Ökonomie infrage. 2020 bringt das Coronavirus große Teile des Wirtschaftslebens in wenigen Wochen zum Stillstand. Das Virus führt vor Augen, wie anfällig das System ist. Ist der Kapitalismus am Ende? Die Bilanz, die Dirk Steffens zieht, fällt zwiespältig aus. Insgesamt haben Armut und Rückständigkeit auf der Welt während der letzten Jahrzehnte ständig abgenommen. Das ist ein Fortschritt. Aber: Der Reichtum der Reichen wächst schneller, als die Armut der Armen abnimmt. Das zu ändern wird eine der großen Herausforderungen für die Politik der kommenden Jahrzehnte sein. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 19.05.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 20.05.2021 3sat Wesen aus der Tiefe – Tintenfische
Wettlauf um die Weltspitze – Die Erstbesteigung des Mount Everest
Wettlauf zur Venus
Es ist ein astronomisches Abenteuer ersten Ranges, aber auch eine wildbewegte Höllenfahrt entschlossener Männer bis ans Ende der damaligen Welt. (Text: Phoenix)Die Wiederkehr des Pharao
45 Min.Es ist ein Bau der Superlative. Es ist der größte Tempel, der je für einen Pharao erbaut wurde. Seine Fertigstellung dauerte fast drei Jahrzehnte und in seinem Inneren wurden mehr als 1000 Statuen aufgestellt. Als die Ägyptologin Hourig Sourouzian vor mehr als zehn Jahren die Arbeiten am Totentempel Amenophis III. aufnahm, waren nur noch zwei Kolossalstatuen des Pharaos, die so genannten Memnonkolosse, von der gigantischen Anlage zu sehen. Denn um 1220 vor Christus, wenige Jahrzehnte nach seiner Fertigstellung, zerstörte ein Erdbeben große Teile des Tempels.In den folgenden Jahrhunderten diente er als Steinbruch für die umliegenden Bauten anderer Pharaonen. Auch in der Neuzeit wurden noch unzählige Statuen von dem Areal entfernt. Sie sind heute über Museen in der ganzen Welt verstreut, wie die löwenköpfige Göttin Sachmet, von der einst 730 Skulpturen das Gebäude zierten. Wegen des fortschreitenden Zerfalls setzte die „World Monuments Watch“ die Reste des Tempels auf die Liste der 100 am meisten gefährdeten Denkmäler der Welt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Do. 02.06.2011 ZDF Wie Elefanten denken
45 Min.Forscher sind sich mittlerweile einig: Elefanten sind viel intelligenter, als wir je vermutet hätten. „Terra X“ zeigt in atemberaubenden Bildern, was und wie die grauen Riesen denken. Elefantenherden umgehen offenbar ganz gezielt Gebiete, in denen Wilderer lauern, und vermeiden auch sonst gefährliche Kontakte zu Menschen. Die Entdeckung dieses einzigartigen Verhaltens machten Wildbiologen eher zufällig bei einer Zählung vom Flugzeug aus. Diese ungewöhnlichen Wanderbewegungen der Tiere inspirierten die Wissenschaftler zu immer neuen Forschungsprojekten, in deren Verlauf weitere, völlig unerwartete Fähigkeiten der Elefanten entdeckt wurden.Beispielsweise arbeiten die gigantischen Rüsselträger im Team zusammen und teilen einander Erfahrungen und neue Erkenntnisse mit. Elefanten können im Test die komplexesten Probleme lösen und erkennen sich selbst im Spiegel eine Leistung, die man bislang nur von Menschenaffen und Delfinen kannte. Das Gefühlsleben der Tiere lässt sie entgegen der Bezeichnung „Dickhäuter“ als äußerst sensibel erscheinen. Untersuchungen zufolge empfinden Elefanten Mitgefühl, Trauer, Freude, Furcht und Rachsucht. Die Forscher sind mittlerweile davon überzeugt, dass Elefanten zu den intelligentesten und komplexesten Tieren überhaupt zählen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 10.01.2016 ZDF Wilder Planet: 01. Das Beben von San Francisco
45 Min.Am Morgen des 18. April 1906 erschüttert ein schweres Beben San Francisco: Häuser stürzen ein, die Erde öffnet sich und verschlingt ganze Straßenzüge. Über 3000 Menschen sterben. Das Beben der Stärke 7,9 auf der Richterskala ist das schwerste der amerikanischen Geschichte. Noch größer ist die Katastrophe, die folgt. Feuer bricht aus und erfasst beinahe das gesamte Stadtgebiet. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 02.04.2006 ZDF Wilder Planet: 02. Krakatau – ein Vulkan verändert die Welt
45 Min.Die Explosion des Krakatau im Jahre 1883 war einer der gewaltigsten Vulkanausbrüche der Neuzeit und eine Katastrophe globalen Ausmaßes. Auf den umliegenden indonesischen Inseln starben über 30 000 Menschen durch eine verheerende Flutwelle, die der Ausbruch verursachte. Das ZDF-Doku-Drama „Krakatau – ein Vulkan verändert die Welt“ zeigt die spannenden Ereignisse vor und nach der vernichtenden Explosion. Mit fesselnden Spielszenen und atemberaubenden Computeranimationen zeichnet der Film die genaue Chronik der Katastrophe nach.Forscher liefern überraschende Fakten und Hintergründe, die belegen, dass globale Naturkatastrophen keine Einzelfälle sind und sich in Zukunft wiederholen können. Am 27. August 1883 explodiert die Vulkaninsel Krakatau vor den Küsten Indonesiens. Es ist einer der gewaltigsten Vulkanausbrüche der Neuzeit. Asche und Gestein werden kilometerhoch in die Luft geschleudert. Zwei Drittel der Insel versinken im Meer und lösen einen verheerenden Tsunami aus. Die Flutwelle ist doppelt so hoch wie diejenige vom Dezember 2004 und überrollt die Küsten von Java und Sumatra. 36 000 Menschen sterben. Die Katastrophe ereignet sich fernab der Zentren westlicher Zivilisation, und doch sind ihre Folgen weltweit spürbar. Die Explosion ist so laut, dass sie noch im über 2000 Kilometer entfernten Australien zu hören ist. Im Roten Meer regnet es Asche, in Washington spielen die Barometer verrückt, und über Europa kann man ungewöhnlich farbenprächtige Sonnenuntergänge beobachten. Der Ausbruch des Krakatau wird als erste Naturkatastrophe zum globalen Medienereignis. Möglich ist dies durch ein erdumspannendes Telegrafennetz, das erst einige Jahre zuvor eingerichtet wurde. Wenige Stunden nach der verheerenden Explosion verbreiten sich die ersten Nachrichten rund um die Welt. Erschreckend deutlich sind die Parallelen zur Flutkatastrophe in Indonesien 2004. Im Film werden die Zuschauer ins späte 19. Jahrhundert zurückversetzt und erleben die Tage vor und nach dem Ausbruch des Krakatau durch die Augen der Menschen, die das Desaster überlebten. Neben Tagebuchnotizen und Augenzeugenberichten stützt sich der Film auf Studien von Wissenschaftlern, die sich schon damals in Lebensgefahr begaben, um die unfassbaren Naturgewalten zu ergründen. Zudem bewerten renommierte Forscher die globale Katastrophe aus heutiger Sicht. Warum brach der Krakatau mit einer so ungeheuren Wucht aus? Wieso werden die Menschen in Indonesien immer wieder von schrecklichen Naturkatastrophen heimgesucht? Tatsächlich liegt Krakatau nur 2000 Kilometer entfernt von den verheerenden Erdbeben, die bis heute unfassbares Leid über die südasiatische Bevölkerung bringen. Die Geschehnisse zeigen, dass solche Katastrophen keine Einzelfälle in der Geschichte der Menschheit sind. Mit ergreifenden Schicksalen, atemberaubenden Computeranimationen und erstaunlichen Erkenntnissen beleuchtet „Krakatau – ein Vulkan verändert die Welt“ einen Teil der Vergangenheit, der schon fast in Vergessenheit geraten war, der jedoch eine Warnung für die Zukunft bleiben sollte. Am Mittwoch, 26. Mai 2010, um 20:15 Uhr in „Terra X – Wilder Planet“: Die Sintflut – Mythos oder Wahrheit. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 23.07.2006 ZDF Wilder Planet: 03. Die Sintflut – Mythos oder Wahrheit
45 Min.Die Bibel erzählt von einer furchtbaren Katastrophe, die alles Leben auf Erden zerstörte: die Sintflut. Es regnete 40 Tage und 40 Nächte, das Wasser überflutete die Erde und stieg so gewaltig an, dass selbst die höchsten Berge darin versanken. So kennen wir die Geschichte. In diesen Tagen rückt die biblische Katastrophe als aktuelles Szenario erschreckend in unser Bewusstsein. In der neuesten UN-Klimastudie kommt die Wissenschaft zu dem Ergebnis, dass der bislang in weite Zukunft geschobene Klimawandel infolge der fortschreitenden Erderwärmung bereits unmittelbar bevorsteht.Anlass, sich auf die Spuren der Vergangenheit zu begeben, zu fragen, ob sich die Sintflut vor Tausenden von Jahren tatsächlich ereignet hat oder ob sie bloß eine Legende ist. Sintflutszenen aus unseren Tagen sind bekannt: Turmhohe Tsunami-Wellen, unberechenbare Springfluten, tosende Taifune – Flüsse schwellen zu reißenden Gewässern an, Wirbelstürme peitschen den Ozean landeinwärts. Seit Jahrzehnten erlebt die Welt sich häufende Wetterkatastrophen, Hochwasser und Überschwemmungen. Vorboten einer neuen globalen Katastrophe. Die Szenarien erinnern an das Gilgamesch-Epos. Der Urmythos der Menschheit berichtet von einer gigantischen Überschwemmung, zweitausend Jahre vor der Bibel, vor Noah und dem Bau der Arche. Weltweit existieren aus dieser Zeit Hunderte von Flutmythen, auf allen Erdteilen, bei nahezu allen Völkern. Seltsamer Zufall oder verschwommene Zeugnisse einer urzeitlichen Menschheitstragödie? Regisseur Martin Papirowski und Autorin Dr. Heike Nelsen-Minkenberg begeben sich auf eine wissenschaftliche Spurensuche, die von den Ufern des Schwarzen Meeres bis nach Australien führt, den Bogen von den Keilschrifttafeln des Gilgamesch-Epos bis in die Labore der modernen Klimaforschung spannt. Zentrale Objekte der Beweisführung sind Bohrkerne, die auf faszinierenden Tauchfahrten aus dem Boden des Schwarzen Meeres entnommen werden und den lange erwarteten Beleg für den rasanten Übergang von einem Süßwassersee zu einem ausgedehnten Salzwassermeer liefern. Archäologische Grabungen in der Schwarzmeerregion öffnen dem Zuschauer ein Zeitfenster in die Jungsteinzeit, das Neolithikum. Sie geben einen Einblick in den Alltag der Menschen zur Zeit der großen Flut, der Schwarzmeerkatastrophe. Während der letzten Eiszeit ist das Schwarze Meer ein riesiger Süßwassersee, doch dann, vor etwa 8000 Jahren steigen die Temperaturen, die gigantischen Eispanzer, die die nördliche Erdhalbkugel zu großen Teilen bedecken, beginnen zu schmelzen, und die Wasserspiegel der Meere steigen und steigen. Das Schwarze Meer wird plötzlich überflutet. Hunderttausende von Menschen werden vertrieben, sie flüchten vor den allgegenwärtigen Fluten, verlieren alles, ein Trauma, dass zur Legende wird – zum Sintflut-Mythos, soweit die Theorie. Sie entfacht eine hitzige wissenschaftliche Debatte, teilt die Wissenschaft in zwei Lager. Doch dann, zehn Jahre nach ihrer Entstehung, geschieht das Unerwartete: Der junge Forscher Mark Sidall entwickelt in Bern eine Computersimulation des Szenarios, die sämtliche Bedenken vom Tisch fegt. Die „Mutter aller Mythen“, die Sintflut ist fast so etwas wie ein biblischer Tatsachenbericht und doch nur eine von Hunderten von Flutlegenden weltweit. Katastrophen der Vergangenheit – doch wie sehen Wissenschaftler unsere Zukunft? So viel steht fest: Die nächste Sintflut haben Menschen zu verantworten, und die Forscher warnen, es sei kurz „vor Zwölf“. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 22.04.2007 ZDF Wilder Planet: 04. Mega-Vulkane – Feuer aus dem Bauch der Erde
45 Min.Seit Urzeiten gibt die Erde feurige Lebenszeichen von sich. Wenn aus ihrem Bauch glutflüssiges Magma nach oben steigt und als heißer Brei durch die Erdkruste bricht, entsteht aus den erkalteten Gesteinsmassen ein Vulkan. Die gewaltigen Kräfte der rauchenden Riesen formen nicht nur Landschaften, sie lassen auch Kulturen erblühen und vergehen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 29.04.2007 ZDF Wilder Planet: 05. Das große Beben
45 Min.Europas Städte stehen nicht so sicher wie vermutet – denn die Erde unter dem Kontinent bebt immer wieder. Wissenschaftler versuchen fieberhaft, die Wahrscheinlichkeit neuer Katastrophen zu ermitteln. Hinweise für eine solche Einschätzung liefert die Vergangenheit. Das Beben von Basel aus dem Jahr 1356 ist historisch am besten dokumentiert. Der Seismologe Flavio Anselmetti konnte außerdem eine Reihe von Beben nachweisen, die Tsunamis auf dem Vierwaldstädtersee auslösten. Noch gibt es jedoch keine Möglichkeit vorherzusagen, wann in Europa mit weiteren Beben zu rechnen ist. (Text: History)Deutsche TV-Premiere So. 21.10.2007 ZDF Wilder Planet: 06. Sturmwarnung
45 Min.Seit Anfang Juni sind die Menschen in der Karibik und an der Ostküste der USA wieder in Alarmbereitschaft: Essensvorräte werden angelegt. Bretter liegen bereit, um im Notfall das eigene Haus zu verbarrikadieren. Fluchtrouten sind geplant, wenn der Hurrikan sein Auge öffnet. Dieses Jahr haben die tropischen Wirbelstürme „Dean“ und „Felix“ mit Windgeschwindigkeiten von bis 270 km/h bereits die Menschen das Fürchten gelehrt. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 28.10.2007 ZDF Wilder Planet: 07. Pulverfass Vesuv
45 Min.Seit 64 Jahren hat sich der Vesuv nicht mehr gerührt. Manche Experten mahnen: Ein Ausbruch ist längst überfällig, und sie zeichnen ein Katastrophenszenario, das selbst das antike Vesuv-Desaster von Pompeji weit übertrifft. Über drei Millionen Menschen leben heute in unmittelbarer Nachbarschaft des Feuerberges. Und nicht nur sie wären von der Katastrophe betroffen, auch weite Teile Europas und das Weltklima – so die Vision. Doch wie wahrscheinlich ist eine solche Katastrophe? (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Di. 06.05.2008 arte Wilder Planet: 08. Bebenalarm in Tokio
45 Min.Tokio ist die größte Stadt der Welt und gleichzeitig die wohl am meisten gefährdete. Nur wenige Kilometer von der 37-Millionen-Metropole entfernt treffen drei Kontinentalplatten aufeinander. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere Mi. 07.05.2008 arte Wilder Planet: 09. Extremwetter über Europa
45 Min.Naturkatastrophen lassen den Menschen bis heute Verletzlichkeit und Ohnmacht spüren, denn niemand weiß, wann und wo sie passieren und welche Ausmaße sie annehmen. Selbst die modernste Wissenschaft kann keine verlässlichen Angaben darüber machen. Ihr bleibt nur, mögliche Szenarien zu entwerfen. Die Dokumentation rückt die Wetterphänomene in den Mittelpunkt. Gezeigt wird unter anderem, dass es im Verlauf der letzten 20 Jahre eine Häufung von Extremwetterlagen auch in Europa gegeben hat. Und Wissenschaftler spielen durch, welche Schäden das Wetter in Zukunft noch anrichten könnte. (Text: arte)Deutsche TV-Premiere Do. 05.02.2009 arte Wilder Planet: 10. Mit Feuer und Flut
45 Min.Naturgewalten sind unberechenbar. Sobald die Naturgewalt Wetter ihre gewohnten Bahnen verlässt, ist sie imstande regelrechte Katastrophen auszulösen – auch Europa blieb von solchen Schicksalsschlägen in der jüngsten Vergangenheit nicht verschont. Orkane, Starkniederschläge, extreme Hitze- und Kälteperioden, all das hat es auch in Europa gegeben. Wissenschaftler mahnen: Unwetter können sich in Zukunft häufen. Noch nie war die Erde so dicht besiedelt und waren so viele Menschen vom Wetter abhängig wie heute. Droht Europa eine bislang ungeahnte Wetterkatastrophe, und wie wahrscheinlich ist eine solche Katastrophe? Am Leibniz-Institut für Meereswissenschaften an der Universität KielKiel gehen Wissenschaftler von internationalem Rang diesen Fragen nach. Sie spielen durch, wie sich einzelne Extremwetter-Ereignisse binnen weniger Monate zu einer fatalen Kombination reihen und ein Megadesaster von kontinentalem Ausmaß verursachen können. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere So. 05.07.2009 ZDF Wilder Planet: 11. Gefahr für Lissabon
45 Min.An Allerheiligen 1755 erschüttert ein starkes Erdbeben den Meeresgrund vor der portugiesischen Küste. Als die gut gefüllten Kirchen von Lissabon einstürzen, sterben tausende Menschen, und viele, die sich aus den Gebäuden retten können, werden von Tsunamiwellen erfasst. In den Kirchen umgestürzte Leuchter, bestückt mit Tausenden von Kerzen, lösen verheerende Brände aus. Niemand weiß, wie viele Menschen wirklich durch das Beben starben. Ein Forscherteam versucht herauszufinden, was bei der Katastrophe geschah, und spürt potentielle Gefahrenquellen in der Tiefe auf. (Text: History)Deutsche TV-Premiere So. 12.07.2009 ZDF Wilder Planet: 12. Vulkane
45 Min.Vulkane faszinieren den Menschen schon immer. Ein eben noch friedlicher Berg verwandelt sich zum todbringenden Feuerspucker. Vulkanasche verdunkelt den Himmel, und rotglühende Lava bahnt sich pulsierend ihren Weg. Aus der Ferne betrachtet mögen Vulkanausbrüche spektakuläre Naturschauspiele sein, nicht selten jedoch werden sie zum tödlichen Inferno für Mensch und Tier. Insgesamt 1900 Vulkane gelten heute nach Meinung von Wissenschaftlern als aktiv und könnten jederzeit ausbrechen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres meldeten sich einige Feuerberge mit Eruptionen zurück, unter anderem der Ätna auf Sizilien und der Sakura-jima in Japan.Die erste Folge der „Terra X“-Reihe „Wilder Planet“ dokumentiert, welche Bedeutung die Feuerberge für uns heute haben und wie moderne Forscher versuchen, den rätselhaften Glutriesen ihre letzten Geheimnisse zu entreißen. Weitgehend unbekannt ist beispielsweise der Nyragongo in der Republik Kongo. In 3500 Meter Höhe brodelt in seinem Krater ein 1000 Grad Celsius heißer Lavasee – ein außergewöhnliches Naturschauspiel und zugleich einer der größten natürlichen Umweltverschmutzer der Welt. Täglich spuckt der Vulkan so viel Schwefeldioxid aus wie alle anderen Vulkane der Erde zusammen. Auch die gesamte europäische Industrie hat ungefähr den gleichen Ausstoß wie der Klimakiller. Aber nicht nur die Luft verpestet der Feuerberg. Zu dem Vulkankomplex gehört auch der rund 2500 Quadratkilometer große Kiwusee. In diesem Gewässer haben sich im Lauf der Zeit riesige Mengen Kohlendioxid und Methan angesammelt. Die Wissenschaftler fürchten nun, dass bei einer größeren Eruption die Gase plötzlich freigesetzt werden könnten. Die geruch- und farblose, tödliche Wolke wäre schwerer als Luft und würde direkt über dem Boden dahintreiben und alles Leben auf ihrem Weg auslöschen. Das „Terra X“-Team begleitet den italienischen Vulkanologen Dario Tedesco bei seiner gefährlichen Expedition in den Krater und trifft den deutschen Physiker Klaus Peter Tietze, der eine Möglichkeit sucht, den tödlichen See zu entgasen. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.04.2013 ZDFneo Wilder Planet: 13. Erdbeben
45 Min.In vielen Ländern der Erde ist die Bevölkerung so an Erdbeben gewöhnt, dass ein kurzes Rucken des Bodens kaum mehr wahrgenommen wird. In Kalifornien oder Chile stellen sich Vorsichtige möglicherweise kurz unter einen Türsturz, aber kaum hat das Wackeln aufgehört, geht jeder wieder seiner Wege. Beben gehören zum Alltag, man blendet sie aus als Irritation wie anderswo auf der Welt Auto- oder Fluglärm. In Europa dagegen hat man wenig Erfahrung mit Erdbeben, da die seismische Tätigkeit hier nicht besonders ausgeprägt ist.Spätestens seit der Reaktorkatastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima hat die Diskussion um die Erdbebensicherheit von Städten, Gebäuden und gerade auch Atomreaktoren jedoch weltweit eine neue Brisanz erreicht. Die Auswirkungen eines Bebens können nicht länger als lokal oder regional gelten, sondern müssen als globale Phänomene betrachtet werden. Wissenschaftler versuchen daher weltweit die Mechanismen zu erforschen, die Beben verursachen. Sie hoffen, Technologien zu entwickeln, die einen besseren Erdbebenschutz ermöglichen. Im zweiten Teil der „Terra X“-Reihe „Wilder Planet“ besucht das ZDF-Team Forscher in den seismisch aktivsten Gebieten der Erde. In Chile untersucht beispielsweise der Geophysiker Prof. Dr. Stephen Miller von der Universität Bonn mit seinem Team eine Region in den Chilenischen Anden. In dieser seismisch hochaktiven Gegend stellen die Wissenschaftler erstaunliche Dinge fest. 2010 hatte ein Erdbeben der Magnitude 8,8 den Seeboden vor der Küste Chiles erschüttert. Der Boden brach auf einer Länge von mehreren 100 Kilometern auf und hätte eigentlich einen gewaltigen Tsunami auslösen müssen. In Panik flüchteten die Bewohner aus der Küstenregion, doch wie durch ein Wunder blieb der Tsunami aus. Der Grund dafür: Das Beben selbst verhinderte die Katastrophe. Innerhalb weniger Sekunden hob es die Küste um 2,5 Meter und errichtete so einen Schutzwall gegen die Überflutung. Solche überraschenden Beobachtungen machen deutlich, wie wenig vorhersehbar die gewaltigen Kräfte der Erde noch immer sind. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.04.2013 ZDFneo Wilder Planet: 14. Stürme
45 Min.Zyklone, Taifune, Tornados, Hurrikans – immer häufiger sorgt die ungeheure Zerstörungskraft solcher Luftgiganten für Schlagzeilen. Mit einer Breite von über 80 Kilometern und Wandergeschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde kann beispielsweise ein einziger Zyklon jede Sekunde mehr als eine Million Kubikmeter Erdatmosphäre durcheinanderbringen. Die Schäden, die die Sturmriesen jährlich verursachen, gehen in die Milliarden. Darüber hinaus sind nach Schätzungen amerikanischer Wissenschaftler den großen Stürmen im vergangenen Jahrhundert mehr als eine halbe Million Menschen zum Opfer gefallen.Im dritten Teil der „Terra X“-Reihe „Wilder Planet“ präsentieren Forscher neueste Ergebnisse der Windforschung. Wie funktioniert ein großer Sturm? Welche Bedeutung haben die Windriesen für das Weltklima? Wird es in Zukunft möglich sein, den Weg großer Stürme besser vorherzusagen und so präziser warnen zu können? Gelingt es gar, die Windgiganten mit neuer Technologie zu zähmen? Sobald sich ein Hurrikan der Küste Floridas nähert, steigen die Hurricane Hunters in ihren kleinen, wendigen Flugzeugen auf und fliegen direkt ins Auge des Sturms hinein. Ihre gefährliche Mission ist es, die Windgeschwindigkeiten im Inneren des Hurrikans zu messen und die Daten an das National Hurrcane Center in Miami weiterzugeben. Diese Informationen ermöglichen es, Tropenstürme ab einer Entfernung von 260 Kilometern vor der Küste zu überwachen und Vorhersagen über ihren Verlauf und ihre Stärke zu machen. Die Flüge der Sturmpiloten können Leben retten, denn ihre präzisen Messdaten ermöglichen es den Experten, gezielt Warnungen an die Bevölkerung herauszugeben. In Chester County in South Carolina interessiert man sich nicht so sehr für Vorwarnsysteme, sondern mehr dafür, die Schäden, die ein Sturm verursachen kann, von vornherein zu minimieren. Hurrikans machen harmlose Gegenstände zu tödlichen Geschossen und reißen einfache Häuser in Stücke. Das „Terra X“-Team besucht den Windtunnel des Business and Home Safety Research Center. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.04.2013 ZDFneo Wilder Planet: 15. Wenn die Erde verrückt spielt
Erdbeben, Vulkane und Stürme. Seit Menschengedenken haben diese Naturphänomene unseren Planeten im Griff. Sie zerstören, töten, vernichten. Aber sie spenden auch Leben, schaffen neues Land und lassen Böden fruchtbar werden. Wir erleben sie gleichzeitig als faszinierende Naturschauspiele und heimtückische Bedrohung. Was sie am gefährlichsten macht, ist ihre Unberechenbarkeit. Um die Mechanismen des Planeten besser zu verstehen und so die nächste Naturkatastrophe möglichst rechtzeitig voraussagen zu können, sind Wissenschaftler der unterschiedlichsten Disziplinen ständig an den gefährlichsten Orten der Welt im Einsatz.Statt Erdbeben, Vulkane und Stürme nur als Einzelphänomene zu untersuchen, haben die Forscher seit einiger Zeit angefangen, diese Naturgewalten zunehmend als Ganzes zu betrachten. Dabei sind sie merkwürdigen Zusammenhängen auf die Spur gekommen: Offensichtlich bedingen sich viele Naturphänomene gegenseitig. In Chile untersucht beispielsweise der Geophysiker Stephen Miller von der Universität Bonn mit seinem Team eine Region in den chilenischen Anden. 2010 hatte ein gewaltiges Erdbeben den Seeboden vor der Küste Chiles erschüttert. Miller installierte Seismografen im Hinterland der Küstenregion, um zu beweisen, was Charles Darwin hier schon einmal vor 175 Jahren beobachtet hat: Erdbeben können Vulkanausbrüche verursachen. Wie genau die beiden Naturgewalten einander beeinflussen, untersuchen Miller und sein Team während einer Expedition zu Chiles aktivsten Feuerbergen. Die Beziehung von Erdbeben und Vulkanismus ist zwar noch nicht umfassend erforscht, aber zumindest legten viele Beobachtungen einen Zusammenhang nahe. Ganz neu ist jedoch die Entdeckung des Geophysikers Shimon Wdowinski von der Universität Miami, der den Nachweis erbracht hat, dass Stürme Riesenbeben verursachen können: Ein Beispiel ist der Taifun „Morakot“, der im August 2000 über Taiwan wütete. Nur ein halbes Jahr später erschütterte das stärkste Beben seit mehr als 100 Jahren den Südosten des Landes. „Morakot“ ließ binnen fünf Tagen knapp viermal so viel Wasser zu Boden prasseln, wie auf gleicher Fläche jährlich in Deutschland fällt. Die Sturzfluten entfesselten zahllose Erdlawinen. Gigantische Mengen Erdreich strömten auf diese Weise vom Festland ins Meer. Von der Last befreit, geriet der Untergrund in Bewegung. Die Erde bebte. Stürme scheinen weltweit durch den Transport großer Mengen von Erde, Sand und Wasser viel stärker auf die Oberfläche der Erde einzuwirken als bislang angenommen. Sie können nicht nur Erdbeben, sondern auch Vulkanausbrüche auslösen. Auch die Auswirkung großer Vulkane auf das weltweite Wettergeschehen ist ein wesentlicher Forschungsbereich. Der Vulkan Nyragongo ist in der vom Bürgerkrieg geschüttelten Republik Kongo für Forscher kaum erreichbar. Dabei halten die Wissenschaftler eine permanente Überwachung des Feuerbergs für dringend notwendig. In 3500 Meter Höhe brodelt in seinem Krater ein 1000 Grad Celsius heißer Lavasee – ein außergewöhnliches Naturschauspiel und zugleich einer der größten natürlichen Umweltverschmutzer der Welt. Täglich spuckt der Vulkan so viel Schwefeldioxid aus wie alle anderen Vulkane der Erde zusammen. Über die langfristigen Auswirkungen auf das Klima gibt es mittlerweile erste Erkenntnisse. Was jedoch ein Ausbruch des Giganten bedeuten würde, können die Wissenschaftler nur erahnen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 06.07.2014 ZDF Wilder Westen: 1. Wüste, Wasser, Wagnis – Der Colorado
Wildes Wetter – auf den Spuren der Klimaforschung
40 Min.Hitze, Dürre, Stürme und Fluten – das Wetter scheint weltweit wild geworden zu sein. Was sind die Ursachen? Ist die Häufung von Extremwetterlagen ein Zufall? Oder ist das schon Klimawandel? Wie hängen Hitzerekorde in Deutschland, Waldbrände in der Arktis und schmelzendes Packeis zusammen? Mit Experten der Klimaforschung erklärt der Film die wissenschaftlichen Fakten. Denn nur sie geben das Rüstzeug für ein verantwortungsvolles Handeln in der Zukunft. Die gesellschaftliche Debatte rund ums Klima ist überhitzt und oft überlagert von Einzelinteressen.„Terra X“ zeigt die Daten, Fakten und Zahlen hinter dem, was aktuell diskutiert wird. Denn die Klimaforschung in all ihren Facetten ist eine Wissenschaft, deren Erkenntnisse helfen, die globalen Wetterphänomene besser zu verstehen. Neue Wege in der Forschung geht die deutsche Klimawissenschaftlerin Prof. Friederike Otto in Oxford. Sie sucht nach den Verantwortlichen für Hitzewellen und Hochwasser. Ihr Institut hat eine bahnbrechende Methode entwickelt, mit der sie in kurzer Zeit berechnen kann, wie viel Klimawandel in einem konkreten Wetterereignis steckt – und wer daran schuld ist. In der Dokumentation erklärt die Direktorin des Environmental Change Institute, wie Wetterphänomene entstehen und wie die Verursacher dafür in Zukunft möglicherweise haftbar gemacht werden können. Einen anderen Forschungsansatz verfolgt die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Im September 2019 nimmt der deutsche Eisbrecher „Polarstern“ seine Reise auf. Ein Jahr lang soll das Schiff eingefroren durch das Nordpolarmeer driften. Expeditionsleiter Prof. Markus Rex und sein Team wollen den Einfluss der Arktis auf das globale Wetter besser verstehen. Dort befindet sich quasi das Epizentrum der globalen Erwärmung. Etwa 600 Menschen aus 19 Nationen sind an dem Projekt beteiligt. Sie alle hoffen auf einen Durchbruch im Verständnis des arktischen Klimasystems. Es sind ganz unterschiedliche Bereiche, die an der Forschung zum Klimawandel beteiligt sind. So ist auch in der Kommunikationswissenschaft das politisch relevante Thema angekommen. Prof. Michael Brüggemann untersucht, wie in den Medien über den Klimawandel berichtet wird. Welche Szenarien überfordern die Menschen? Und wie könnte ein Umdenken funktionieren? Mit Erklär-Grafiken, anschaulichen Experimenten und Experteninterviews fügt „Terra X“ die aktuelle Forschungssituation zu einem erhellenden Gesamtbild zusammen – ganz ohne Alarmismus. Denn es geht nicht um Panikmache, sondern um die Vorbereitung auf die Veränderungen, die auf den Planeten und seine Bewohner zukommen werden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Do. 17.10.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 20.10.2019 ZDF Wilde Wasser – In den Schluchten des Isonzo
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.