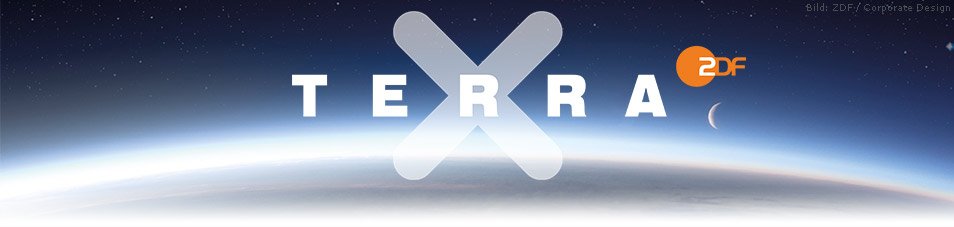1524 Folgen erfasst (Seite 58)
Verschollen im Sandmeer – Die Armee des Kambyses
Versunkene Metropolen: 1. Operation Piramesse – Ramses’ verschollene Megacity
45 Min.Als der französische Ägyptologe Pierre Montet in den 1920er Jahren mit Ausgrabungen in Tanis im Nildelta begann, sah er sich am Ziel seiner Träume: Der Wissenschaftler glaubte, er habe Piramesse, die verschollene Hauptstadt Ramses’ des Großen, entdeckt. Denn auf dem weitläufigen Gelände fand er mehr als 100 gigantische Statuen des berühmten Pharaos, die allesamt seinen Namen trugen. Von den Fundamenten der Monumente, von Tempeln und Gebäuden aus der Zeit des ägyptischen Regenten fehlte allerdings jede Spur. Der Befund machte einige Zeitgenossen Montets stutzig, weist er doch darauf hin, dass Piramesse nicht mit Tanis identisch sein konnte.Über Jahrtausende rankten sich Legenden um die Metropole im östlichen Nildelta. Fest steht: Schon Sethos I. hatte mit dem Bau begonnen, sein Sohn Ramses II. vollendete das Mammutwerk und machte Piramesse 1269 vor Christus zum Regierungssitz. Hymnen preisen die Schönheit und Pracht der Hafenstadt. Etwa 300.000 Einwohner lebten dort auf einer Fläche von mehr als 30 Quadratkilometern. Doch wie konnte eine Megacity völlig verschwinden? Und was bedeuten die Granitkolosse in Tanis? Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts gelang es Wissenschaftlern, das Rätsel zu lösen. Der österreichische Archäologe Manfred Bietak stieß 30 Kilometer von Tanis entfernt auf die Ruinen der Ramses-Residenz. Zusammen mit seinem deutschen Kollegen Edgar Pusch gräbt er seither in dem riesigen Areal. Die systematische Freilegung von Piramesse brachte die Überreste von großen Tempeln, Palästen und Wohngebäuden aus Lehmziegeln zutage. Bis lang nach dem Tod Ramses’ des Großen war die Stadt bewohnt, dann versandete der Pelusische Nilarm. Ohne Wasser fehlte der Hafenmetropole die Lebensgrundlage. So errichtete die nachfolgende Dynastie der Bubastiden an einem anderen Nilarm, nämlich in Tanis, ihr Machtzentrum. Die riesigen Statuen und die Obelisken des Pharaos transportierten die Ägypter ab und stellten sie an dem neuen Ort wieder auf. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere So. 24.06.2007 ZDF Versunkene Metropolen: 2. Brennpunkt Hattusa – Machtzentrale der Hethiter
45 Min.1906 brach der deutsche Gelehrte Hugo Winckler zu einer Expedition nach Boghazköy in Anatolien auf. Jahrzehnte zuvor hatte ein französischer Archäologe 150 Kilometer östlich des heutigen Ankara eine Ruinenstätte mit mächtigen Mauern und majestätischen Löwentoren entdeckt. Doch niemand konnte die Trutzburg damals einem Herrschergeschlecht zuordnen. Nachdem 1893 Tontafeln von Boghazköy in die Hände europäischer Wissenschaftler gelangten, geriet der abgelegene Ort ins Visier der Forschung. Denn die uralten Dokumente waren zwar in lesbarer Keilschrift, jedoch in einer unverständlichen Sprache geschrieben.Ähnliche Exemplare tauchten auch in Syrien und Kleinasien auf, und alle benannten einen „König von Arzawa“. Der Name ließ die Experten aufhorchen, erschien er doch auch in den sogenannten Amarna-Briefen des ägyptischen Pharaos Echnaton. Schon 1905 hatte Winckler auf einer kurzen Erkundungstour in der verlassenen Festung 34 Tontafeln geborgen, vermochte sie aber nicht zu entschlüsseln. Doch diesmal gruben seine Arbeiter unzählige weitere Exemplare aus, die im bereits bekannten Akkadisch, der Diplomatensprache des Alten Orients, abgefasst waren. Dem Professor, der Keilschrift und Akkadisch flüssig las und verstand, fiel es wie Schuppen von den Augen: Er hatte die politische Korrespondenz der Hethiter vor sich. Als Highlight fand Winckler sogar eine Abschrift des ältesten beurkundeten Friedensvertrags der Weltgeschichte. Darin besiegeln der Hethiterkönig Hattusili und Pharao Ramses II. ewige Freundschaft zwischen dem Land Hatti und Ägypten. Eine wissenschaftliche Sensation und zugleich der Beweis: Boghazköy musste Hattusa sein, die Hauptstadt eines vergessenen Weltreichs. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere So. 01.07.2007 ZDF Versunkene Metropolen: 3. Tatort Tucumé – Pyramidenstadt in Peru
45 Min.Das Volk der Lambayeque gehörte zu den großen Baumeistern des Altertums. Im Norden von Peru ließ die alte Kultur 250 kolossale Pyramiden in den Himmel wachsen. Nirgendwo sonst in Südamerika entstanden mehr Pyramiden als im Tal der Lambayeque. Doch plötzlich verschwand die Hochkultur, die grandiosen Stätten verfielen. Erst Jahrhunderte später sollten sie wieder entdeckt werden: Im September 1875 verschlägt es den Maschinenbau-Ingenieur Hans Heinrich Brüning in den Norden Perus. Durch Zufall beobachtet er dort, wie Einheimische einzigartige antike Kunstgegenstände einschmelzen.Der wissenschaftlich interessierte Deutsche macht sich sofort auf die Suche nach der Herkunft der goldenen Kostbarkeiten. Durch ihn erfährt die Welt erstmals vom Tal der Pyramiden. Dort gelingt einem internationalen Forscherteam im Sommer 2005 ein aufsehenerregender Fund. Die Ausgräber legen unweit eines Tempels 119 menschliche Skelette frei. Die Knochen weisen Anzeichen eines grausamen Opfertods auf: Männer, Frauen und Kinder wurden enthauptet. Den Gang zum Schafott legten sie freiwillig zurück. Eine Droge hatte ihren Körper betäubt, aber ihren Geist bei vollem Bewusstsein gehalten. Das Massaker deuten die Wissenschaftler als verzweifelten Versuch, die Götter zu besänftigen. Das Andenvolk fühlte sich offenbar von einer realen, übermächtigen Gefahr bedroht. Doch die blutigen Rituale konnten das Unheil nicht abwenden. Den Einwohnern blieb nur ein Ausweg: die Flucht. Sie brannten Tucumé nieder und verließen die Stadt. Das Ende einer Hochkultur. Denn mit den Flammen verlosch die jahrtausendealte Tradition des Pyramidenbaus in Peru. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere So. 08.07.2007 ZDF Versunkene Schätze
45 Min.Irgendwann Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus tobt vor der kleinasiatischen Küste, südwestlich der Hafenstadt Izmir ein gewaltiger Sturm. Ein mit 50 Tonnen Marmor beladener Segler ist den riesigen Wellen hilflos ausgeliefert. Seine kostbare Fracht macht ihn so gut wie bewegungsunfähig. Innerhalb weniger Minuten versinkt das Schiff mitsamt seiner Last. Dank moderner Technik lässt sich die Katastrophe minutiös rekapitulieren. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre eine solche Arbeit unmöglich gewesen. Zwar experimentierte der Mensch bereits seit dem 15. Jahrhundert mit Helmen und Anzügen, die ein längeres Abtauchen in nicht allzu tiefe Gewässer erlaubten, aber erst die rasanten Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts machen die Unterwasserarchäologie zu einem neuen, spannenden Feld der Wissenschaft.Wie Zeitkapseln halten Seen und Meere unzählige Überraschungen bereit, die nur darauf warten wiederentdeckt zu werden. Die versunkenen Schätze sind dabei so vielfältig wie die Gewässer, in denen sie liegen. Die Bandbreite reicht vom abgestürzten Kampfflugzeug der US-Luftwaffe im Österreichischen Traunsee, das aus 70 Metern Tiefe geborgen werden konnte, über geheimnisvolle Knochenfunde in den Cenote genannten Höhlensystemen Yucatans, die neuen Aufschluss über die Besiedelung Amerikas liefern, bis hin zu ganzen antiken Städten, die dem steigenden Meeresspiegel zum Opfer fielen, so etwa vor der Küste Ägyptens. Von der Entdeckung bis zur Bergung und anschließenden Konservierung der versunkenen Schätze können Jahrzehnte vergehen. Und so manches Wrack wird wohl – zumindest nach heutigen Erkenntnissen – für immer auf dem Grund des Meeres bleiben. „Terra X“ begleitet Taucher und Archäologen bei ihren spannenden Einsätzen weltweit und erkundet dabei zugleich die Geschichte der Unterwasserarchäologie von ihren Anfängen bis heute. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Fr. 18.04.2014 ZDF Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
60 Min.Der „Cuc Phuong National Park“ liegt südlich von Hanoi und ist berühmt für seine enorme, weitgehend unerforschte Artenvielfalt. Mai ist unterwegs mit einem deutsch-vietnamesischen Team, das Feldforschung betreibt.Bild: Maike Simon / ZDFVietnam – für viele ein Traumziel. „Wie fühlt es sich an, hier zu leben?“, fragt sich „Terra X“-Wissenschaftsmoderatorin Mai Thi Nguyen-Kim auf ihrer ersten langen Reise in dieses Land. In Deutschland geboren und aufgewachsen, kennt Mai Thi Nguyen-Kim Vietnam fast nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. Auf ihrem Roadtrip durch den lang gestreckten Küstenstaat taucht sie ein in die Kultur des Landes und lernt auch dessen Herausforderung kennen. Auf ihrer Reise begegnet Mai einem Land mit vielen Gesichtern – einem Land zwischen Tradition und Moderne, Chaos und Ruhe.Ihre Reise startet in im quirlig-bunten Hanoi, wo sie mitten im Moped-Gewimmel das „Vui“-Gefühl entdeckt – jenes typische Lebensgefühl der Vietnamesinnen und Vietnamesen zwischen Gelassenheit und Lebensfreude. Im Old Quarter taucht sie ein in das Labyrinth aus 36 Gassen, in denen Seide, Silber und Zimt zum Greifen nah sind. An jeder Ecke gibt es Streetfood-Läden, in denen gekocht und gebrutzelt wird. Überall duftet es nach Pho, einer traditionellen Suppe mit Reisnudeln und Kräutern. Spitzenkoch Hoang Tung verrät Nguyen-Kim das perfekte Rezept, das der Brühe den typischen Geschmack verleiht. Weiter führt ihre Route zum „Cuc Phuong National Park“, dem ältesten Nationalpark des Landes. Dort erforscht die Wissenschaftsjournalistin mit einem deutsch-vietnamesischen Team die enorme Artenvielfalt der Regenwälder. Mit Fotografinnen und Biologen hält sie die spektakulären Flugbahnen von Nachtfaltern fest – Kunst und Wissenschaft verschmelzen in der Dunkelheit des Dschungels. In der einstigen Kaiserstadt Huế spürt Mai dem Erbe der Nguyen-Dynastie nach. Zwischen Pagoden, Palästen und Laternen auf dem Parfümfluss erklärt sie, warum fast 40 Prozent der Vietnamesen ihren Familiennamen Nguyen teilen. Aber Huế hat neben der prächtigen auch noch eine andere Seite: Die Stadt ist regelmäßig durch Hochwasser bedroht und steht vor großen Herausforderungen: Mai trifft eine Umweltwissenschaftlerin, die in Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen die Folgen der Erderwärmung auf zukünftige Hochwasserereignisse untersucht, und erfährt, wie Huế sich gegen die Überflutungen rüstet. Unweit von Huế besucht Mai im Anschluss das eher unbekannte An Bang, die „Stadt der Geister“. Zwischen prunkvollen Mausoleen und bunten Drachenfiguren erfährt Mai, wie stark in Vietnam die Verbindung zu den Ahnen ist. In der sagenhaften Karstlandschaft von Trang An, auch die „trockene Halong-Bucht“ genannt, gleitet Mai mit dem Ruderboot durch Höhlen und über spiegelndes Wasser – ein stiller Gegenpol zum Trubel der Megacitys. Ein Ort, der darüber hinaus deutlich macht, wie eng Klima, Kultur und Überleben seit Jahrtausenden miteinander verwoben sind. Ihre Reise führt Mai auch in den Süden des Landes, nach Ho-Chi-Minh-Stadt, wie Saigon heute heißt. Inmitten von 14 Millionen Menschen entdeckt sie eine Metropole, die niemals ruht – ein brodelndes Mosaik aus Straßenküchen, Hochhäusern, Märkten und ungebremster Energie. Sie stellt einen ganz besonderen vietnamesischen Kaffee in einem Kaffee-Labor her und klärt darüber auf, warum belegte Baguettes, „Bánh mì“ genannt, von einer Delikatesse zu einer Art vietnamesischen Fast Food wurden. Im Mekong-Delta schließlich findet Mai zunächst das leise, poetische Vietnam. Mit seinem fruchtbaren Schwemmlandboden ist es die Reiskammer Vietnams mit einer vielseitigen Landwirtschaft. Und die Ernte der Wasserlilien gestalten die Bäuerinnen zum malerischen Fotomotiv. Viele Menschen leben, wohnen und arbeiten dort auf dem Wasser. Frühmorgens auf dem schwimmenden Markt von Cần Thơ bieten Händlerinnen ihre Waren und Speisen vom Boot aus an. Die Reise durch Vietnam ist nicht nur zu einer Hommage an die Schönheit und Vielschichtigkeit des Landes, sondern regt Mai Thi Nguyen-Kim auch zu einer Reflexion über Verbundenheit in einer globalisierten Welt an. Am Ende steht fest: Vietnam ist ein Land für die Sinne. Und eine Frage bleibt: Kann man die Flut der Reize überhaupt in einem Film beschreiben? Man muss es einfach gesehen haben! (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Do. 01.01.2026 ZDF Virunga – Im Land der Feuerflüsse
Vom Fluss des Schwarzen Drachen nach Shanghai
Olympia 2008 ist eines der wichtigsten Ziele für die Entwicklung Chinas. Das Land hatte sich lange abgeschottet von der Welt. Die Große Mauer hielt nicht nur die Fremden fern, sie war auch ein Symbol für die Selbstbezogenheit und Isoliertheit des Reichs der Mitte. Seit 1978 die neue Wirtschaftspolitik begann, spüren die meisten Menschen etwas von dem Wandel. Der Hunger ist besiegt, und es gibt Arbeit, Wohnungen, Medizin. Viel hängt vom Einsatz des Einzelnen ab. (Text: Phoenix)Vom Sturm umbraust – Wildes Skandinavien
Von Shanghai in die Stadt der Zukunft
Von außen wirkt China wie ein Wirtschaftswunderland. Perfekt wie eine einzige hochmoderne Maschine, die im Rekordtempo Fortschritt und Wohlstand produziert. 300 000 Dollar-Millionäre gibt es bereits. Aber es leben auch 26 Millionen Chinesen nach offizieller Statistik unter der Armutsgrenze. In Shanghai schwärmen junge Chinesen von der Weltläufigkeit der größten Stadt des Landes, von dem ganz besonderen Lebensgefühl, vom atemlosen Wandel. Der Fortschritt ist unübersehbar, doch viele Menschen bleiben zurück. (Text: Phoenix)Von Usedom ins Gletschereis
„Wenn du im Winter deine Grenzen ausloten willst, dann ist das eine Reise zu dir selbst“, sagt Ines Papert, Weltmeisterin im Eisklettern, und hängt dabei siebzig Meter über dem Boden. ZDF-Reporter Thomas Euting hat die 31-jährige Extrembergsteigerin zu Beginn seiner Reise besucht, und am Ende wird er sie wieder treffen bei der Gradübersteigung am Watzmann. Dazwischen liegt eine lange Winterreise entlang der deutschen Ostgrenze mit Stationen in Polen und Tschechien. (Text: Phoenix)Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt
45 Min.Im Labor werden Bodenproben aus dem Schmutz in Island analysiert.Bild: ZDF und Ryan WilkesZwei Millionen Jahre alte DNA in Grönland enthüllt eine verlorene, heiße Welt – ein Blick in die Vergangenheit, die auch unsere klimatische Zukunft sein könnte. Ein hartnäckiger Wissenschaftler glaubt an seine Idee von der Umwelt-DNA und setzt sich gegen alle Hindernisse durch. Am Ende einer langen Forschungsreise enthüllt er eine zwei Millionen Jahre alte, heiße Welt auf Grönland mit einer reichen Tierwelt. In der preisgekrönten Dokumentation „Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt“ begibt sich „Terra X“ auf eine faszinierende Zeitreise in die Tiefen der Erdgeschichte.Im Zentrum steht der dänische Wissenschaftler Eske Willerslev mit einer Idee, für die er am Anfang seiner Karriere nur Spott erntet: aus Dreck, Eis und der Umwelt Erbgut zu extrahieren, sogenannte Dirt- oder auch Umwelt-DNA. Denn nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen hinterlassen DNA in der Erde, bis zu Millionen Jahre alt, abhängig von den Temperaturen, denn Erbgut konserviert sich in einer kalten Welt besser als in einer warmen. Heute ist Eske Willerslev ein gefeierter Evolutionsgenetiker, in seiner Zunft weltweit ein Star. Doch ist sein Forscherleben kein geradliniger Weg – und es ist ein kleines Wunder, dass aus ihm ein renommierter Wissenschaftler wurde. Als 20-Jähriger begibt er sich mit seinem Zwillingsbruder Rane in einem Kanu auf Entdeckungsfahrt nach Sibirien. Dort wollen die Brüder ein fast ausgestorbenes Volk finden, die Yugakirs. Zwar gelingt es ihnen, aber Rane kehrt nach Dänemark zurück und für Eske beginnt die härteste Zeit seines Lebens in Einsamkeit, gepaart mit Hunger und Kälte. Nach seiner Rückkehr nach Dänemark durchlebt Eske Willerslev mehrere Krisen und denkt sogar an Suizid. Bis er eines Tages aus seinem Fenster schaut und im strömenden Regen einen Hund sieht, der sein Geschäft macht, was ihm zum Nachdenken bringt: Was passiert mit der DNA in dem Häufchen des Hundes? Was mit dem Erbgut von verwelkenden Blättern, Wurzeln und allem anderen, was lebt? So entsteht in seinem Kopf die Idee von der Extraktion der DNA aus Schmutz, Erde und Eis. In Eis deshalb, weil die älteste DNA fast sicher auch die kälteste sein muss, da sie in der Wärme großen Verfallsprozessen ausgesetzt ist. Doch seine Idee wird mit Spott von seinen damaligen Kollegen und seinem Chef aufgenommen, und so macht sich Eske Willerslev auf eine fast 15-jährige Reise, um seine These vom Erbgut, das sich überall in der Umwelt finden lässt, zu belegen. Neben dem nie nachlassenden Willen und Ehrgeiz, seine Annahme zu beweisen, baut der dänische Wissenschaftler auf modernste DNA-Sequenzierung, die vor einigen Jahren in einem neuen Verfahren den Durchbruch und den Beweis seiner These von der Umwelt-DNA erbringt. Und aus dem einst Verspotteten wird ein Star der Evolutionsgenetik. Gefeiert in Fachjournalen und ausgezeichnet mit Wissenschaftspreisen. Die Reise von Eske Willerslev über fast 20 Jahre zeichnet der Film nach und zeigt eine der ungewöhnlichsten Geschichten der Wissenschaft auf. Die auch Relevanz für die Zukunft hat: Denn das Erbgut, das Willerslev in Grönland findet und analysieren kann, bringt uns eine Welt von vor zwei Millionen Jahren nahe, die viel heißer war als heute, bewohnt von einer reichen Tierwelt mit dem Mastodon, dem Vorläufer des Elefanten, als dem überraschendsten Fund. Und mit Erkenntnissen für heute. Denn die Erkenntnisse aus der damaligen Erdepoche, dem Pliozän, einem Zeitalter mit ähnlichen CO2-Werten wie heute, sind nicht nur für die Vergangenheit bedeutsam. Sie bieten auch eine Anleitung für die Herausforderungen unserer Zukunft. „Das Klima des Pliozän ist wie ein Handbuch für das, was kommt“, sagt Maureen Raymo, Paläoklimatologin der Columbia University. Um für diese zukünftige Zeit gerüstet zu sein, wird in Dänemark bereits an Pflanzen geforscht, die in einer heißeren Welt Nahrung für uns alle garantieren können. So wurde durch die Arbeit von Willerslevs Team auch eine industrielle Revolution in der Sequenzierung uralter DNA eingeleitet. Mithilfe dieser Technologie wurde bereits die erste Pflanze – arktische Gerste – entwickelt, die für eine heiße Zukunft geeignet ist. „Wir stehlen die genetischen Geheimnisse der Vergangenheit, um die Zukunft zu retten“, erklärt Eske Willerslev. Die „Terra X“-Dokumentation „Vor der Eiszeit – Jagd nach dem ältesten Erbgut der Welt“ zeigt eindrucksvoll, wie sich die Idee eines Wissenschaftlers, der sich nicht durch Spott und Hindernissen aufhalten ließ, durch setzte und heute einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen leistet. Eine spannende Reise in die Vergangenheit – und ein Blick in die Zukunft. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 02.11.2025 ZDF Vulkane – Hüter des Feuers
Wagnis in der Südsee – Das Rätsel der Polynesier
45 Min.Menschen aus Süd-Ost-Asien waren schon lange Zeit vor den Europäern in der Lage, mehrere Tausend Kilometer im Pazifischen Ozean zurückzulegen, um ihren knappen Lebensraum zu erweitern. Eine große Hilfe war ihnen dabei eine spezielle und sehr effektive Schiffsbauweise. Doch wie war es möglich, dass sich die Polynesier in der Unendlichkeit des Pazifiks zurechtfanden? Die Dokumentation begleitet ein Expeditionsteam, das mit zwei Katamaranen dem möglichen Migrationsweg der polynesischen Vorfahren, den so genannten Lapita-Leuten, von Asien aus folgt. (Text: ZDFneo)Deutsche TV-Premiere So. 05.09.2010 ZDF Wale, Robben, Riesenbären – Das Ochotskische Meer
Kaum einer kennt es, das Ochotskische Meer, rund 6000 Kilometer östlich von Moskau. Es ist einer der unwirtlichsten Orte und gleichzeitig eines der letzten Naturparadiese unserer Erde. Umringt wird der wilde und unberechenbare Fleck Erde von Sibirien, der Halbinsel Kamtschatka und der japanischen Insel Hokkaido. Das Ochotskische Meer ist im Winter zum großen Teil monatelang mit Eis bedeckt, im Sommer peitschen Taifune meterhohe Wellen auf. In diesem Randmeer des Pazifiks mit seinen angrenzenden Felsküsten, unendlichen Wäldern und Wildflüssen leben Millionen von Wildtieren. Für sie ist das Ochotskische Meer Hölle und Paradies zugleich: Einerseits ist das Klima extrem rau, das Meer bedrohlich; andererseits hat hier eine der artenreichsten Lebensgemeinschaften der Erde die Zeit überdauert.Das Meer, ungefähr viermal so groß wie Deutschland, ist Lebensraum für Millionen Lachse, Dorsche oder Pazifische Pollacks. Auch Seelöwen, verschiedene Robbenarten und Meeresriesen wie Buckelwale oder Orcas leben hier. Die Küsten bevölkern nicht nur mächtige Braunbären, sondern auch bedrohte Tierarten wie Riesenseeadler, Seeotter, Nördliche Seebären oder Stellersche Seelöwen. Die Dokumentation zeigt das Ochotskische Meer mit all seinen Gegensätzen, seiner Wildheit und Schönheit, wie es so noch niemand gesehen hat. Denn dieses Meer hat eine dunkle Vergangenheit: Viele Jahrzehnte war es Sperrgebiet wegen der Straf- und Arbeitslager, der berüchtigten Gulags. Diese Lager sind nun Geschichte, und viele der ehemaligen Gefangenen sind weggezogen, das Gebiet wieder fast menschenleer. Mit seinem Film macht der österreichische Regisseur Franz Hafner erstmals die entlegensten Winkel des Ochotskischen Meeres bekannt. Drei Jahre haben er und sein Filmteam dafür gearbeitet und circa 300 Drehtage benötigt, um die Vielfalt und den Zauber dieser einmaligen Region für ein breites Publikum einzufangen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Sa. 03.08.2019 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 04.08.2019 ZDF Was die Welt am Laufen hält: 1. Energie
45 Min.Erneuerbare Energien machen sich die unerschöpfliche Kraft von Sonne, Wind oder Wärme zunutze.Bild: ZDF und Alamy Stock PhotoMenschen brauchen Energie, als Nahrung, als Licht- und Wärmequelle. In der „Terra X“-Dokumentation beleuchtet Harald Lesch die Geschichte der Energie und fragt nach Zukunftsvisionen. Die Nutzung von Energie ist der Motor unserer Zivilisation. Sie hat das Leben in der Moderne bequem gemacht. Aber der Verbrauch und die Umwandlung von Energie bleiben nicht ohne Folgen. Wie soll der enorme Bedarf zukünftig gedeckt werden, ohne die Umwelt zu schädigen? Die Folge „Energie“ aus der „Terra X“-Reihe „Was die Welt am Laufen hält“ nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Energie – von den Anfängen der Menschheit bis in die Gegenwart.Die Dokumentation beschäftigt sich nicht nur mit der Entdeckungsgeschichte verschiedener Energieformen, sondern auch mit ihren unliebsamen Nebenwirkungen. Die wichtigste natürliche Energiequelle ist die Sonne. Sie ist der Garant für alles Leben auf der Erde. Doch erst die Beherrschung des Feuers revolutioniert die Menschheitsgeschichte. Das Feuer bringt nicht nur Licht und Wärme, sondern markiert auch den Beginn der Zivilisation. Der älteste feuerveränderte Stoff, den der Mensch nutzt, ist Ocker. Es folgen Erze, die in der Kupfer-, Bronze- und Eisenzeit zu Gegenständen aus Metall verarbeitet werden. Auch moderne Technologien funktionieren noch immer nach dem gleichen Prinzip: Mit der Energie des Feuers verändert der Mensch natürliche Rohstoffe und verwandelt sie in unterschiedlichste Gegenstände des täglichen Lebens. Wir leben heute wie damals in einer „High Fire World“, auch wenn das nicht mehr direkt sichtbar ist. Als einer der ältesten Brennstoffe der Geschichte gilt Holzkohle. Sie liefert aber zu wenig Energie im Vergleich zur Braun- und Steinkohle, dem Holz aus der Tiefe des Erdreichs, das über Millionen Jahre zusammengepresst wurde. Kohle, Öl und Gas gehören zu den fossilen Brennstoffen. Mit ihrer Gewinnung gerät die Welt in einen Energierausch, der bis heute anhält. Rund 80 Prozent des weltweiten Bedarfs werden heute durch Kohle, Öl und Gas gedeckt. Sie halten unsere Welt am Laufen, bringen sie allerdings auch ins Stolpern. Denn das in fossilen Energieträgern gespeicherte CO2 wird bei ihrer Verbrennung freigesetzt. Eine ganz andere Energiequelle, die Anfang des 20. Jahrhunderts als Lösung aller Probleme gefeiert wird, ist die Atomenergie. Ihre Erfolgsgeschichte beginnt 1789, als aus einem unscheinbaren Gestein, der sogenannten Pechblende, ein neues Element isoliert wird: Uran. Die Entfesslung atomarer Energie hat ihre verheerende Zerstörungskraft in der Erfindung der Atombombe gezeigt. Doch auch die zivile Nutzung birgt große Risiken – eine der Herausforderungen ist der strahlende Atommüll. In einem unterirdischen Bauwerk in Finnland entsteht das weltweit erste Endlager für Atommüll. Es soll mindestens 100.000 Jahre lang halten. Nachhaltiger erscheinen da die sogenannten erneuerbaren Energien wie Wind- und Wasserkraft. Als Antriebsenergie für Mühlen und Bewässerungsanlagen sind sie schon seit Jahrtausenden bekannt. Heute dienen sie vornehmlich der Stromproduktion. Die große Herausforderung neben der Speicherung ist das Problem der natürlichen Schwankungen. Das betrifft auch die Solarenergie. Die Schwäche der sogenannten erneuerbaren Energien ist ihre Abhängigkeit vom Wetter, das macht sie unbeständig. Eine der aufregendsten Visionen der Gegenwart ist die Energiegewinnung durch Kernfusion. Die ersten Großanlagen sollen in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts einsatzbereit sein, um den weltweiten Umbau der Energieversorgung voranzutreiben. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 21.02.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 25.02.2024 ZDF Was die Welt am Laufen hält: 2. Kommunikation
45 Min.Die gelbe Telefonzelle – lange das Symbol für fernmündliche Kommunikation in die weite Welt. Mit dem Aufkommen von Mobiltelefonen hat das Ende der öffentlichen Fernsprechhäuschen begonnen.Bild: ZDF und Alamy Stock PhotoE-Mail, Facebook, WhatsApp & Co.- mehr als fünf Milliarden Menschen nutzen digitale Nachrichtendienste. Harald Lesch erklärt die Welt der Kommunikation und fragt nach ihren Grenzen. Die „Terra X“-Doku schlägt einen Bogen von der Entstehung der Sprache bis zur künstlichen Intelligenz, gibt Einblick in Schlüsseltechnologien und liefert verblüffende Antworten auf die brennende Frage, wie moderne Kommunikation das Menschsein beeinflusst hat. Die Folge „Kommunikation“ aus der „Terra X“-Reihe „Was die Welt am Laufen hält“ erzählt von den Anfängen der Sprache und Schrift, von den Erfindungen der Telegrafie und des Internets bis hin zur künstlichen Intelligenz.Harald Lesch schaut zurück in die Vergangenheit und wagt den Blick in die Zukunft: Was haben die jeweiligen Kommunikationsfortschritte mit dem Menschen gemacht, wo stehen wir heute? Sind wir am Peak Point der digitalen Kommunikation angelangt? Der Ursprung der menschlichen Kommunikation liegt in der Entstehung der Sprache. Nicht nur die Gegenwart lässt sich mit Sprache beschreiben, sondern auch abstrakte Vorstellungen vom Jenseits, von Göttern und Religionen, von Zukunftsvisionen und Wissenschaft. Alles, was das menschliche Gehirn an Ideen zutage bringt, lässt sich durch Sprache in die Welt tragen. Zunächst geschieht das in großer Varianz. Aus der Ursprache werden Zehntausende unterschiedliche Sprachen. Doch seit Beginn der Sesshaftigkeit geht ihre Vielfalt zurück, aus den heute knapp 7000 Sprachen werden Prognosen zufolge in 200 Jahren nur noch etwa 100 übrig sein. Der Flüchtigkeit des gesprochenen Wortes entgegengewirkt hat die Erfindung der Schrift. Am Anfang wird sie ausschließlich in der Verwaltung genutzt, schon bald aber entstehen auch erste Gesetzestexte und große Epen. Um die Bewahrung des Wissens kümmern sich Bibliotheken. Heute sind analoge Schriftträger in virtuellen Speichern, in Clouds, untergebracht. Ob unsere digitalen Daten aber die Jahrhunderte überdauern können, stellen Wissenschaftler weltweit infrage. Eine der großen Herausforderungen in der Geschichte der Kommunikation ist der Transport von Informationen über große Distanzen. Die optische Telegrafie ist der erste Schritt zur Lösung des Problems, aber erst die Einführung der Elektrizität im 19. Jahrhundert bringt den Durchbruch in der schnellen Nachrichtenübermittlung. Schlag auf Schlag folgen die großen Kommunikationserfindungen der Moderne: das Telefon, das Radio und das Fernsehen. Mit dem Internet ist der Mensch in eine Welt der unbegrenzten Information eingetreten. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. Wir können alles herausfinden, was wir wollen, gleichzeitig wird es aber immer schwieriger, zu sagen, was richtig ist und was falsch. Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz befeuern diese Entwicklung weiter. Sprechen zu können wie ein Mensch, haben Forscher inzwischen auch Maschinen beigebracht. Werden wir in Zukunft immer häufiger mit Chatbots, Robotern und Avataren kommunizieren? Wo zwischen all den heutigen Kommunikationstechniken steht der Mensch? Fragen, die bereits unseren Alltag prägen und in Zukunft an Bedeutung zunehmen werden. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 28.02.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 03.03.2024 ZDF Was die Welt am Laufen hält: 3. Mobilität
45 Min.Bei den Dreharbeiten steuerte „Terra X“ – Moderator Harald Lesch selbst einen originalgetreuen und voll funktionsfähigen Nachbau des Patent-Motorwagens.Bild: ZDF und Hans JakobiMenschen wollen mobil sein. Vom ersten aufrechten Gang unserer Vorfahren bis zur Eroberung des Weltraums beleuchtet dieser Film die rasante Entwicklung unserer Spezies. „Terra X“ unternimmt eine Zeitreise durch die Mobilitätsgeschichte. Gezeigt wird, wie sich der Radius des Menschen ständig weiterentwickelt. Technische Meilensteine machen es möglich, die Welt zu entdecken, auf der Suche nach Nahrung oder einer besseren Zukunft. „Terra X“-Moderator Professor Harald Lesch führt durch diesen Film, ist dabei unterwegs mit dem Fahrrad, einer Dampflok und dem dreirädrigen Patentmotorwagen von Carl Benz.Einen Originalnachbau des ersten richtigen Automobils der Welt steuert er dabei selbst. So zeichnet diese Dokumentation die Geschichte des Bewegungsdranges des Menschen nach. Fossile Fußspuren in versteinerten Ascheschichten in Ostafrika belegen, dass bereits vor etwa 3,6 Millionen Jahren frühe Vorfahren des Menschen aufrecht gegangen sein müssen, möglicherweise sogar deutlich früher. Diese Art der Fortbewegung hatte enorme Vorteile, in der Nahrungsbeschaffung beispielsweise. Auf jeden Fall erweiterte sich so bereits der Bewegungsradius. Die Evolution des Menschen ist geprägt von unstillbarem Verlangen, Neues zu entdecken, Lebensbedingungen zu verändern, Berge, Wüsten und Meere zu überwinden. Der Erfindergeist führt zu einem ersten Quantensprung durch die Erfindung des Rades, dann der Domestizierung des Pferdes und dem Einsatz von Fuhrwerken. Viele technische Revolutionen sind mit Mobilität verbunden. Das Fahrrad, die Eisenbahn und das Auto lassen Entfernungen auf dem Landweg schrumpfen. Auf den Weltmeeren sind es Schiffe, die Menschen endlich fremde Kontinente erreichen lassen. Zusammen mit der Entwicklung verbesserter Navigationshilfen beginnt im 15. Jahrhundert von Europa aus die Globalisierung. Und der weltweite Handel findet bis heute vor allem auf den Weltmeeren statt. Rund 90 Prozent aller Warengüter werden auf Seeschiffen transportiert. Mit dem Aufsteigen von Heißluftballons und rund ein Jahrhundert später der Erfindung des Flugzeuges erfüllt sich endlich auch der große Traum des Menschen vom Fliegen. Zunehmend wird allerdings klar, dass bei vielen technischen Entwicklungen Segen und Fluch eng beieinanderliegen. Durch die zunehmende Belastung der Umwelt sind moderne Fortbewegungsmittel umstrittener denn je. Alternativen sind gefragt, und auch diese werden beleuchtet, wie beispielsweise solarbetriebene Flugzeuge. Letztlich stellt sich auch die Frage danach, wie die Mobilität in ferner Zukunft aussehen könnte. Zeitreisen und Beamen werden wohl Wunschdenken bleiben. Im Jahr 1802 wanderte der deutsche Schriftsteller und Dichter Johann Gottfried Seume zu Fuß von Grimma bei Leipzig bis nach Syrakus – getreu dem Motto: „Alles würde besser gehen, wenn man mehr ginge“. Immerhin: Bis zu einem Alter von etwa 80 Jahren legt ein Mensch rund 170.000 Kilometer zu Fuß zurück – ohne zu joggen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 06.03.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 10.03.2024 ZDF Was die Welt besser macht: 1. Frieden
45 Min.In Frieden zu leben, ist eine der größten Sehnsüchte der Menschheit. Mirko Drotschmann geht der Frage nach, wie sich die Vorstellung von Frieden im Lauf der Geschichte verändert hat. Die Vereinten Nationen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel gegründet, den Weltfrieden zu wahren. Auch wenn sich die Welt davon zu entfernen scheint, lohnt es sich immer, sich für dafür einzusetzen. Doch ist Frieden überhaupt möglich? Jahrhundertelang war Europa das größte Schlachtfeld der Erde. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien sich endlich Frieden durchzusetzen – doch spätestens der Krieg in der Ukraine beendete diese Phase.Wann begann sich die Gewaltspirale zu drehen – und wie lässt sie sich stoppen? Sind Menschen von Natur eher kriegerisch oder friedlich? Das will Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann in der ersten Folge des „Terra X“-Dreiteilers „Was die Welt besser macht: Frieden“ herausfinden. Auf seiner Reise findet Mirko Drotschmann verblüffende Antworten: In Europa lassen sich kriegerische Auseinandersetzungen erst in der Bronzezeit archäologisch eindeutig nachweisen – lange nach der Sesshaftwerdung des Menschen vor rund 10.000 Jahren. Und seitdem der Krieg in der Welt ist, gibt es auch Bemühungen, Frieden zu stiften – daran erinnert eine Kopie des mehr als 3000 Jahre alten ägyptisch-hethitischen Friedensvertrags, der heute im UN-Hauptgebäude in New York hängt. Schon im antiken Griechenland überlegten Philosophen, wie man „Ewigen Frieden“ schaffen kann. Doch erst im Römischen Reich gelang es, einen dauerhaften Frieden durchzusetzen. Die „Pax Romana“ beruhte allerdings auf der militärischen Macht der Römer und galt nur im Inneren ihres Imperiums – gegen fremde Völker führten sie weiter Krieg. An der Schwelle zum Mittelalter versuchten christliche Theologen, die Gewalt einzudämmen, indem sie Regeln für einen „gerechten Krieg“ formulierten. Aber erst nach dem Dreißigjährigen Krieg gelang es 1648 mit dem Westfälischen Frieden, das Fundament für das heutige Völkerrecht und die moderne Friedensdiplomatie zu legen. Mirko Drotschmanns Suche nach Frieden führt vom Friedensaltar des Augustus in Rom zur UN-Generalversammlung in New York, vom Friedenssaal in Münster bis zum Nobel Peace Center in Oslo. Neben Archäologinnen und Historikern trifft er Anthropologen und Hirnforscherinnen. Dabei zeigt er, dass Gewalt zwar teils in den menschlichen Genen steckt, man es aber selbst in der Hand hat, eine friedliche Zukunft zu gestalten. Obwohl Krieg weltweit wieder auf dem Vormarsch ist, macht der Blick in die Vergangenheit Hoffnung: In Verdun, wo deutsche und französische Soldaten im Ersten Weltkrieg die Hölle auf Erden erlebten, erfährt Mirko Drotschmann, wie sich aus Erbfeindschaft eine enge Freundschaft entwickelt hat. Vielleicht ist der Traum vom „Ewigen Frieden“ unerreichbar – doch sich dafür einzusetzen, lohnt sich. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.03.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 30.03.2025 ZDF Was die Welt besser macht: 2. Freiheit
45 Min.Im Namen der Freiheit werden blutige Kriege angezettelt, Revolutionen bringen Massen auf die Straße. Es ist ein weiter Weg, bis Freiheit als Grundrecht aller Menschen gilt. Der Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann reist durch Europa und nach New York, um den Weg der Freiheit von der Antike bis heute aufzuzeigen. Er stellt fest, wie wichtig Freiheit ist, merkt man oft erst dann, wenn man sie verliert. Freiheit – kaum ein Begriff ist so allgegenwärtig und doch so schwer zu fassen. Es ist ein Gefühl, nach dem fast alle Menschen streben. Mit Freiheit bezeichnet man meist die Möglichkeit, das eigene Leben frei zu gestalten und sich ohne Einschränkungen bewegen zu können.Auch Rechte werden als Freiheiten bezeichnet, wie zum Beispiel die Religions- oder Meinungsfreiheit. Heute gelten sie als wichtigste Grundrechte aller Menschen, auf ihnen beruhen alle demokratischen Verfassungen der Neuzeit. Die Vorstellung von Freiheit hat sich im Lauf der Jahrhunderte verändert. Aber wie steht es heute um die Freiheit in der Welt? Das will Mirko Drotschmann in der zweiten „Terra X“-Folge „Was die Welt besser macht: Freiheit“ herausfinden. Mirko Drotschmanns Reise beginnt an der Freiheitsstatue in New York – dem weltweit bekanntesten Symbol für Freiheit. Als erste Demokratie der Neuzeit waren die USA lange Sehnsuchtsort für Freiheitssuchende aus vielen Ländern der Erde. Bis sich das heutige Freiheitsverständnis durchgesetzt hatte, war es ein weiter Weg: Das demokratische Experiment der Athener im 5. Jahrhundert vor Christus war eine Ausnahmeerscheinung. Bis ins 18. Jahrhundert war Freiheit vor allem ein Privileg der Reichen und Mächtigen. Das Römische Reich verdankte seinen Wohlstand einem Heer aus Sklaven, die als Unfreie meist lebenslang für ihre Dienstherrn schuften mussten. Im Mittelalter waren viele Bauern als Leibeigene an Adel und Klerus gebunden. Sie verfügten weder frei über ihre Erträge noch über ihr eigenes Leben. Im Zuge der Reformation wuchs der Widerstand gegen die alte Ständeordnung: Während die Fürsten den Freiheitskampf der Bauern blutig niederschlugen, setzte sich im Zuge der Glaubenskriege allmählich die Religionsfreiheit durch. Doch erst die Aufklärung schuf das Fundament der heutigen Vorstellung von Freiheit, die sich mit den Revolutionen in Amerika und Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts Bahn brach. Mit Neurowissenschaftlern der Charité in Berlin geht Mirko Drotschmann der Frage nach, ob der Mensch einen freien Willen hat oder alles von den Naturgesetzen vorbestimmt ist, denen das Gehirn folgt. Überall in der Welt setzen Menschen noch immer ihr Leben und ihre Freiheit aufs Spiel, um offen ihre Meinung zu sagen und frei zu entscheiden, wie sie leben wollen. Und selbst in den Demokratien Amerikas und Europas werden die mühsam erkämpften Freiheiten zunehmend infrage gestellt. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.03.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 06.04.2025 ZDF Was die Welt besser macht: 3. Gerechtigkeit
45 Min.Ohne Gerechtigkeit kein Frieden und keine Freiheit. Viele Menschen haben hart für diese Werte gekämpft. Es ist wichtig, sie immer wieder zu verteidigen. Sie hat die Welt besser gemacht. Seit fast 300 Jahren ist die Gleichheit vor dem Gesetz ein Menschenrecht. Selbstverständlich ist sie noch immer nicht. Der Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann begibt sich auf eine Zeitreise und fragt, wie eine gerechte Welt funktionieren kann. Gerechtigkeit ist einer der wichtigsten Schlüssel für eine bessere Welt – ohne sie kommt es fast unweigerlich zu Konflikten, ist ein Leben in Frieden und Freiheit schwer vorstellbar.Es geht um den Ausgleich zwischen Arm und Reich, gebildet und ungebildet, Mann und Frau, um Wahlrecht und vieles mehr. Aber Gerechtigkeit ist kompliziert und bedeutet nicht unbedingt, dass alle gleich behandelt werden. Was braucht es also für Gerechtigkeit? Und stimmt der weitverbreitete Eindruck, dass die Welt immer ungerechter wird? Damit befasst sich Mirko Drotschmann in dieser Folge der „Terra X“-Reihe. Seine Spurensuche beginnt in der Steinzeit – und zeigt, dass ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn für die Jäger und Sammler überlebenswichtig war. Selbst nach der Sesshaftwerdung legten Menschen noch lange Wert darauf, soziale Unterschiede zu vermeiden – darauf deuten Funde aus Çatalhöyük hin, der ersten Großsiedlung der Weltgeschichte, die vor mehr als 9000 Jahren im heutigen Anatolien entstand. Trotzdem setzten sich mit Ackerbau und Viehzucht allmählich Hierarchien durch – mit neuen Unterschieden zwischen Herrschern und Untertanen, Armen und Reichen, Männern und Frauen. Im Römischen Reich sorgten Rechte für Gerechtigkeit, vor dem Gesetz sollten alle Bürger gleich sein. Im Mittelalter und bis zur Neuzeit wurde Recht mit drakonischen Maßnahmen durchgesetzt. Davon zeugt eine bei Allensbach in Süddeutschland ausgegrabene Richtstätte. Mithilfe historischer Prozessakten erfährt Mirko mehr über die Identität der grausam hingerichteten Straftäter und lernt, dass die Reichen und Mächtigen damals oft ungeschoren davonkamen. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit setzte sich erst mit der Aufklärung und der Entstehung der modernen Demokratien in Amerika und Europa durch. Trotzdem mussten manche Bevölkerungsgruppen lange für Gleichberechtigung kämpfen, vor allem Frauen. Mit Unterstützung der Urenkelin von Emmeline Pankhurst, der Anführerin der britischen Suffragetten, zeichnet Mirko Drotschmann den weltweiten Kampf von Frauen für politische Teilhabe nach. Der Gerechtigkeit folgt Mirko Drotschmann auf drei Kontinenten – von den Hügeln Anatoliens zu den eindrucksvollen Ruinen des antiken Rom bis zum Rockefeller Center in New York. Mithilfe von Verhaltensforschern zeigt er, wie stark der angeborene Gerechtigkeitssinn Menschen von klein auf prägt und welchen Einfluss unterschiedliche Kulturen auf das Gerechtigkeitsempfinden haben. Trotz vieler Fortschritte zeichnet sich die Welt noch immer durch große Ungleichheit aus, vor allem zwischen Arm und Reich. Ob das ungerecht ist und ob man die Welt mit Geld besser machen kann, darüber diskutiert der Wissenschaftsjournalist mit einem Nachfahren des Ölmilliardärs John D. Rockefeller. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.03.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 13.04.2025 ZDF Wege aus der Finsternis – Europa im Mittelalter: 1. Von Rittern und Turnieren
45 Min.Um unser Europa zu verstehen, muss man das Mittelalter verstehen, in dem der Aufbruch in die Moderne begann. Mit Klischees über diese angeblich so dunkle Epoche aufzuräumen, ist das Ziel des Vierteilers „Wege aus der Finsternis“. Aber nicht nur die Lust auf Abenteuer, sondern auch die Sehnsucht nach romantischer Liebe erfüllen Ritterträume. (Text: ZDFInfo)Deutsche TV-Premiere So. 04.04.2004 ZDF Wege aus der Finsternis – Europa im Mittelalter: 2. Von Mönchen und Ketzern
45 Min.Keine Epoche Europas war so religiös wie das Mittelalter. Das Mittelalter hat viele berühmte Mönche hervorgebracht. Einer von ihnen ist Edward, aus dem Kloster Saint Andrews in Schottland. (Text: ZDFneo)Deutsche TV-Premiere So. 11.04.2004 ZDF Wege aus der Finsternis – Europa im Mittelalter: 3. Von Bauern und Edelmännern
45 Min.Alles, was wir über das Mittelalter wissen, wissen wir aus Büchern. Sie sagen uns, was Kaiser und Könige, was Ritter, Bischöfe und Mönche, was Bürger und Edelmänner getan und gedacht haben. Über die Bauern sagen die Bücher uns wenig. Sie konnten nicht lesen und nicht schreiben. Und wer schreiben und lesen konnte, interessierte sich nicht für sie. So blieben die Bauern die stumme Mehrheit des Mittelalters. Und deshalb erzählt einer über das Leben des Bauernstandes, der ihre Welt kennen lernte: Adam, ein Gaukler, einer aus dem fahrenden Volk.Als Seiltänzer auf Bauern- und Fürstenhochzeiten schlägt er sich durch. Und an Markttagen verdient er sein Geld im Handumdrehen, wenn er faule Zähne zieht und den grauen Star sticht. „Bauernarbeit trägt die Welt“, hieß es im Mittelalter. Über Dreiviertel der Menschen waren Bauern, Leibeigene oder Tagelöhner, die die Ritter und Geistlichen ernährten. „Dafür lob’ ich den Bauersmann, der alle Welt ernähren kann.“ Aber Not machte auch erfinderisch. Um das Jahr 1000 begann eine Agrarrevolution, die Europa von Grund auf veränderte und zu einer Bevölkerungsexplosion sondergleichen führte. Meilensteine der Agrarrevolution waren der Übergang zur Dreifelderwirtschaft und die Erfindung des Kummets. Lange Zeit waren die so langsamen wie schwerfälligen Ochsen die Traktoren des Mittelalters. Erst das Kummet machte es möglich, Pferde vor den Pflug zu spannen. Sie sind schneller, wendiger und ausdauernder als Ochsen; dies zeigt ein Wettpflügen, das für den Film unter mittelalterlichen Bedingungen durchgeführt wurde. Mit Pferden konnte mehr Ackerland bearbeitet werden. So wurde die Pferdestärke zur Einheit technischer Leistung schlechthin. Eine weitere Revolution auf dem Land: Europa ist Getreideland, statt von Reis lebte man von Weizen, Roggen und Hafer. Für Reis braucht man keine Mühlen, Getreide aber muss man mahlen. Aus dem Einsatz von Wasser- und Windenergie und der Mühlentechnologie erwuchs Europa schon im Mittelalter ein entscheidender Vorsprung in Richtung Industrialisierung. „Eine Mühle ist stärker als 100 Männer“, hieß es. Bis zur Erfindung der Dampfmaschine war die Wasserkraft der entscheidende Faktor der industriellen Entwicklung. Auch ein anderes, nicht gerade beliebtes Grundelement des modernen Staates hat seine Wurzeln im Mittelalter: Aus dem berüchtigten Zehnt und den Abgaben der Bauern an die Grundherren, zu denen auch die Martinsgans und Ostereier gehörten, entwickelte sich das moderne Steuerwesen. Die Steuerakten des Königreiches Aragon, die sich in Barcelona erhalten haben, geben darüber Aufschluss: Mehrwertsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer; all das, was uns heute so vertraut ist, entwickelte sich schon ab dem 13. Jahrhundert. Die Landleute führen ein hartes Leben. Aber am meisten bedrückt sie, dass ihnen Land, das sie bewirtschaften, nicht gehört, sondern den Herren. Nicht überall war das der Fall. In der Schweiz zogen die Bauern den Hut nicht vor den Herren. Sie waren „ein freies Volk auf freiem Grund“. Der Schwur auf der Rütliwiese – „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern“ – ist ein geschichtsmächtiger Mythos. Tatsache aber ist, dass sich die Eidgenossen gegen die Habsburger Ritter mit Mistgabeln und Dreschflegeln bewaffneten und ihnen nach Partisanenart am 9. Dezember 1315 in der Schlacht am Morgarten eine historische Niederlage bereiteten. Aus der Eidgenossenschaft der Schweizer erwuchs der erste Bundesstaat Europas mit einer demokratischen Verfassung. Adam, der Gaukler, hat sich bei den Habsburgern als Pferdeknecht verdingt und ist so Zeuge ihrer Niederlage geworden. Zum Knecht ist er nicht geboren. Und zum Narren will er sich nicht machen. Aber auch er hat einmal Glück und findet eine Gefährtin. Das ewige Vagabundenleben sind sie leid. Sie suchen ihre Zukunft in der Stadt und beherzigen so das mittelalterliche Sprichwort „Landluft macht eigen, Stadtluft macht frei.“ In der Stadt werden sie „nach Jahr und Tag“ nicht mehr ehrlos und rechtlos sein, sondern als freie Bürger leben können. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 18.04.2004 ZDF Wege aus der Finsternis – Europa im Mittelalter: 4. Von Städten und Kathedralen
45 Min.Seine Leidenschaft ist die Erkundung und Beschreibung der Welt. Heinrich Schuder ist Kosmograph, unterwegs in geheimer Mission: In Venedig soll er für die Stadt Nürnberg Seekarten kopieren, denn der Rat will zusammen mit den Portugiesen in den Indienhandel einsteigen. Er soll aber auch herausfinden, was es Neues gibt auf dem Rialto. Doch wissenschaftliche Neugier ist kein ungefährliches Unternehmen. Die Welt des Mittelalters ist im revolutionären Umbruch: Großstädte schießen wie Pilze aus dem Boden, der Fernhandel kommt auf Touren, die Seefahrt bricht zu neuen Kontinenten auf.Da braucht man Informationen und Wissen. So erkundet Heinrich Schuder, warum die venezianischen Kaufleute kein Bargeld für ihre Geschäfte brauchen: Sie haben das Girokonto erfunden und den Wechsel. Es kommt nicht von ungefähr, dass Bezeichnungen wie Giro-Konto, Agio, Disagio, Saldo, Storno, Manco italienisch sind. Denn in Italien wurde der bargeldlose Zahlungsverkehr erfunden, der das Geschäftsleben und den internationalen Handel revolutionierte. Auch die Doppelte Buchführung mit Soll und Haben, ohne die unsere heutige Wirtschaft so wenig vorstellbar wäre wie ohne Wechsel, bei dem der Aussteller „mit seinem guten Namen bezahlte“. Alle Grundzüge unseres heutigen Geldverkehrs und des Bankwesens wurden bereits im Mittelalter entwickelt. Als Heinrich Schuder auf Erkundung in Venedig ist, heißt es: „So geschah es. Einer starb nach dem anderen, und am Ende alle.“ Der schwarze Tod ging um. Auch wenn man die Ursache nicht kannte, in Venedig wusste man erste Abwehrmaßnahmen gegen die Pest zu treffen: Der Hafen wurde gesperrt und die Schiffsbesatzungen auf einer Insel in der Lagune erst einmal vierzig Tage isoliert – daher kommt der Begriff Quarantäne. Die Behörden ließen hygienische Brunnen für Trinkwasser bauen und richteten Pestkrankenhäuser auf abgelegenen Inseln ein. Heinrich Schuder gelingt es, Venedig rechtzeitig zu verlassen. Auf dem Heimweg kommt er durch Freiburg. „Willst du wissen, wie eine Stadt wirklich aussieht, steige auf ihren Turm.“ So hält er es, und blickt von der Kathedrale aus auf das Gewirr der Straßen und Gassen. Doch der Augenschein trügt, denn die Städte des Mittelalters waren alles andere als ungeplant und chaotisch gewachsen. Bahnbrechende Forschungen zeigen: Wie Freiburg wurden viele Städte von genialen Stadtplanern auf dem Reißbrett entworfen. Dabei legten sie ihnen ein geheimnisvolles Muster von Kreisen zu Grunde. Zwischen 1035 und 1348 wurden in Europa 3000 neue Städte gegründet. Die urbane und industrielle Revolution des Mittelalters wurde erst im 19. Jahrhundert von einer vergleichbaren Umbruchsbewegung abgelöst, darüber ist sich die Forschung heute einig. Bis heute sind sie die Wahrzeichen vieler europäischen Städte die genialen Wunderwerke der gotischen Kathedralen. Nie zuvor in der Geschichte wurde so hoch gebaut. Wie konnten die filigranen Wände aus Licht und Farbe dem Druck der Steinmassen und des Windes standhalten? Baumeister in Reims und Computerkonstruktionen zeigen, welche genialen Erfindungen es möglich machten, Kathedralen lichter zu bauen als je zuvor. Heinrich Schuder ist Spezialist für Kartographie, für die maßstäbliche Abbildung der Welt auf Pergament. Aber ist die Erde nicht rund? Als er das geheime Kartenmaterial aus Venedig in Nürnberg abgibt, sieht er im Ratssaal den ersten Globus, den es je gab. Dass die Erde eine Kugel ist, wusste man schon lange. Aber weder die Hereford Map, die größte und älteste Weltkarte, die sich erhalten hat, noch der berühmte Katalanische Atlas nahmen davon Notiz. Erst 1484 schuf Martin Behaim in Nürnberg einen Globus. Es ist ein Prototyp. Sein „Erdapfel“ sollte in Serie für portugiesische Kapitäne gefertigt werden, die aufbrachen, neue Welten zu erkunden. Martin Behaim arbeitet in der Seefahrerschule in Sagres an weiteren Globen. Heinrich Schuder überbringt ihm neuestes Kartenmaterial aus Nürnberg, damit er weiße Flecken auf seinem Globus füllen kann. Er bereitet eine Expedition vor: Der Seeweg rund um Afrika nach Indien soll erkundet werden und man will neue Kontinente entdecken. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 25.04.2004 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.