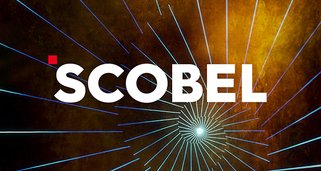2024
Transgender – Leben im falschen Körper
Folge 391 (60 Min.)Menschen, die ihr Geschlecht wechseln wollen, haben oft einen langen Leidensweg vor sich. Ein neues Gesetz soll das ändern. Wie fühlt es sich an, im falschen Körper geboren zu sein? Circa 0,5 Prozent der Menschen weltweit gelten als Transgender. Trotzdem bewegt das Thema viele. Wer sich einem anderen als dem biologischen Geschlecht zugehörig fühlt, muss hierzulande viel auf sich nehmen: Psychotherapie, Pubertätsblocker, Hormontherapie, Operationen. Eine Transidentität kann sich bereits in der Kindheit entwickeln oder im gesamten Verlauf des Lebens.Das Spektrum ist weit – manche Menschen möchten nur ihre soziale Rolle wechseln, andere möchten medizinische Maßnahmen in Anspruch nehmen und ihr eigentliches Geschlecht auch rechtlich anerkennen lassen. Das soll eine neues Gesetz leisten, dass Ende 2024 in Kraft treten soll – das Selbstbestimmungsgesetz. Doch das Gesetz ist umstritten. Denn Wissenschaftler und Ärzte sind sich einig, dass bislang viel zu wenig zur Transidentität geforscht wurde. Sie wollen die Ursachen herausfinden: Sind diese eher gesellschaftlich oder genetisch determiniert? Auch die sogenannten Pubertätsblocker, die die sexuelle Entwicklung erst einmal stoppen, sind in die Kritik geraten. Psychologen argumentieren, dass sie die Not junger Menschen lindern, ja sogar die Suizidzahlen reduzieren können. Kritiker halten dagegen: Sie fürchten einen negativen Einfluss auf den Hirnumbau und spätere Unfruchtbarkeit. Genau wie operative Geschlechtsangleichungen bergen hormonelle Eingriffe immer auch Risiken, die nicht vollständig kalkulierbar sind. Was ist mit den Menschen, die später wieder in ihr ursprüngliches Geschlecht zurückkehren wollen und die Transition bereuen? Welche Rolle kommt der Gesellschaft zu, in der das Thema sehr kontrovers diskutiert wird? Brauchen wir nicht eine viel größere Akzeptanz für alles, was von der vermeintlichen „Normalität“ abweicht? Denn: Die Zahl der Übergriffe auf Transmenschen nimmt zu. Über diese und viele andere Aspekte diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Dagmar Pauli ist Chefärztin und medizinisch-therapeutische Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Geschlechtsidentität bei Jugendlichen. Livia Prüll lehrt als Professorin für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Sie ist Mitglied im Bundesverband Trans* und arbeitet als systemische Beraterin. Timo Nieder leitet als Psychologe und Sexualtherapeut die Spezialambulanz für Sexuelle Gesundheit und Transgender-Versorgung am Universitätsklinikum Eppendort (UKE) und koordiniert die sexualmedizinische Lehre im Studium der Humanmedizin. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 11.01.2024 3sat Der Coaching Boom
Folge 392 (60 Min.)Immer mehr Menschen vertrauen auf Berater, um ihren Leben Sinn und Orientierung zu geben oder um sich zu optimieren. Das Problem: Es gibt kaum messbare Kriterien für gutes Coaching. Die Berufsbezeichnung „Coach“ ist gesetzlich nicht geschützt. Und so kann sich jeder Coach nennen. Das zieht auch Scharlatane und Betrüger an. Der Boom beim Coaching ist allerdings auch kein guter Befund über den Zustand unserer Gesellschaft. Offensichtlich brauchen wir Beratung – in allen Lebensbereichen. Wir sind inkompetent in Sachen Leben. Ob es um Karriere, Gesundheit, Beziehungen oder persönliche Entwicklung geht, Coaching ist gerade im Trend.Für jeden nur erdenklichen Bereich des Lebens gibt es Coaches, die ihren Kunden ein erfolgreicheres und erfüllteres Leben versprechen. Schon der Philosoph Sokrates war so etwas wie der Ur-Coach der Menschheitsgeschichte. Mit seinen sokratischen Dialogen brachte er sein Gegenüber dazu, eigene Einsichten und Erkenntnisse zu erlangen und eigenverantwortliche Lösungen für seine Probleme zu finden. Der Begriff „Coaching“ tauchte erstmals im Jahr 1858 in England auf. Als Coach wurden umgangssprachlich private Tutoren von Studenten bezeichnet, die ihr Studium schneller und erfolgreicher abschließen wollten. Heutzutage findet man unendlich viele Coaching-Angebote für Unternehmen oder Privatpersonen. Dabei heißt es aber, sehr genau hinzuschauen, von wem man sich coachen lassen will. Doch wie funktioniert Coaching eigentlich? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu? Wie unterscheidet sich Coaching von psychologischen Therapien, und wie kann man Coaching effektiv nutzen? Über diese und viele andere interessante Aspekte des Themas diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Sabine Asgodom ist renommierter Coach, Autorin und Rednerin, die in ihrer eigenen Methode des LOKC ausbildet. Sie ist für ihre Berufsethik und ihr gesellschaftliches Engagement bekannt, wofür sie das Bundesverdienstkreuz und den Life Achievement Award erhalten hat. Florian Becker ist ein Psychologe und Autor. Er hat eine Professur inne an der TH Rosenheim und ist im Vorstand der Wirtschaftspsychologischen Gesellschaft. Er beschäftigt sich mit positiver Psychologie, Führung und Motivation. Wolfram Eilenberger ist ein mehrfach preisgekrönter deutscher Schriftsteller und Philosoph. Außerdem erwarb Eilenberger einen DFB-Trainerschein und war bis 2023 Mitglied im Direktionsbeirat der Nationalmannschaften und der Akademie des DFB. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 25.01.2024 3sat Die Angst-Falle
Folge 393 (60 Min.)Negative Erlebnisse, Emotionen und Gedanken haben einen größeren Einfluss auf die Psyche als positive. Das hat weitreichende Konsequenzen für unser Denken und Handeln. „Negativity Bias“, die verstärkte Wahrnehmung schlechter Nachrichten und traumatischer Erlebnisse, hat ihren Ursprung in der frühmenschlichen Evolution. Angst sensibilisierte für Gefahren und hatte eine existenzielle Schutzfunktion. Aber sie kann auch lähmen und lässt sich instrumentalisieren. Für unsere Vorfahren war es lebensnotwendig, besonders negative Erfahrungen und Sinneseindrücke zu analysieren und als potenzielle Gefahren für die Zukunft zu speichern. Heute sind wir schlechten Nachrichten, traumatischen Erlebnissen und bedrohlichen Szenarien um ein Vielfaches intensiver ausgesetzt.Damit es ist wichtiger denn je, zu lernen, mit diesem evolutionären Erbe umzugehen. Über 90 Prozent der Szenarien, die uns Angst machen, so fanden Wissenschaftler heraus, werden wahrscheinlich nicht eintreten. Dennoch sprechen wir auf schlechte Nachrichten an – mittlerweile auch ein einträgliches Geschäft in der täglichen Kommunikations- und Nachrichtenschlacht. Wie funktioniert das Phänomen Negativitätsverzerrung genau? Wie stärken wir unsere Resilienz und unsere Fähigkeit, in einer gesunden Balance zu bleiben – mit Zuversicht und dem Blick gerade auch für das Positive? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 01.02.2024 3sat Was Stille auslöst
Folge 394 (60 Min.)Der Alltag ist laut. Selbst im Schlaf sind wir Geräuschen ausgeliefert. Dabei braucht unser Körper Stille für Stressabbau und bessere Gehirnfunktion. Stille kann aber auch Angst machen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Abwesenheit von Geräuschen ähnliche Gehirnaktivitäten erzeugt wie hörbare Geräusche. Stille ist in diesem Sinne ebenfalls eine Wahrnehmung und nicht einfach Nichts. Stille wirkt auf viele Menschen unangenehm und macht nervös. Stille erzeugt Ängste. Wir fürchten uns vor den eigenen negativen Gedanken und Gefühlen.Wissenschaftler vermuten, dass dafür unsere geringere Aufmerksamkeitsspanne verantwortlich sei. Ausgelöst durch digitale Technologien und dem vermehrten Gebrauch sozialer Medien. Wenn es still wird, suchen wir förmlich nach Geräuschen, um uns in unserer Umgebung sicherer zu fühlen. Als hilflose Kleinkinder brauchten wir Geräusche, weil sie uns die Anwesenheit von sich kümmernden Erwachsenen signalisierten. Und damit Geborgenheit vermittelten. Stille, beispielsweise in Gesprächen, Momente des Schweigens, können ebenfalls als belastend oder unangenehm, als Ablehnung empfunden werden. Darüber hinaus ist Stille auch eine Bedingung für Entspannungszustände wie beim autogenen Training. Und so spielt die Stille auch eine wichtige Rolle in Religion und Meditation. Inwieweit brauchen Menschen Zeiten der Stille, um zu regenerieren? Oder ist der moderne Mensch längst umprogrammiert auf Wohlfühlmodus bei Dauerbeschallung? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in der „scobel“-Sendung „Was Stille auslöst“. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 22.02.2024 3sat Flucht vor dem Klima
Folge 395 (60 Min.)Die Veränderungen des Klimas werden jedes Jahr – auch für uns Menschen in Mitteleuropa – mehr und mehr erfahrbar. Zukünftig werden wir nicht mehr überall leben und arbeiten können. Der Alpenraum erfährt gravierende Veränderungen durch den Klimawandel: die Gletscher der Alpen schmelzen rapide. Damit ist die Versorgung mit Trinkwasser gefährdet – in ganz Europa. Weitere Folgen: Dürren, Überschwemmungen und Migrationsbewegungen. Der Obst- und Gemüseanbau in den traditionellen Anbauflächen in Südeuropa sichert die Nahrungsmittelversorgung des Kontinents – noch.Doch anhaltende Dürren und ein Absinken der Grundwasserspiegel könnte die intensive Bewirtschaftung großer Flächen bald unmöglich machen. An den Alpen rutschen Hänge ab oder werden so instabil, dass Täler unbewohnbar werden. Schon jetzt werden erste Dörfer evakuiert. Und so paradox es klingt: auch ein Zuviel an Wasser nach Extremregenereignissen wird mehr katastrophale Überschwemmungen zur Folge haben, die sich nicht präzise voraussagen lassen. So wird das Leben an großen und kleinen Flüssen immer schwieriger und gefährlicher. Das hat uns die Ahrtal-Katastrophe vor Augen geführt. Aufgrund von klimabedingten Ereignissen, die zu Hunger und Obdachlosigkeit führen, verlassen weltweit immer mehr Menschen ihre Heimat. Bis 2050 könnten es bis zu 140 Millionen Klimaflüchtlinge werden, denn durch den fortschreitenden Klimawandel werden weitere Lebensräume zerstört. Auch innerhalb Europas – so die Prognose – werden Menschen dauerhaft umgesiedelt werden müssen. Das schürt Ängste und verschärft Verteilungskämpfe. Wir werden uns schneller als geglaubt an die Klimaveränderungen und ihre Folgen anpassen müssen und vor allem – neue Strategien und nachhaltigere Lösungen finden. Wo also werden wir in Zukunft leben und arbeiten? Welche Lösungen haben Wissenschaft und Politik für dieses Szenario? Wo könnten neue Rückzugsgebiete entstehen? Sind wir ausreichend vorbereitet auf unser zukünftiges Leben mit dem beschleunigten Klimawandel? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 29.02.2024 3sat Die empfindsame Gesellschaft
Folge 396 (60 Min.)Ob gegenüber Politikern, dem Weltgeschehen oder einfach nur im Straßenverkehr: Die Menschen sind dünnhäutiger geworden. Aus Kleinigkeiten entstehen Konflikte bis hin zu blankem Hass. Dünnhäutige Menschen sind leicht reizbar. Sie vertragen keine Kritik und neigen zu emotionalen Ausbrüchen. Diskursive Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden sind unmöglich. Für den gesellschaftlichen Frieden ist diese Gemengelage Gift. In einer Zeit, in der jeder seine Meinung in den sozialen Medien kundtun kann, scheint die Toleranz für andere Ansichten immer geringer zu werden. Ob es um Politik, Religion, Kultur oder den Straßenverkehr geht: Viele Menschen reagieren empfindlich oder aggressiv auf Kritik, Widerspruch oder Kleinigkeiten.Gefühlt hat sich dieser Zustand seit dem Corona-Lockdown massiv verstärkt. Doch warum ist das so? Wieso sind wir so dünnhäutig geworden? Oder ist es einfach nur ein Zeichen von Selbstbewusstsein und Engagement, sich für seine Überzeugungen einzusetzen? Über diese und viele andere spannende Aspekte des Themas diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. Sie beleuchten, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten umgehen, wie wir unsere eigene Sensibilität einschätzen und wie wir einen respektvollen und konstruktiven Dialog fördern können. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 14.03.2024 3sat Der Mensch – (k)ein Tier wie jedes andere
Folge 397 (60 Min.)Verstand und Vernunft unterscheiden uns von anderen Lebewesen. So sah das Immanuel Kant vor etwa 300 Jahren. Doch mit dem aktuellen Wissen über Mensch und Natur muss man diese Grenze neu ziehen. Die Definition dessen, was uns zum Menschen macht, entspringt unserer Fähigkeit der Selbstbetrachtung. Wir sind ein Tier von vielen, allerdings ein besonders invasives. Das verdanken wir unserem Verstand und all dem, was wir mit ihm erschaffen und anrichten. Verglichen mit den Dinosauriern, die fast 190 Millionen Jahre auf der Erde lebten, ist der Mensch als Homo sapiens erst seit Kurzem, seit rund 300.000 Jahren, auf der Erde unterwegs.In dieser Zeit hat er es dank seiner Sonderausstattung – mit Verstand und Bewusstsein – geschafft, seine Überlebenschancen effektiv zu verbessern. Auf Kosten seiner Umwelt wurde der Mensch zum raffinierten Räuber und zu einer Bedrohung nicht nur vieler Mitlebewesen, sondern mittlerweile auch seiner eigenen Spezies. Dabei betrachtet er sich als überlegenes Wesen, eine fatale Fehlinterpretation. Der Mensch wird die Natur und viele ihrer Phänomene nie vollständig verstehen. Was bedeutet das für unser aktuelles Verständnis von uns selbst und der Natur? Sind die Gedanken des großen Aufklärers Immanuel Kant heute noch aktuell, oder brauchen wir, wie es mittlerweile immer mehr Wissenschaftler fordern, eine zweite Aufklärung? Ist es gerechtfertigt, ein ganzes Erdzeitalter, das Anthropozän, nach den Menschen zu benennen? In der Tat sind unsere Einflüsse auf die Erde nicht mehr übersehbar und langfristig. Der Mensch ist ein geologischer Faktor. Doch ist es nicht gleichzeitig auch eine gewaltige Selbstüberschätzung: Menschen sind weder der Anfang der Geschichte des Lebens, noch werden sie sie beenden. Der Planet Erde wird die menschliche Spezies in jedem Fall überleben. Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 11.04.2024 3sat Kulturkampf ums Essen
Folge 398 (60 Min.)Unser Essen ist identitätsstiftend. Eine gute Küche spiegelt Kultur, Identität, soziale Trends wider. Die Ernährung von Gesellschaften zu verändern, ist eine Aufgabe über Generationen. Oft essen wir, was uns nicht guttut. Statt zu Obst und Nüssen greifen wir zu Chips und Schokolade. Und von allem essen wir zu viel: Zu viel Zucker, zu viel Fleisch, zu viel Fett. Dabei ist uns häufig gar nicht bewusst, warum wir was essen – und wie viel. Unsere Essgewohnheiten werden von einer Vielzahl verschiedener Faktoren beeinflusst – ohne dass wir es merken. Doch unser Geist ist willig: Der Ernährungsreport 2023 zeigt, dass rund 90 Prozent der Menschen gesund essen wollen.Über 70 Prozent legen Wert darauf, dass ihre Lebensmittel umwelt- und klimafreundlich produziert werden. Deshalb hat sich der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“, ein interdisziplinäres Gremium, Gedanken über die Zukunft der Ernährung gemacht und konkrete Vorschläge erarbeitet – vom kostenfreien Mittagessen für alle Kinder über bewusstes Einkaufen bis zum Tierwohl. Ein wichtiger Punkt ist die Gemeinschaftsverpflegung in Krankenhäusern, Reha-, Senioren- und Pflegeeinrichtungen, die auf gesunde, ausgewogene Kost statt auf abgepackte günstige Ware setzen soll. Was kann in Zukunft getan werden, um Prävention von Krankheiten und die Förderung eines gesunden Lebensstils bei guter Küche schon frühzeitig zu erreichen? Im Projekt „Klasse Kochen“ engagiert sich ein Profi-Spitzenkoch für ausgewogene Ernährung bei Kindern an Schulen. Kinder sollen dabei Spaß an Lebensmitteln und am Selbstkochen entwickeln. Wäre ein solches Projekt auch auf Kitas übertragbar? Warum ist es bereits für Kita-Kinder wichtig, zu wissen, was sie essen – in einer Überflussgesellschaft, in der wir gewohnt sind, jederzeit alles zu bekommen, was wir gewohnt sind? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 25.04.2024 3sat Kampf um Arbeit
Folge 399 (60 Min.)Keine Woche ohne Streiks: Arbeiter fordern bessere Bezahlung bei weniger Arbeitszeit. Es herrscht Fachkräftemangel, und Unternehmen buhlen um Arbeitskräfte. Die Arbeitswelt steht Kopf. Dabei liegen die Vorstellungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern Welten auseinander: Vier-Tage-Woche oder Mehrarbeit? Früher in Rente oder schuften bis 70? Wie sieht eine Arbeitswelt aus, die allen Generationen und Anforderungen gerecht wird? Neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz, Globalisierung und Demografie verändern die Arbeitsprozesse.Arbeit wird flexibler, internationaler, anspruchsvoller. New Work bietet Chancen, aber auch Risiken. KI bedroht viele Jobs, schafft aber auch neue. Wie gestalten die Gewerkschaften, starke Player im Arbeitskampf, die Arbeitsbedingungen von morgen? Welche tragfähigen Konzepte gibt es? Wie begegnen wir dem Fachkräftemangel, der in immer mehr Bereichen dramatische Auswirkungen zeigt? Welche zukunftsfähigen Alternativen gibt es zu den alten Arbeitsmodellen? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.05.2024 3sat Quoten, Wokeness, Inklusion – Was ist gerecht?
Folge 400 (60 Min.)Ob in Bildung, Beruf oder in unserer Gesellschaft: Alle Menschen sollten die gleichen Chancen bekommen, sich frei zu entfalten. Aber die Realität sieht anders aus. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich zu behandeln. Doch das reicht nicht. Gleiche Chancen für alle bedeutet mehr als gleiches Recht für alle. Benachteiligte Gruppen brauchen eine Starthilfe, damit ihre Chancen gegenüber Nicht-Benachteiligten gleich sind. Das Streben nach einer inklusiveren Gesellschaft ist aller Ehre und Anstrengungen wert. Doch die Inklusion in den Schulen zum Beispiel bringt mehr Ärger als Nutzen. Was hat sich in Fragen der Chancengleichheit in Bildung, Beruf und Gesellschaft wirklich getan? Es ist an der Zeit, eine offene Diskussion über Chancengleichheit zu führen und die Vielfalt der Gesellschaft als Stärke zu erkennen. Über diese und viele andere interessante Aspekte des Themas diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 16.05.2024 3sat Gesund durch KI
Folge 401 (60 Min.)Künstliche Intelligenz wird die Medizin revolutionieren. Algorithmen und neuronale Netzwerke eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für Prävention, Früherkennung, Diagnose und Therapie. Schon heute kann die KI in beliebig vielen Patientendaten Muster erkennen. Sie analysiert in kürzester Zeit Symptome, Therapien und Krankheitsbilder von vielen Patienten und zieht daraus Rückschlüsse auf die richtige Therapie für den Einzelnen. Durch die Kombination von Patienteninformationen zu Alter, Geschlecht oder Konstitution mit den Daten zu Symptomen, Diagnose, Krankheitsverlauf und Therapie entsteht durch den Einsatz von KI ein deutlich individuelleres und präziseres Bild von Erkrankungen und deren Entstehen.Im Ergebnis bedeutet das die Möglichkeit einer auf den einzelnen Menschen passgenau abgestimmten Behandlung mit deutlich besseren Heilungschancen. Auch die Prävention wird vom Einsatz der neuen Technologien massiv profitieren. Sogar zum frühestmöglichen Zeitpunkt, wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte genetische Dispositionen zu erkennen und auszuschalten. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte könnte Deutschland eine Vorreiterrolle in der medizinischen Forschung einnehmen. Heute schon helfen neuronale Netzwerke und Algorithmen bei der Früherkennung verschiedener Krebsarten und bei der Entwicklung einer individuellen Therapie. Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten ergeben sich auch in der Diagnostik. Schon bald könnte es Ärzten weltweit möglich sein, mit Augmented-Reality-Brillen direkt in den menschlichen Körper zu blicken. Ärzte sind mittels KI-Apps in der Lage, Laborergebnisse sehr viel schneller auszuwerten und personalisierte Therapieempfehlungen zu geben. KI gesteuerte Robotik unterstützt Chirurgen bei komplexen Eingriffen, bei denen es um Millimetergenauigkeit geht. Wunderbare neue Medizinwelt? Sind die Daten, auf deren Basis KI-Systeme lernen, ausreichend vielfältig? Welche ethischen oder datenschutzrechtlichen Fragen werden zu klären sein? Über diese und andere relevante Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 06.06.2024 3sat Brauchen wir mehr Erziehung?
Folge 402 (60 Min.)Erziehung ist die Grundlage unseres Sozialverhaltens. Und so entscheidet die Qualität der Erziehung über Lebenschancen. Gute Erziehung für alle ist daher die Grundlage für Gerechtigkeit. Doch gute Erziehung ist nicht klar definiert. Die Vorstellung davon verändert sich mit der Zeit, aber auch von Kultur zu Kultur. Der autoritäre Erziehungsstil wird bei uns von vielen abgelehnt. Stattdessen kultivieren wir eher ein hierarchiefreies Miteinander. An der Erziehung eines Menschen sind viele beteiligt: Familienmitglieder, aber auch Institutionen wie Kindergarten, Schule und Vereine.Entsprechend vielfältig sind die Erziehungsstile und die Wirksamkeit. Eine einheitliche Vorstellung von einer guten Erziehung gibt es weder innerhalb eines Kulturraums, geschweige denn über kulturelle Grenzen hinweg. Antipädagoginnen und Antipädagogen weisen sogar jede Form der erzieherischen Intervention als Manipulation oder gar Gewalt zurück. Wie viel Erziehung braucht also ein Kind? Und wer sollte sie leisten: die Familie oder Institutionen wie die Schule? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.06.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 13.06.2024 3sat Was soll ich tun?
Folge 403 (60 Min.)Als Aufklärer stand Immanuel Kant für die Idee des Weltbürgertums, weltumspannenden Frieden und eine universal geltende Ethik. Von all diesen ethischen Idealen sind wir weit entfernt. „Was soll ich tun?“, ist eine von Kants vier philosophischen Fragen, die er für wesentlich hielt. Seine Ethik zeigt universell geltende Regeln und Grundsätze auf, basierend auf der menschlichen Vernunft. Dazu gehört auch ein respektvoller Umgang mit der Natur. Heute, 300 Jahre später, befindet sich die Menschheit in einer Phase planetarer Umwälzungen. Die Klimakrise, kriegerische Konflikte und ein weltweit voranschreitender Nationalismus scheinen das, was in den Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg erreicht wurde, zu gefährden.Das globale Zusammenleben wird immer komplizierter und von Konflikten belastet. Das, was wir als unsere gemeinsamen ethischen Wertmaßstäbe festgelegt hatten, wird nun mehr und mehr infrage gestellt. Moralische Tatsachen werden ebenso angezweifelt wie die universale Geltung von ethischen Grundsätzen oder Gesetzen. Lässt sich Kants radikaler Universalismus heute noch halten? Wie würde Kant auf die Kritik der identitären Bewegungen reagieren, die seinem Denken Rassismus vorwirft? Und wie sollen wir mit dem Zerbrechen internationaler Rechtsordnungen umgehen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen im Rahmen der „phil.COLOGNE“ (11.-18.6.2024). (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 20.06.2024 3sat Brain-Hacks. Wer schützt unsere Gedanken?
Folge 404 (60 Min.)Über Gehirn-Computer-Schnittstellen können Computer Signale aus dem menschlichen Gehirn auslesen. Daher muss das Recht des Menschen an seinen eigenen Gedanken gesetzlich geschützt werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Kopplung sind vielfältig. So könnten in Zukunft Gehirnsignale direkt in Sprache umgewandelt werden. Manche Schlaganfallpatienten könnten so wieder mit ihrer Umgebung kommunizieren. Die rasanten Entwicklungen in den Neurowissenschaften und der KI werfen heikle ethische Fragen auf. So utopisch das vor vielleicht zehn Jahren noch klang, so realistisch ist es inzwischen, dass Computer mit dem menschlichen Gehirn gezielt interagieren. Es handelt sich zunächst um Methoden, die neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Alzheimer entgegenwirken sollen.Dabei kommen Methoden zum Einsatz, die eine Verschaltung von Gehirn und Maschine herstellen und Informationen austauschen. Ein wenig anders verhält es sich mit KI-Systemen. Hier liest eine Software Informationen ein, die dem menschlichen Gehirn entstammen. Sprich: Ein Text oder ein Bild, das ein menschliches Gehirn erschaffen hat, wird ausgewertet und zu Ähnlichem verarbeitet. Beide Methoden werfen ethische Fragen auf: Unsere Gedanken gehören uns. Doch wie formulieren und implementieren wir ein Copyright auf unsere Gedanken? Forscher fordern schon eine Anpassung der Menschenrechte. Über diese und viele andere Aspekte diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 11.07.2024 3sat Was kann ich wissen?
Folge 405 (60 Min.)Das Wissen der Menschheit nimmt stetig zu. Doch je mehr wir wissen, desto mehr erkennen wir auch, was wir nicht wissen. Und Nichtwissen führt oft zu gesellschaftlichen Verwerfungen. Umgekehrt ist Wissen – und damit eine aufgeklärte Gesellschaft – die Grundlage für eine stabile Demokratie. „Was kann ich wissen?“ ist eine von Kants philosophischen Fragen. Und sie ist aktueller denn je. Denn nie war Wissen so flüchtig wie heute. Eine absolute, für alle gleichermaßen gültige Wahrheit gibt es nicht. Es gibt nur Annäherungen an die Wirklichkeit. Das gilt für die Wissenschaft genauso wie für den Journalismus.Die Annäherungen an die Wirklichkeit gelingen mal besser und mal schlechter. Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört das Benennen von Unsicherheiten oder gemachten Einschränkungen. Journalisten legen idealerweise ihre Perspektive auf die Wirklichkeit offen. Das Dilemma des Journalismus: Sender sind nicht mehr auf Sendeanstalten oder Verlage angewiesen. Sie suchen sich ihre eigenen Kanäle, um ihre Wahrheiten zu verbreiten. Social-Media-Kanäle wie TikTok und Telegram sind ohne Aufwand leicht zu bespielen. Eine nach universal gültigen Regeln geprüfte Auswahl von Nachrichten wird immer unbedeutender. Der Weg ist frei für unzählige Wahrheiten auf unzähligen Kanälen. Die Wissenschaft steht vor einem ähnlichen Problem: Wissenschaftliche Arbeiten sind immer weniger von Publikationen in wissenschaftlichen Magazinen abhängig. Auch ihre Verfasser suchen sich ihre eigenen Wege zu den Empfängern und entziehen sich damit den üblichen Prüfprozessen des Wissenschaftsapparats. Stehen wir vor einer Welt ohne Journalismus? Verliert Wissenschaft ihre Glaubwürdigkeit – und damit ihren Wert für die Gesellschaft? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 29.08.2024 3sat Aufbruch Afrika
Folge 406 (60 Min.)Afrikas Rolle in der Welt verändert sich. Das Selbstbewusstsein des Kontinents wächst – und damit der Wille, sich aus alten Abhängigkeiten zu befreien und die Zukunft aktiv zu gestalten. Noch haben in vielen Ländern korrupte Eliten und Militärs das Sagen. Doch der Einfluss Europas und der USA ändert sich, und das hat geopolitische Konsequenzen. Chinas und Russlands Engagement in Afrika schafft neue Möglichkeiten, aber auch neue Abhängigkeiten. Politische Instabilität, Korruption, Armut: Probleme, mit denen der afrikanische Kontinent noch immer zu kämpfen hat.Aber Afrika – ein Kontinent mit über 50 Ländern, 2000 Sprachen, vielen Rohstoffen und einer sehr jungen Bevölkerung – ist im Aufbruch. Etwa die Hälfte der Afrikaner ist unter 19 Jahre alt, und schon im Jahr 2050 soll jeder vierte Mensch auf der Erde ein Afrikaner sein. Afrika beginnt, dieses gewaltige Potenzial zu entdecken und sich zu emanzipieren. Während in der Sahelzone die Anzahl vom Militär regierter Länder wächst, gehen in Kenia, Südafrika und dem Senegal junge Menschen auf die Straße und kämpfen gegen Korruption und für eine bessere Zukunft. Auch wenn die koloniale Vergangenheit nicht vergessen ist und ihre Folgen bis in die Gegenwart spürbar sind, steht der Kontinent am Beginn einer neuen Zeit. Immer mehr Afrikaner fordern eine Abkehr von der Opferrolle und wünschen sich stattdessen Freiheit und Selbstbestimmung. Innovation und Gründergeist sorgen in einigen Ländern Afrikas, zum Beispiel in Botswana, bereits für ein beachtliches wirtschaftliches Wachstum. So stellen sich auch für Europa viele wichtige Fragen: Wohin entwickelt sich Afrika? Wie lassen sich die Beziehungen zwischen Europa und Afrika stabilisieren? Wie zuverlässig sind die europäischen Zusagen für Afrika, an Nachhaltigkeitsprinzipien festzuhalten, um den Folgen des Klimawandels Rechnung zu tragen, für die gerade reiche Industrienationen verantwortlich sind? Wie wird der Umgang mit Klimaflüchtlingen in rechtspopulistischen Staaten sein? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 19.09.2024 3sat Prävention am Ende
Folge 407 (60 Min.)Die medizinische Versorgung in Deutschland ist teuer und ineffizient, wie die vergleichsweise niedrige Lebenserwartung der Deutschen zeigt. Das Problem: der Mangel an wirksamer Prävention. Es erkranken immer mehr Menschen an den Folgen des modernen Lebensstils. Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung haben zu einem Anstieg von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 und Adipositas geführt. Nach wie vor werden zu viel Alkohol und Tabak konsumiert. Experten sehen vor allem in der Prävention unausgeschöpftes Potenzial für eine langfristige Verbesserung der Gesundheitslage.Dafür braucht es einschneidende Veränderungen im Gesundheitssystem. Wenn Früherkennung besser greifen soll, erfordert dies beispielsweise eine umfassendere Digitalisierung des Gesundheitssystems. Dem scheinen Datenschutz und eine große Zahl an komplizierten Regulierungen entgegenzustehen. Wie können Datenschutz und Datennutzen in Einklang gebracht werden, damit am Ende auch die Prävention besser gelingen kann? Aber auch die Erreichbarkeit von Bürgern und Bürgerinnen, die potenziell eher ungesund leben, ist ein wichtiges Thema. Untersuchungen zeigen, dass bei Gesundheitsrisiken der soziale Status und die Lebensumwelt eine entscheidende Rolle spielen. In armen Gegenden sterben Menschen signifikant früher als in reichen. Wie können auch diese Menschen sinnvoll und nachhaltig in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld erreicht werden? Der Klimawandel stellt die Gesundheitssysteme vor neue, an Intensität zunehmende Herausforderungen. Hitze, Luftqualität, Pandemien und Stress sind Faktoren, die als Folgen eines veränderten Klimas auch die Gesundheit von Menschen beeinträchtigen. Wie kann hier langfristig vorgesorgt werden? Unser Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Prävention spielt eine entscheidende Rolle, um die Belastungen des Systems durch den demografischen Wandel, die Klimakrise und den modernen Lebensstil wirksamer zu begrenzen. Gute Präventionsangebote können das Gesundheitssystem verbessern und entlasten. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen über mögliche Auswege aus der Präventionskrise. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 26.09.2024 3sat Die Kollektiv-Kraft
Folge 408 (60 Min.)Menschen leben in kollektiven Strukturen. Doch die Werte vieler Gemeinschaften verblassen allmählich. Und damit verlieren Menschen auch Teile ihrer Identität. Selbst Wertesysteme, die lang unantastbar schienen, verlieren an Kontur: Religionsgemeinschaften, politische Parteien, Regierungssysteme. Vieles ist volatil, wenig ist gewiss. Unsere Gesellschaftsordnungen geraten ins Wanken, und den Menschen fehlt Halt. Gleichzeitig entwickeln sich neue Arten von Kollektiven: genossenschaftliches Wohnen, solidarische Landwirtschaftsprojekte und Kollektive zur Unternehmensführung.Die Verlagerung von Verantwortung auf Viele hat Vorteile: Es kommt nicht zu Machtanhäufung und damit zu asymmetrischen Arbeitsbeziehungen. Die Kreativität von Vielen und zusammengeschaltete Netzwerke eröffnen mehr Möglichkeiten. Und: Kollektive Verantwortung ermöglicht Selbstwirksamkeit und damit ein gesünderes Verhältnis zu Arbeit. Was macht einen guten Kollektivismus aus, und wie viel Kollektivismus braucht unsere Gesellschaft? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 10.10.2024 3sat Chinas Machtanspruch
Folge 409 (60 Min.)Chinas machtpolitische Entwicklung verändert die bisherige Weltordnung. Alte Bündnisse brechen, neue formieren sich. In dieser instabilen Lage drohen neue und gefährliche Konflikte. Die Muskelspiele des neuen geopolitischen Keyplayers China versetzen nicht nur die unmittelbaren Nachbarn in Alarmbereitschaft, sondern sorgen weltweit für Nervosität. Dazu birgt die anhaltende Verletzung der Menschenrechte innerhalb des Landes Konfliktpotenzial. Die Begehrlichkeiten Chinas – ob im indopazifischen Raum, Afrika oder anderswo – tangieren die Interessen der bisherigen Weltmächte und vieler weiterer Staaten unmittelbar.Es geht um Macht und Kontrolle – in der Welt, aber auch über das eigene Volk. China hat in den letzten Jahrzehnten eine wirtschaftliche und militärische Entwicklung durchlaufen, die das Land zu einem zentralen Akteur auf der globalen Bühne gemacht hat. Doch der Aufstieg zur Weltmacht hat seinen Preis. Selbst wenn die chinesische Regierung Teilen der Bevölkerung den versprochenen Wohlstand brachte, soziale Ungleichheit gibt es nach wie vor. Unter den 1,4 Milliarden Menschen wächst die Unzufriedenheit, aber auch die Angst vor totaler Überwachung, Kontrolle und staatlicher Willkür. Immer wieder sorgt Chinas Menschenrechtspolitik für Kritik. Die massive Einschränkung der Meinungsfreiheit durch restriktive Eingriffe ist nur eine Variante von vielen Verstößen gegen international anerkannte Menschenrechte. Chinas großer Philosoph Konfuzius erkannte schon vor 2500 Jahren, wie bedeutend moralische Integrität, die Achtung anderer Menschen und die Harmonie mit dem Weltganzen ist. Was hat sich China davon bewahrt, welche Ambitionen hat China und wie könnte sich die neue Weltordnung verändern? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 31.10.2024 3sat Wie wir uns orientieren
Folge 410 (60 Min.)Für unsere Orientierung gibt es Rezeptoren im ganzen Körper. Permanent senden sie Signale ans Gehirn, die dort in nahezu Echtzeit verarbeitet werden. Nur so können wir uns koordiniert bewegen. Um unsere Bewegungen und auch unser Gedächtnis besser verstehen zu können, arbeiten Forscherinnen und Forscher an einem tieferen Verständnis unserer kognitiven und neuronalen Prozesse. Dabei spielt die Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle. Auf der einen Seite hilft die KI, menschliche neuronale Prozesse zu verstehen. Andersherum verbessert unser Verständnis darüber die Fehlertoleranz und die Anpassungsfähigkeit von KI-Systemen.Künstliche Systeme lernen, sich sicher zu bewegen. Und auch im Bereich der Gedächtnisbildung gibt es Fortschritte: Kognitive Karten, wie sie das Gehirn erstellt, helfen auch der künstlichen Intelligenz. Wie weit ist die Forschung in der KI und in der Neurowissenschaft? Welche Rolle spielt die menschliche Psyche mit ihren vielfältigen Emotionen? Wie ähnlich sind sich menschliche und virtuelle Orientierungslosigkeit? Und wo liegen die notwendigen Grenzen zwischen humanem und virtuellen „Systemen“? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in der „scobel“-Sendung „Wie wir uns orientieren“. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 14.11.2024 3sat Der Klimakollaps
Folge 411 (60 Min.)Das Meer und die Atmosphäre: Um das Klima zu beschreiben, muss man beides und besonders das Zusammenwirken verstehen. Das macht Vorhersagen über den Klimawandel so kompliziert. Die Erwärmung durch den Klimawandel hat massive Rückkopplungseffekte auf den Klimawandel selbst. Je mehr der Temperaturanstieg auch die Meere aufheizt, desto mehr verändert sich deren Verhalten – und damit wiederum die Atmosphäre. Über kurz oder lang werden sich die eingestellten Strömungsverhältnisse massiv verändern und damit die Klimaverhältnisse auf den Kopf stellen. Das könnte sogar so weit gehen, dass es in Deutschland nicht wärmer, sondern sehr viel kälter werden könnte.Das ändert wiederum nichts daran, dass die Menschheit dringend handeln muss. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen mit globalen Folgen. Viele Landstriche werden unbewohnbar werden. Neue Konflikte in globalen Dimensionen drohen. Die Frage ist: Wie kommen wir ins Handeln? Wie kommunizieren wir den Klimawandel, dass er uns ins Handeln bringt und uns nicht in Schockstarre verharren lässt, sodass wir einfach weitermachen wie bisher – bis es wirklich zu spät ist? Alarmismus treibt Menschen im Zweifel in die Arme von Populisten. Verharmlosung führt zu einem Weiter-so. Welche Narrative bringen uns ins Handeln? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Antje Boetius ist Meeresbiologin, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Professorin für Geomikrobiologie an der Universität Bremen und Professorin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Nachhaltige Transformation an der FH Münster und hat das Buch „Radikal Emotional“ geschrieben. Özden Terli ist Meteorologe und ZDF-Wettermoderator. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 21.11.2024 3sat Was können wir hoffen?
Folge 412 (60 Min.)In Krisenzeiten suchen Menschen nach einem Zeichen der Hoffnung. Aber Vorsicht: Hoffnung folgt nicht immer der Vernunft. Sie ist ein schwer greifbares Phänomen, das auch trügen kann. Es kann sich als folgenschwerer Irrtum erweisen, auf Dinge zu hoffen, die erkennbar nicht erfüllt werden können. Hoffnung bezieht sich immer nur auf die Möglichkeit von etwas. Optimismus dagegen sieht das Wünschenswerte als wahrscheinlich an. Hoffnung gibt es nie ohne Zweifel. Wer hofft, befindet sich grundsätzlich in unsicherer Lage. Immanuel Kant gilt ihr als zentraler Vertreter in der Philosophiegeschichte: Die Frage „Was dürfen wir hoffen?“ ordnet Kant als eine der zentralen Fragen der Philosophie ein.Er war es auch, der darauf hinwies, dass Hoffnung dort ins Spiel kommt, wo der Mensch an die Grenzen seines Wissens und Handelns stößt. Klimawandel und multiple Krisen und Kriege – warum brauchen wir heute Hoffnung? Wie hängen Hoffen und Handeln zusammen? In welchem Verhältnis steht Hoffnung zu Angst und Mut? Und was verstehen wir unter radikaler Hoffnung? Was sollten wir hoffen, was nicht? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 12.12.2024 3sat
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu scobel direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu scobel und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.