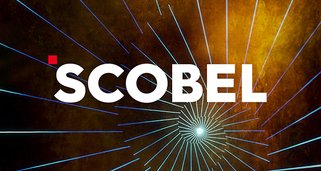2025
Sex im Kopf
Folge 413 (60 Min.)Um Sex vermeintlich besser und intensiver zu erleben, greifen immer mehr Menschen auf stimulierende Substanzen, Medikamente und Drogen zurück. Doch das birgt auch Gefahren. Menschen nutzen seit Urzeiten Substanzen, um ihre sexuelle Performanz zu verbessern. Diese wirken meist auf das Gehirn. Das Ziel: intensivere Gefühle und mehr Ausdauer beim Liebesspiel. Denn Sex spielt sich in erster Linie im Kopf und nicht in den Genitalien ab. Sex und Rauschzustände haben unsere Evolution und Kultur geprägt. Die körpereigenen Botenstoffe wie Dopamin und Serotonin spielen eine entscheidende Rolle bei Anziehung und Lust. Manche Menschen greifen für intensivere sexuelle Intimität oder den ultimativen „Kick“ auch auf chemische Substanzen zurück.Doch der sogenannte Chemsex hat gefährliche Seiten – Abhängigkeit und riskanter, ungeschützter Sex haben gravierende Folgen für die Gesundheit. Dabei kann Sex auch ohne Drogen intensiviert werden. Wie beeinflussen Drogen unser Sexualverhalten? Welche chemischen Reaktionen lösen sie im Körper aus, und warum gibt es diesen menschlichen Hang zum Rausch? Können wir die komplexe Welt der menschlichen Lust mit ihren biochemischen Auswirkungen schon hinreichend erklären? Und welchen Einfluss haben die verschiedenen Substanzen auf unser Gehirn und Verhalten? Über „Sex im Kopf“ in all seinen Facetten diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 09.01.2025 3sat Biologie aus dem Baukasten
Folge 414 (60 Min.)Ingenieure, Informatiker, Chemiker und Biologen kreieren künstliche biologische Systeme. Die synthetische Biologie verändert die Zukunft und definiert die Grenzen der Wissenschaft neu. Fotosynthese aus dem Reagenzglas, Proteine, die schmutziges Wasser reinigen, künstliche Organismen, die im Labor gezüchtet werden. Neue Technologien, etwa genetische Verfahren und bald künstliche Intelligenz, revolutionieren alles, was bisher Leben ist. In den letzten Jahren formierte sich mit der synthetischen Biologie eine neue wissenschaftliche Disziplin, die das Potenzial hat, den zahlreichen Herausforderungen und Krisen der Gegenwart zu begegnen. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von biologischen Systemen, die wie elektrische Schaltkreise funktionieren, und die Synthetisierung von Genen und ganzen Genomen.Proteine dienen dabei als Bausteine und Werkzeuge. Dafür werden sie so modifiziert, dass sie spezifische Funktionen erfüllen, die in der Natur noch nicht vorkommen. Viel verspricht man sich von den neuen Technologien bei der Entwicklung von Medikamenten und personalisierten Therapien. Auch in der Landwirtschaft gibt es Einsatzmöglichkeiten – so könnte man beispielsweise Pflanzen mit verbesserten Eigenschaften züchten. Das ist verlockend und faszinierend, aber nicht ohne Risiken und Gefahren: Immer wieder berühren Entwicklungen und ihre Anwendungen ethische Normen oder führen zu einem direkten Konflikt, wie zum Beispiel die Lebendexperimente mit dem menschlichen Genom in China. Noch bestimmen Menschen die Werkzeuge, die die synthetische Biologie entwickeln, doch in Kombination mit KI könnten sich viele Prozesse verselbstständigen: eine entfesselte biologische-technische Kreativität. Die Forschung läuft auf Hochtouren – was ist der aktuelle Stand? Wie kann synthetische Biologie reguliert werden, und welchen gesetzlichen Rahmen braucht es dafür? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 23.01.2025 3sat Die Übermacht der Alten
Folge 415 (60 Min.)Horrende Mieten, kaum Rente, Klimanotstand: Die junge Generation ist frustriert wegen der Hinterlassenschaft der Alten. Und sie müssen noch für üppige Renten und Pflege der Alten aufkommen. Und so stellen die Jungen zu Recht die Gerechtigkeitsfrage. Der Generationenvertrag gerät ins Wanken: Die Jungen zweifeln an einem System, das ihnen selbst keine Sicherheit mehr bietet. Und damit steht das ganze Sozialsystem auf der Kippe. Der Konflikt zwischen den Generationen ist nicht neu, aber scheint eine neue Dimension erreicht zu haben.Unsere alternde Gesellschaft, sich wandelnde Werte und unterschiedliche Lebensrealitäten führen zu Spannungen, die unser Zusammenleben vor große Herausforderungen stellen. Warum geraten Gen Z und Boomer so häufig aneinander? Wie prägen historische, wirtschaftliche und kulturelle Dynamiken den Generationenkonflikt? Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf Wirtschaft und Sozialsysteme? Und wie könnte ein gerechter und zukunftsfähiger Generationenvertrag aussehen? Darüber diskutiert Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 06.02.2025 3sat Satire-Journalismus
Folge 416 (60 Min.)Satire übernimmt immer häufiger die Rolle des politischen Journalismus. Das steigert das Interesse an Politik – geht aber möglicherweise auf Kosten der journalistischen Seriosität. Formate wie die „heute-show“, „Die Anstalt“, „extra 3“ und das „ZDF Magazin Royale“ haben die Medienlandschaft verändert. Humor schafft es, mehr Menschen für Themen aus Politik und Gesellschaft zu interessieren und öffentliche Debatten anzuregen. Doch darf Satire das? Satiresendungen wurden in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum festen Bestandteil des politischen Journalismus. Ihre Akteure berufen sich auf die Freiheit der Satire und schaffen es, ein Millionenpublikum zu erreichen, darunter auch Menschen, die sich vorher wenig für politische und gesellschaftliche Themen interessierten.Das ist zweifellos ein Mehrwert für Demokratie und Gesellschaft – solange wichtige journalistische Grundprinzipien wie Recherchequalität und Seriosität gewahrt bleiben. Welche Kriterien, welche Grenzen müssen für Satire, für Comedy im Journalismus gelten? Weshalb ist der Mix zwischen ernsthafter Berichterstattung und Unterhaltung so erfolgreich? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 20.02.2025 3sat Riten und Rituale
Folge 417 (60 Min.)Schon immer haben Riten Tradition und Moderne verbunden und auch die jeweilige Gesellschaft definiert. Übergangsriten sind so alt wie die Menschheit selbst – ein universelles Phänomen. Auch in unserer modernen Gesellschaft spielen Übergangsriten eine zentrale Rolle. Etwa beim Wechsel von einem sozialen Status in einen anderen – den Übergang vom Kind zum Erwachsenen oder vom Ledigen zum Verheirateten und schließlich vom Leben in den Tod. Die Abläufe und Aufgaben, die dabei helfen sollen, die Hindernisse des Übergangs zu bewältigen, werden von Generation zu Generation weitergegeben.In traditionellen Gesellschaften haben sie eine klare Struktur: Auf die Trennung von der alten Lebensphase folgt die Schwellenzeit der Transformation und schließlich der Wiedereintritt in die Gemeinschaft mit dem neuen Status. Von Initiationsriten indigener Gemeinschaften bis hin zu religiösen Zeremonien wie der Bar Mizwa im Judentum oder der Firmung im Christentum – Übergangsriten sind eng mit kulturellen und religiösen Praktiken verknüpft. Sie dienen sowohl der individuellen Orientierung als auch der Stärkung der Gemeinschaft. Traditionelle Riten schaffen zudem Identität, Ordnung und Stabilität und bieten einen Rahmen, um tiefgreifende Veränderungen zu bewältigen. Für Psychologen und Psychologinnen haben Übergangsriten weitere wichtige Funktionen: Sie helfen etwa, mit Unsicherheit und Veränderung umzugehen und bieten Orientierung in schwierigen Lebensphasen. Rituale geben Struktur und emotionale Sicherheit. Besonders in der Pubertät oder beim Eintritt ins Rentenalter sind symbolische Handlungen ein Anker in einer oft als unsicher und fremd empfundenen, neuen Welt. Fehlen diese Übergangsriten, so kann das zu Identitätskrisen führen. In postmodernen Gesellschaften stehen Übergangsriten im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation – neue, säkulare Riten entstehen in einem zunehmend pluralistischen Umfeld. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen darüber, wie Rituale Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden können – und was sie uns über die menschliche Natur verraten. Wie haben sich Übergangsriten in der modernen Gesellschaft verändert? Wie definieren wir heute Identität – als Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, oder sehen wir uns als Individuum mit ganz persönlichen Vorlieben? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 06.03.2025 3sat Biotop Mensch
Folge 418 (60 Min.)Der Mensch ist ein lebendiges Ökosystem. In und auf seinem Körper leben mehr fremde Organismen als dieser Zellen hat: Bakterien, Pilze, Amöben, Viren und Milben bilden das Mikrobiom. Im Darm, auf der Haut, in der Mundhöhle oder im Atemtrakt – überall tummeln sich Billionen von Mikroben. Sie sind keineswegs passiv, sondern helfen bei der Verdauung, schützen vor Krankheitserregern, beeinflussen das Immunsystem und haben Einfluss auf die Psyche. Viele der Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln, leben in Symbiose. Gerät dieses empfindliche Gleichgewicht aus der Balance, beispielsweise durch Stress, Umweltveränderungen, ungesunde Ernährung, die Einnahme von Antibiotika, kann das gesundheitliche Probleme verursachen.Die neuere Forschung liefert immer mehr Hinweise darauf, dass das Mikrobiom eine zentrale Rolle bei vielen Erkrankungen wie Depression, Diabetes und Allergien spielt. Der Mensch ist also kein isoliertes Individuum, sondern ein Superorganismus, in dem viele aufs engste zusammenarbeiten. Deshalb ist es wichtig, dieses effiziente und gleichzeitig fragile Kollektiv zu verstehen, um es schützen zu können. Wie funktioniert das Mikrobiom genau? Wie schützt es vor Krankheiten? Was können wir selbst zum Schutz unseres Mikrobioms beitragen? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen und wirft einen Blick auf den aktuellen Stand der Forschung. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 20.03.2025 3sat Das Wesen des Krieges
Folge 419 (60 Min.)Kriege sind grausam und unmenschlich. Sie verbreiten unendlich viel Leid und Zerstörung. Kriege folgen aber auch Regeln und Strategien. Dabei spielt technischer Fortschritt eine große Rolle. Technologischer Vorsprung ist immer auch ein militärischer Vorteil. Der Krieg in der Ukraine zeigt aber auch: Gegen pure Masse kommt man selbst mit modernster Technologie schwer an. Und: Kriege zwischen konventionell hoch gerüsteten Staaten gibt es noch immer. Die westliche Wertegemeinschaft wähnte sich in einer neuen Ära einer strategischen Ordnung, die bewaffnete Konflikte zwischen Großmächten ausschloss. Die militärischen Notwendigkeiten orientierten sich an einer rudimentären Möglichkeit der Landesverteidigung und vereinzelten und gezielten Einsätzen zur Krisenintervention fernab der eigenen Landesgrenzen.Dass das schon immer eine Illusion war, zeigen viele grausame Kriegsschauplätze und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine und das Gebaren Russlands gegenüber den NATO-Staaten. Tote Zivilisten, Vertreibung, Hunger: Spätestens seit dem Terror der Hamas und der israelischen Gegenoffensive tobt eine Debatte um die Regeln eines Kriegs: Was ist legitime Selbstverteidigung? Was ist ein Kriegsverbrechen? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen in der 3sat-Gesprächssendung „scobel – Das Wesen des Krieges“. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 03.04.2025 3sat Nostalgie: War früher alles besser?
Folge 420 (60 Min.)Nostalgie ist ein Zeitphänomen. Wir blicken in eine verklärte Vergangenheit, um mit einer missliebigen Gegenwart klarzukommen. Sie verstellt aber auch den Blick auf die Zukunft. Besonders in Krisenzeiten suchen Menschen Zuflucht im Vertrauten. In nostalgischen Momenten erscheint alles Vergangene besser. Dabei wird meist die historische Realität verdrängt: individuell oder im kollektiven Empfinden von Kultur, Politik und Gesellschaft. Die Sehnsucht nach der „guten, alten Zeit“ ist mehr als bloße Sentimentalität: Sie kann verbinden oder spalten, beruhigen oder radikalisieren.Gerade in unsicheren Zeiten wird Nostalgie zum festen Anker – doch sie birgt auch die Gefahr, Entwicklungen zu verklären und Fortschritt zu hemmen. Die Wissenschaft hingegen bemüht sich um einen differenzierten Blick auf die Vielfalt und die Ambivalenz dieses komplexen Phänomens. Ist Nostalgie wirklich das Gegenteil von Fortschritt, oder kann Nostalgie zur Verbesserung von Gegenwart und Zukunft beitragen? Darüber diskutiert Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 17.04.2025 3sat Der optimierte Mensch
Folge 421 (60 Min.)Der Mensch ist nicht perfekt. Viele seiner Konstruktionsfehler hat er durch Anpassung und Erfindungsreichtum kompensiert. Nun erreicht er durch KI die nächste Entwicklungsstufe. Wissenschaftler optimieren den Menschen durch neue Technologien unter Hochdruck. Künstliche Intelligenz eröffnet dabei unendliche Möglichkeiten und sorgt für eine atemberaubende Beschleunigung der Prozesse. Wo bleibt im Kampf gegen Schwächen der Mensch selbst? Die Revolution neuer Technologien hat den Wunsch nach bedingungsloser Optimierung verstärkt und die Konfektionierung perfekter Menschen in Gang gesetzt.Synthetische Biologie wird zusammen mit künstlicher Intelligenz Leben neu definieren. Könnte also die Vision des amerikanischen Futuristen Ray Kurzweil von Unsterblichkeit und Verschmelzung von Mensch und Maschine, der Transhumanismus, Realität werden? Lassen sich die komplexen Prozesse noch steuern? Muss alles erlaubt sein, was wissenschaftlich möglich ist? Werden alle Menschen von den Optimierungen durch die neuen Technologien beispielweise in der Medizin gleichermaßen profitieren? Über diese und andere Fragen diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 24.04.2025 3sat Verrohter Diskurs
Folge 422 (60 Min.)Öffentliche und private Kommunikation verändern sich. Diskussionen werden hitziger, der Wille zum Austausch nimmt ab. Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Demokratie. Diskurs ist ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie. Wenn verschiedene Perspektiven nicht mehr konstruktiv aufeinandertreffen, wird es schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden. Gert Scobel diskutiert mit seinen Gästen. Was vor einigen Jahren vor allem in sozialen Medien beobachtet wurde, hat inzwischen auch in persönliche und politische Debatten Eingang gefunden.Doch woran liegt das? Wie kommt es zu dieser Krise des Sprechens? Unsere Gesellschaft ist nach der Bundestagswahl polarisierter denn je. Kompromisse werden immer unwahrscheinlicher, wenn alle auf verhärteten Positionen beharren. Das ist in der Politik genauso wie in Familien- und Paarbeziehungen. doch wenn wir einander nicht mehr zuhören können, wie können wir dann miteinander ein gutes Leben führen? Wie eine Politik kreieren, die Probleme wirklich löst? Welche Formen des Kommunizierens können diese Spaltung auflösen und zu einem konstruktivem Miteinander führen? Klar ist: Wir müssen einander zuhören, auch denen, die wir als „anders“ empfinden, die unsere Gewissheiten infrage stellen. Aber: Ist die „Diskursverwilderung“ tatsächlich so omnipräsent, dass wir den Untergang der Gesprächskultur beschwören – oder übersehen wir das, was sich an Positivem eben auch entwickelt hat? Sind Respekt und Rationalität bereits verlorengegangen in den immer heftiger ausgetragenen Debatten in Talkshows und Netzkommentaren? Intellektuelle bemängeln seit Jahren den Trend, jeder Position eine Gegenposition gegenüberzustellen. Wie aber könnte man komplexer über politische Inhalte debattieren – ohne eine Position, der zwanghaft immer eine konturierte Gegenposition folgt? Brauchen wir gerade jetzt nicht mehr Eindeutigkeit in der Widerrede? Und – können wir einander besser verstehen, wenn wir akzeptieren würden, dass unsere gefühlte Wahrheit nicht unbedingt die tatsächliche oder einzige Wahrheit ist? Gert Scobel lotet mit seinen Gästen aus, welche Möglichkeiten es gibt, wieder entspannt miteinander in ein konstruktives Gespräch zu kommen – privat wie politisch. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 08.05.2025 3sat Gemeinsam gegen Demenz
Folge 423 (60 Min.)Demenz – eine der größten gesundheitlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Die Pflege, die Kosten, die Belastung der Angehörigen: Probleme, für die es bislang keine Lösungen gibt. Und die Situation spitzt sich zu: Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Demenzkranken auf etwa 2,2 Millionen stark ansteigen. Demenz gilt als eine der folgenreichsten psychischen Erkrankungen im Alter. Die Pflege und psychosoziale Betreuung ist extrem aufwendig. Die vorhandenen Pflegekräfte reichen bei Weitem nicht aus, um die steigende Zahl an Pflegebedürftigen in Zukunft – qualitativ gut – zu versorgen.Gemessen am steigenden Bedarf sinkt die Zahl junger Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Pflege entscheiden. So wird die Schere zwischen dem Versorgungsbedarf und der realen Versorgung in den kommenden Jahren weiter auseinandergehen. Eine bedürfnisgerechte Versorgung für pflegebedürftige Menschen wird bald nicht mehr gewährleistet sein können. Versorgungskonzepte müssen flexible, altersgerechte Betreuungsmodelle und Unterstützung für Angehörige umfassen. Die aktuelle Forschung zeigt, dass regelmäßige soziale Kontakte und gemeinsame Aktivitäten den Krankheitsverlauf bei Demenzkranken verlangsamen können. Arbeitgeber müssten also für betreuende Angehörige vermehrt flexible Arbeitszeiten und Homeoffice anbieten. Denn Betreuung erfolgt meist zu Hause. Spezialisierte Heime sind rar. Wie können Risikofaktoren besser identifiziert und präventive Maßnahmen effektiv umgesetzt werden, um die Inzidenz von Demenz zu senken? Welche innovativen Pflegekonzepte können entwickelt werden, um die Lebensqualität von Demenzkranken zu verbessern und die Belastung der Pflegekräfte zu reduzieren? Wie kann die soziale Isolation von Demenzkranken, insbesondere die jüngeren Betroffenen, verringert werden? Welche ethischen Richtlinien sollten bei der Pflege und Betreuung von Demenzkranken beachtet werden, um Würde und Autonomie zu wahren? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Christine von Arnim, Annette Riedel und Wolfgang Hoffmann. Christine von Arnim ist Direktorin der Klinik für Geriatrie an der Universitätsmedizin Göttingen. Die Neurologin erforscht unter anderem Ursachen und Folgen von Demenz sowie Prävention und Therapie durch Faktoren wie Ernährung, körperliche und geistige Aktivität. Annette Riedel lehrt und forscht an der Hochschule Esslingen mit den Schwerpunkten Pflegewissenschaft und Ethik. In ihrer Arbeit widmet sie sich der Entwicklung ethischer Leitlinien. Seit 2020 ist sie Mitglied im Deutschen Ethikrat. Wolfgang Hoffmann ist Geschäftsführender Direktor des „Institut für Community Medicine“ an der Universitätsmedizin Greifswald und leitet den Bereich „Versorgungsepidemiologie und Community Health“. Er untersucht unter anderem, wie ein zukunftsfähiges und resilientes Gesundheitssystem aussehen muss. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 15.05.2025 3sat Intelligenz
Folge 424 (60 Min.)Sie ist ein komplexes Phänomen, das nicht nur durch den IQ bestimmt wird: Intelligenz wird oft mit kognitiven Fähigkeiten und Problemlösungsvermögen assoziiert. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Intelligenz Erfolg und Gesundheit fördert, indem sie analytisches Denken und fundierte Entscheidungen unterstützt. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Bildung und Forschung bietet neue Möglichkeiten, diese Phänomene besser zu verstehen und zu adressieren. KI kann personalisierte Lernwege schaffen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden zugeschnitten sind und so die kognitiven Fähigkeiten fördern.Durch adaptive Lernplattformen und intelligente tutorielle Systeme können Schüler und Studenten in ihrem eigenen Tempo lernen und gezielt unterstützt werden. Gleichzeitig wirft der Einsatz von KI ethische Fragen auf, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und die Verstärkung bestehender Ungleichheiten im Bildungsbereich. Kann KI dazu beitragen, die Grenzen zwischen Intelligenz und Dummheit weiter zu verwischen, indem sie nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Intelligenz fördert? Könnte dies zu einer Gesellschaft führen, in der fundierte Entscheidungen und reflektiertes Handeln die Norm sind? Oder spielen letztendlich Eigenschaften wie Selbstbewusstsein, Disziplin, Zivilcourage oder Fantasie eine viel größere Rolle auf dem Weg zu einem gelingenden Leben als kognitive Stärke, Intelligenz und KI? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen Karoline Wiesner, Katharina Zweig und Jakob Pietschnig. Karoline Wiesner ist Professorin für Komplexitätswissenschaft am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam. Sie forscht zur Informationstheorie für komplexe Systeme, zur Dynamik der Demokratie und zu neuronalen Netzen. Katharina Zweig ist Professorin für Informatik der TU Kaiserslautern, wo sie den deutschlandweit ersten Studiengang Sozioinformatik schuf, der die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft untersucht. Jakob Pietschnig leitet den Arbeitsbereich für „Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik“ am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema Intelligenz. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 05.06.2025 3sat Wissenschaft in der Vertrauenskrise
Folge 425 (60 Min.)Wissenschaft bringt Fortschritt und Orientierung. Solange sie beschreibt, was ist. Doch Fälschungen und KI-generierte Fake-Wissenschaft bringen den Elfenbeinturm des Wissens ins Wanken. Wissenschaftliche Redlichkeit und die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis sind die Vertrauensgrundlage der modernen Wissenschaft. Doch nicht alle halten sich daran. Betrug und Fälschungen gibt es zunehmend auch an Hochschulen und Forschungsinstituten. Doch was kommt auf uns zu, wenn nun künstliche Intelligenz in den Wissenschaftsbetrieb Einzug hält? Sogenannte Paper Mills – Papiermühlen – publizieren schon heute jährlich Hunderttausende gefälschte wissenschaftliche Studien und Artikel.Diese verschmutzen nicht nur das globale Wissen, sondern unterminieren auch das Vertrauen in die Wissenschaft. Eine Studie mit KI zu fälschen, ist inzwischen kinderleicht. Das seit der Coronazeit gestiegene Vertrauen in die Wissenschaft könnte auch schnell wieder verspielt werden. Es sei denn, der Wissenschaftsbetrieb passt sich den neuen Entwicklungen an und setzt in Zukunft beim Publikationswesen statt auf Masse wieder mehr auf Klasse. Darüber diskutiert Gert Scobel diesmal mit seinen Gästen: Alena Buyx ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München. Ihre Forschung umfasst biomedizinische und öffentliche Gesundheitsethik und Fragen der Solidarität und Gerechtigkeit. 2020 bis April 2024 war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Carsten Könneker ist Wissenschaftsjournalist und Redaktionsleiter bei „Spektrum der Wissenschaft“. Von 2012 bis 2018 war er Professor für Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Gründungsdirektor des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation. Bernhard Sabel leitete bis September 2023 das Institut für Medizinische Psychologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg. Der Psychologe beschäftigt sich mit dem Phänomen des Wissenschaftsbetrugs durch Fake-Publikationen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 12.06.2025 3sat
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu scobel direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu scobel und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.