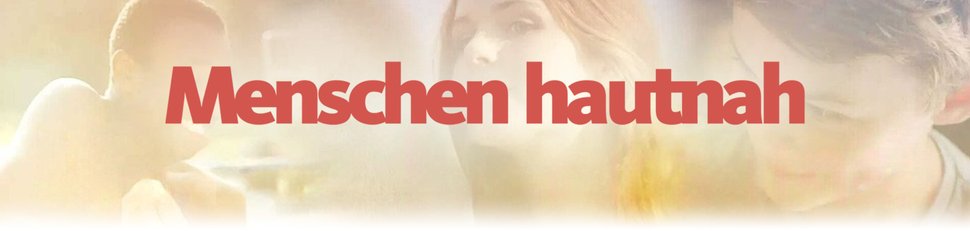2020, Folge 19–36
Wenn Pornos zur Sucht werden – Felix kämpft sich in ein neues Leben
Folge 19 (40 Min.)Es gibt diesen Moment, da kann Felix (31) nicht mehr stoppen. Dann geht er wieder auf Pornoseiten, verliert sich in den tausenden von Videos und findet erst Stunden später wieder raus. Elend fühlt er sich dann und leer. Nichts wünscht sich Felix mehr, als diese Sucht nach Pornos, wie er es nennt, endlich hinter sich zu lassen. Seit seiner Pubertät sind die Pornos ein Zufluchtsort für ihn. Wenn die Mitschüler sich über seine Unsportlichkeit lustig machen, Lehrer ihn als Träumer bezeichnen, dann rettet er sich in die unbegrenzte Welt der Sexvideos. Sein Zwillingsbruder Tim hat all diese Probleme nicht. Der lebt das Leben, das Felix gerne hätte.Ist erfolgreich in der Schule, hat Freundinnen, wirkt unbeschwert. „So ähnlich wir uns sahen, so unterschiedlich haben wir uns entwickelt“, sagt Felix. Nach der Schulzeit trainiert er sich starke Muskeln an, wird Sänger einer Punkrock Band, macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten. Von außen betrachtet ist Felix jetzt ein selbstbewusster Kerl. Was ihn aber quält, ist die Unfähigkeit, eine Beziehung zu führen. „Ich bekomme keine echte Nähe mit einer Frau hin“, sagt Felix. Sex funktioniert für ihn nur alleine – mit den Pornos. Irgendwann wird der Leidensdruck so groß, dass Felix seine Familie und Freunde einweiht und eine Therapie in einer Fachstelle für Mediensüchte beginnt. Sein Therapeut sagt, dass immer mehr junge Männer mit ähnlichen Problemen zu ihm kommen: Die sogenannten Digital Natives, aufgewachsen mit der freien Verfügbarkeit von Internet-Pornos. Und viele von ihnen mit Versagensängsten beim echten Sex. Wenn Felix im Sommer die verliebten Paare im Park sieht, wird er traurig und glaubt, dass er das nie erleben wird. Völlig unverhofft lernt er dann eine junge Frau kennen, erzählt ihr von seinen Problemen und glaubt zum ersten Mal an die große Chance, seine Sucht ein für alle Mal zu besiegen. „Menschen hautnah“ begleitet Felix bei seinem mutigen Kampf in ein neues Leben. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 18.06.2020 WDR Die Kämpferin und der Feind in ihr
Folge 20Yasemin S. (30) hat einen seltenen Gendefekt. In ihrem Körper wuchert Gewebe unkontrolliert – eine rätselhafte Laune der Natur. Immer wieder müssen Geschwüre und gutartige Tumore entfernt werden. Doch nun raubt ihr ein Tumor am Kehlkopf den Atem. Er wächst langsam, aber stetig. Die Ärzte sind ratlos, niemand möchte sie an dieser gefährlichen Stelle operieren. Ohne Behandlung jedoch droht sie zu ersticken. Wie schon oft in ihrem Leben muss Yasemin selbst eine Lösung finden. „Menschen hautnah“ begleitet die junge Frau ein Jahr lang bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit. Yasemin ist eine von knapp 200 Menschen weltweit, die mit dem Proteus-Syndrom leben.Der seltene Gendefekt ist unberechenbar. Seinen Namen verdankt er der griechischen Mythologie, weil die von der Krankheit hervorgerufenen Wucherungen bei jedem Betroffenen eine andere Gestalt annehmen – ebenso wie der Meeresgott Proteus seine Gestalt veränderte. Allen Erkrankten gemeinsam ist der asymmetrische Riesenwuchs einzelner Gliedmaßen. In Yasemins Fall sind es die mittleren Finger beider Hände, die um das Dreifache der üblichen Größe anwuchsen. „Monsterfinger, Dickfinger“ wurde sie früher deswegen genannt. Mehr als 60 Operationen hatte sie bis zu ihrem 18. Geburtstag hinter sich. Danach hörte sie auf zu zählen. Schon als kleines Mädchen wurde Yasemin zur Kämpferin. Sie wurde schon früh aus der Familie genommen, wuchs in Kinderheimen auf. Niemand wollte das Kind mit den fehlgebildeten Fingern adoptieren. Yasemin musste lernen, mit ihrer Krankheit zu leben, ohne daran zu verzweifeln. Sie lernte, mit ratlosen, überforderten Ärzten umzugehen, die noch nie vom Proteus-Syndrom gehört hatten. Sie erkämpfte sich eine Ausbildung, machte sich schließlich als Piercerin selbständig und schafft sich einen Namen in der Tattoo- und Piercingszene. Auf Facebook hat sie mehr als 3.000 Fans und Follower, die ihre Höhen und Tiefen begleiten. Seit kurzem schnürt ihr ein gutartiger Tumor am Kehlkopf immer wieder die Luft ab. Kein Arzt will an dieser gefährlichen Stelle operieren. Ein spezielle Behandlung könnte helfen, bei der eine giftige Substanz in die Wucherung gespritzt wird. Oder ein Medikament, das eigentlich für Nierentransplantierte eingesetzt wird – wie so vieles bei dieser Krankheit medizinisches Neuland. Niemand kann vorhersagen, ob diese Behandlung erfolgreich sein wird. Wieder einmal muss Yasemin eine Lösung finden. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.06.2020 WDR 24 Senioren, zwei Studenten und das Virus – Eine WG im Ausnahmezustand
Folge 21Lässt sich Alterseinsamkeit durch neue Wohnformen vermeiden? Ist die Mischung von Alt und Jung eine Lösung? Anfang Februar 2019 begeistert die Diakonie Michaelshoven 24 Senioren und zwei Studenten für ein gemeinsames Projekt in einem Kölner Haus: Die Studenten bekommen dort eine günstige Bleibe, dafür stehen sie den alten Menschen zur Seite und überlegen sich kleine Unterhaltungsprogramme. Projektleiterin Heike Marth hat die Bewohner unter vielen Bewerbern persönlich ausgesucht: Kunststudent Jorrit König (24), der die Idee, mit alten Menschen gemeinsam zu leben, spannender findet als jede Studenten-WG.Und BWL-Student Philipp Schaper (26), der auf einem Dorf aufgewachsen ist, in dem auch seine Großeltern leben. Den Austausch unter den Generationen sieht er als Bereicherung – das Projekt in der Stadt spricht ihn sofort an. Offen sollen alle hier sein, unternehmungslustig. Wie Elisabeth Lai, die weitgereiste 86-jährige Kölnerin, die gerne Karneval feiert. Oder die kunstinteressierte Wilma Keulertz (89), die früher in Düsseldorf wohnte und nun in der Nähe ihres Sohnes in Köln sein will. Gerade haben sich alle in die neue Wohnsituation eingelebt. Die Studenten haben gelernt, bei zu großen Ansprüchen an sie Grenzen zu setzen, die Senioren die ersten Krisen nach dem Umzug überwunden. Dann wird mit Corona auch der WG-Alltag ein anderer. Die WG ist ein offenes Haus – kein Altersheim mit den entsprechenden Besuchsverboten. Heike Marth tut alles, um das Virus draußen zu halten. Einige Senioren ignorieren die Abstandsgebote und ecken damit an. Andere ziehen sich ängstlich zurück. Elisabeth Lai leidet enorm unter den Kontaktbeschränkungen. Und die beiden Studenten sind verunsichert – sie müssen ihre Sozialkontakte einschränken, um die betagten Mitbewohner nicht zu gefährden. Sie könnten ausziehen, zu Eltern oder Freuden – doch sie bleiben und kümmern sich weiterhin um ihre Wohngemeinschaft. Das Virus wird nun zur Bewährungsprobe für ein ungewöhnliches Projekt. Wird die WG besser zusammenfinden – oder wird das gemeinschaftliche Leben an seine Grenzen stoßen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 02.07.2020 WDR Das erste Mal (1): verliebt
Folge 22Die erste große Liebe, es ist eine besondere, an die sich jeder ein Leben lang erinnert. Carima war 14 und Paul 17, als sich die beiden bei einem Familienfest in Bremen kennenlernen. Carima ist sofort fasziniert von Paul, sie verbringen den ganzen Nachmittag zusammen. Doch zwischen ihren Wohnorten liegen 300 km. „Da ich nicht davon ausgegangen bin, ihn jemals wieder zu sehen, gab ich dem netten und attraktiven Kerl einen Kuss zum Abschied“, erzählt Carima. Über Instagram bleiben sie in Kontakt und drei Monate später setzt sich Carima in den Zug und besucht Paul in Köln.Für das erste Date hat die 14-Jährige einen besonderen Wunsch: Sie will ins Museum. „Ich bin tatsächlich diejenige, die voll auf Museen abfährt“, erklärt sie und Paul ergänzt: „Ich muss sagen, ich war vorher nicht viel in Sachen Kunst unterwegs, aber da hat sie mir dann doch eine coole Welt gezeigt.“ Für Carima und Paul ist es die erste große Liebe. Keiner von ihnen hatte vorher eine Beziehung. Ihre besondere Herausforderung ist die Entfernung. Seit eineinhalb Jahren pendeln sie inzwischen hin und her. Nächstes Jahr macht Carima Abitur und dann soll einer gemeinsamen Zukunft in einer Stadt nichts mehr im Weg stehen. Bis dahin pflegen sie ihre Rituale, wie beispielsweise das gemeinsame Zähneputzen per Facetime jeden Abend um 22:30 Uhr. „Da wir im Alltag nicht so viel Zeit miteinander haben, ist es schön, sich am Abend zu treffen und das auch regelmäßig zu tun. Weil da weiß man, dass der andere Zeit hat, weil Zähne putzen muss man ja.“ Johanna und Batu aus Regensburg haben sich vor 14 Monaten ineinander verliebt. Sie haben sich in der Schule kennengelernt, als sie zusammen in die zwölfte Klasse kamen. Vier Monate später lud Batu Johanna zum Essen ein. „Davor war sie einfach nur eine Klassenkameradin“, erzählt Batu, „und dann dachte ich mir, die ist so nett, also frag ich mal.“ Auf der Walhalla, einem Nationaldenkmal in Donaustauf, küssten sich beide das erste Mal. Für Johanna hatte dieser erste Kuss eine große Bedeutung, „aber ich wusste nicht, was Batu fühlt oder denkt, und ich fand es peinlich, gleich nach dem ersten Kuss darüber zu reden, ob das nun eine Beziehung wird oder nicht. Aber dann, beim nächsten Date war es klar.“ Batu schätzt an Johanna vor allem ihre Ehrlichkeit. „Wenn ihr etwas nicht passt, dann sagt sie es gleich.“ Und Johanna liebt an ihrem Freund, „dass der Batu alles für mich tut“. Johanna ist heute 18 und Batu 20 Jahre alt. Sie sehen sich fast täglich. Batu studiert Maschinenbau und Johanna macht ein freiwilliges soziales Jahr beim Rettungsdienst. Batu hat türkische Wurzeln, sein Temperament schiebt er gerne auf seine südländische Herkunft. Denn er kann auch mal schnell genervt sein und „dann gehe ich hoch, kann schon mal laut werden, aber Johanna holt mich dann runter“, räumt er ein. Manchmal nicht ganz einfach für Johanna, trotzdem sind sich beide sicher: Unsere Liebe hält für immer. „Ich glaub schon, dass das Zukunft hat“, beteuert Johanna und sagt: „So mit 28, wenn alles fertig ist, kann man ja mal übers Heiraten nachdenken und Kinder kriegen.“ Wie fühlt sie sich an, die erste große Liebe? Was macht sie so besonders? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 06.08.2020 WDR Das erste Mal (2): eine eigene Wohnung
Folge 23Von zu Hause ausziehen, zum ersten Mal den Schritt in die Eigenständigkeit wagen, das ist ein Abenteuer. Und ein wichtiger Schritt in Richtung Erwachsenenleben. Ab jetzt muss alles selbst gemacht werden: Einkaufen, kochen, putzen, waschen und Probleme lösen. Wir begleiten eine Studentin und ein Pärchen auf dem Weg aus dem Familiennest in ihre erste eigene Wohnung. Michelle ist 24, studiert Theaterwissenschaft und wohnt noch bei ihren Eltern in Bochum – vor allem aus finanziellen Gründen. Doch jetzt ist es an der Zeit, das Elternhaus zu verlassen, sie will ins Ausland.Michelle hat sich für ein Erasmus-Semester in Amsterdam beworben. Als sie Anfang Februar in das Studentenwohnheim am Rande der Stadt zieht, freut sie sich auf ein ereignisreiches halbes Jahr im Ausland. „Ich will viel ins Theater gehen, Museen, Kultur und bin schon gespannt auf meine Kommilitonen. Das Semester geht nur bis Ende Mai, aber ich möchte noch zwei Monate dranhängen und den Sommer in Amsterdam erleben. Festivals, Partys, neue Freunde – ich freue mich schon sehr“ Michelles Habseligkeiten passen in einen PKW – viel braucht sie nicht in Amsterdam und dort ist auch gar nicht so viel Platz: Zwölf Quadratmeter in einem Container am Stadtrand – das ist ihr neues Zuhause. Ein paar Wochen genießt sie ihr neues Studentenleben in Amsterdam und fängt gerade an, sich an den Campus, die fremde Sprache und den anderen Unterrichtsstil zu gewöhnen, dann kommt Corona und der Lockdown. Das heißt: ab sofort Online-Unterricht – Kontakt zu anderen Menschen nur per Videoschalte am Computer – ihre Welt besteht auf einmal nur noch aus den 12 Quadratmetern ihres Container-Zimmers. „Ich habe drei Wochen lang mein Zimmer nicht verlassen, weil ich den Aufruf zum Social Distancing ernst genommen habe.“ Der Traum von einer aufregenden Zeit in der fremden Stadt, von spannenden Begegnungen und lebendiger Kultur – zerplatzt. Doch Michelle bleibt. „Wenn ich die Wahl habe, in Bochum oder Amsterdam den Lockdown zu erleben, dann lieber hier. Wenn es demnächst wieder Lockerungen gibt, bin ich dann zumindest in Amsterdam.“ Melanie (18) und Jonas (19) haben sich bei der Grünen Jugend kennengelernt. Seit Ende November sind sie zusammen und seitdem unzertrennlich. Anfangs pendeln sie zwischen ihrem und seinem Elternhaus, doch Jonas möchte ausziehen und für Melanie ist sofort klar: da macht sie mit. Schon bald finden Melanie und Jonas eine bezahlbare Wohnung in Schweinfurt, am 1. April ist der Umzug – mitten im Lockdown. Ein Problem? Melanie: „Hat am Ende alles gut geklappt – mein Vater hat den Wagen gefahren, die Baumärkte hatten ja zum Glück noch auf, so konnten wir Farbe für die Wände kaufen“. Eigentlich wollten die beiden jeden Morgen gemeinsam nach Würzburg fahren, Melanie zum Studieren, Jonas zum Arbeiten. Doch Corona bedingt studiert Melanie jetzt von zu Hause aus und wartet den ganzen Tag sehnsüchtig darauf, dass Jonas von der Arbeit nach Hause kommt. Putzen, Einkaufen, Kochen – das bleibt erst mal an Melanie hängen. Das ist nicht die einzige Herausforderung für das junge Liebespaar. Sie kriegen bis auf Melanies Kindergeld keine finanzielle Unterstützung von ihren Eltern – reicht das Monatsbudget, wenn man viel Wert auf leckeres Essen legt? Und was macht man, wenn keiner Lust hat, das Geschirr zu spülen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.08.2020 WDR Das erste Mal (3): ein Job
Folge 24Lena aus Konstanz ist 23 Jahre alt und wusste schon mit 15, dass sie Bestatterin werden will. Viele ihrer Freunde fanden das komisch und so hat sie sich ein bisschen Zeit gelassen, ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. Sie machte eine Weltreise und jobbte als Verkäuferin. Und hat dann gemerkt, dass er immer noch da ist, der Traum, Bestatterin zu werden. In Bochum hat sie einen Ausbildungsplatz bekommen – weit weg von Eltern und Freunden am Bodensee. Am 3. August geht es los. Jetzt heißt es Abschied nehmen von Zuhause, eine Wohnung im Ruhrgebiet finden. Und: Wird ihr erster richtiger Job so sein, wie sie sich das vorgestellt hat?Drei Jahre Studium, das hat Thomas erstmal gereicht. Er sucht nach dem Bachelorabschluss in Architektur einen Job – am besten da, wo viele Menschen wohnen und bauen. Thomas bewirbt sich in Hamburg und bekommt die Stelle. Seine Freundin Franzi bewirbt sich ebenfalls als Architektin in Hamburg und hat auch sofort Glück. Beide ziehen von Braunschweig an die Elbe und beginnen ihre ersten Arbeitstage mitten in der Corona-Zeit Anfang April. Homeoffice, keine Möglichkeit der Einarbeitung, kein Kennenlernen der Kollegen – alles ist anders. Dazu kommt Thomas’ Sorge, ob er den Ansprüchen genügt, die an ihn gestellt werden, und die Angst, Fehler zu machen. Auch Janina steht vor einer neuen Herausforderung. Sie ist 37, hat zwei Kinder und schon mehr als einen Job hinter sich: eine Ausbildung zur Automobilkauffrau und die Selbstständigkeit als Heilpraktikerin. Doch eigentlich hatte sie immer den Traum, Soziale Arbeit zu studieren. Vor drei Jahren schreibt sie sich an der Uni ein und absolviert innerhalb kürzester Zeit das Studium. Mit ihrem hervorragenden Abschluss bekommt sie eine Stelle beim evangelischen Kirchenkreis in Unna. Dann kommt Corona und ihre Sorge, dass sie vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird, dass ihr Arbeitsverhältnis gekündigt wird, bevor es anfängt. Dabei soll dieser Job als Sozialarbeiterin doch für sie der erste richtige Job sein. Ein Job, den sie sich immer erträumt hat. Lena, Thomas, Franzi und Janina – für alle beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Mit Spannung erwarten sie den ersten richtigen Job in ihrem Leben. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 20.08.2020 WDR Wenn Herr Pfarrer zur Pfarrerin wird – Elke kämpft um ihre Gemeinde
Folge 25 (45 Min.)Elke Spörkel hat sieben Kinder, war zweimal verheiratet und predigte 26 Jahre lang als Pfarrer Hans-Gerd in der kleinen Gemeinde Haldern am Niederrhein. „Solange ich mich erinnern kann, war immer die Faszination, warum darf ich kein Mädchen sein?“, erinnert sich Elke. Jahrzehntelang war sie als evangelischer Pfarrer Hans-Gerd in der Gemeinde äußerst beliebt – bis bekannt wird, dass der Pfarrer Frauenkleider trägt. Die Ehe zerbricht. Es folgt eine tiefe Krise, die Gemeinde wendet sich ab. „Man fühlt sich plötzlich als Unmensch, als einer, der was verbrochen hat. Also in der Tat wie jemand, der ein Verbrechen begangen hat“. Nach solchen Erfahrungen macht Elke Spörkel ihre Transidentität öffentlich. Die Gemeinde nimmt Elke auch als Pfarrerin an und versucht, zum Alltag zurückzufinden. Alles scheint gut, bis sich Elke verliebt und noch einmal heiraten möchte. Autor Manuel Rees hat die charismatische Pfarrerin über drei Jahre begleitet und erzählt Elkes bewegende Lebensgeschichte. (Text: WDR)Deutsche TV-Premiere Do. 10.09.2020 WDR Wie sag ich’s meinem Patienten? – Wenn Ärzte schlechte Nachrichten überbringen
Folge 26„Jetzt ist alles vorbei, jetzt kannst du eigentlich das Buch zuschlagen“, so erlebte Margit Schöppler den Moment, als der Arzt ihr mitteilte, dass sie Krebs hat. Was den Moment besonders schlimm machte, war aber nicht nur die Diagnose, sondern die Art und Weise, wie der Arzt mit ihr umging. Mit ihren Sorgen und Ängsten blieb sie allein. Doch sie fand schließlich Ärzte an einer anderen Klinik, bei denen sie sich medizinisch wie menschlich gut betreut fühlt. Prof. Dr. Jana Jünger war als junge Ärztin hilflos, wenn sie mit todkranken Patienten reden musste. Ihr fehlte das Handwerkszeug, um in so einem einschneidenden Moment die richtigen Worte zu finden. Dass Ärzte nicht gelernt haben, wie sie mit Patienten reden, ist kein Einzelfall, sondern in Deutschland die Regel.Ein Missstand, den Jana Jünger ändern will. Sie wurde Kommunikationstrainerin für Mediziner. Einer, der von ihrem Engagement profitiert, ist der Medizinstudent Alexander Bernhardt. Er lernt auf einer besonderen Ausbildungsstation an der Uniklinik Heidelberg, wie man schlechte Nachrichten überbringt – und ihnen den Schrecken nimmt. Filmemacherin Ilka aus der Mark hat über ein Jahr im Gesundheitssystem recherchiert, mit Ärzten und Patienten gesprochen. Sie dokumentiert, wie eine falsch überbrachte schlechte Nachricht Patienten aus der Bahn werfen kann. Sie zeigt aber auch, welche Wege einige Ärzte bereits gehen, um die Situation zu verbessern. Zum Wohle der Patienten und Ärzte. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 17.09.2020 WDR Liebe inklusive (4)
Folge 27 (45 Min.)Was ist aus Jill und Felix geworden, den Verliebten mit Down-Syndrom, die auf rosaroten Wolken schwebten? Sind Andreas, der unter Depressionen leidet, und Tanja, die im Rollstuhl sitzt, ein Paar geworden? Wie stehen Jans Heiratschancen bei Model Tamara? Nach dem Erfolg der dreiteiligen Serie „Liebe inklusive“ und vielen Nachfragen der Zuschauerinnen und Zuschauer zeigt „Menschen hautnah“, was aus den Dates unserer Protagonisten geworden ist. Da ist die 23-jährige Jill, die in einer Großküche arbeitet und nicht mehr einsam sein wollte. Jill hat das Down Syndrom und fand es schwierig, einen Partner zu finden.Als sie Felix – ebenfalls mit Down-Syndrom – über eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderungen kennenlernt, scheint sich zunächst ihr Traum von einer Beziehung zu erfüllen. Doch können Jill und Felix im Alltag als Paar bestehen? Andreas (35) leidet unter Depressionen und hat oft Schwierigkeiten, anderen seine Krankheit zu erklären. Jahrelang lebte er ohne Kontakte – völlig isoliert. Als wir ihm im Oktober 2019 zum ersten Mal begegnen, hat er ein Date mit Tanja, die nach einem schweren Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzt. Völlig unbekannt und aus verschiedenen Welten kommend, öffnen sich Tanja und Andreas für das erste Gespräch, das viele Zuschauerinnen und Zuschauer berührte. Eine Freundschaft entstand. Ist daraus Liebe geworden? Die Serie „Liebe inklusive“ stellt Menschen in den Mittelpunkt, die mit einem Handicap auf Partnersuche sind. Dabei begleitet die Doku-Reihe die Liebessuchenden auch zu ihren Dates. Worauf freuen sie sich? Welche Erwartungen haben sie? Fragen an Menschen, die in ihrer Sehnsucht, ihren Träumen und Hoffnungen nicht anders sind als alle anderen auch. Die vierte Folge unserer Serie zeigt, dass manchmal auch ein Umweg zum Glück führen kann. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 24.09.2020 WDR Weiblich, obdachlos, unsichtbar – Frauen zwischen Straße und Notunterkunft
Folge 28 (45 Min.)Bis vor fünf Jahren führte Maike (Name von der Red. geändert) noch ein bürgerliches Leben, auch wenn sie es nie ganz einfach hatte. Die 49-Jährige arbeitete Vollzeit als Altenpflegerin für Demenzkranke und zog alleine zwei Kinder groß. Dann verlor sie ihren Job und wenige Monate später ihre Wohnung. Das Jobcenter hatte ihren Antrag auf Arbeitslosengeld 2 zu spät bearbeitet. Maike konnte deshalb ihre Miete nicht mehr zahlen. Zunächst schlief sie im Hinterzimmer eines Ladens, bei dem sie unentgeltlich aushalf und duschte sich im Hallenbad.Als das nicht mehr ging, musste sie in Notunterkünften übernachten, oder sie lief die ganze Nacht durch die Stadt. Frauen machen etwa ein Viertel aller Wohnungslosen in Deutschland aus. Und es trifft auch immer mehr Menschen aus der Mittelschicht. Die Gründe sind vielfältig: Steigende Mietpreise, Trennung, Jobverlust und Krankheit gehören dazu. Im Straßenbild sind obdachlose Frauen meistens kaum sichtbar. Sie versuchen nicht aufzufallen, sind gewalttätigen Übergriffen aber oft schutzlos ausgesetzt – auf der Straße, in Notübernachtungen und Wohnheimen. Maike hat das erlebt: „Eines Nachts bin ich aufgewacht, weil eine Frau mir mit ihren Fäusten ins Gesicht schlug. In so einer Notunterkunft ist man mit vielen Frauen konfrontiert, die man im normalen Alltag meiden würde. Sie haben psychische Probleme, manche sind depressiv oder gewalttätig.“ Dagmar würde man nie ansehen, dass sie wohnungslos ist. Die 59-Jährige wohnt mit ihrem erwachsenen Sohn in zwei kleinen Holzhütten auf der Straße. Trotz Wohnungslosigkeit hat es die ehemalige Einzelhandelskauffrau geschafft, sich einen kleinen Putzjob zu besorgen. Ihr Verdienst liegt allerdings unter dem Sozialhilfesatz, so dass ihr eine Aufstockung zustehen würde. Da das Jobcenter dieser Zahlung nicht nachkommt, muss Dagmar mit etwa 100 Euro im Monat über die Runden kommen. Mittlerweile hat sie sich daran gewöhnt, hungrig ins Bett zu gehen. Woran sie sich aber nie gewöhnen wird, sind die täglichen üblen Beschimpfungen, sexuellen Anzüglichkeiten und Schikanen, denen sie als wohnungslose Frau in ihrem Bretterverschlag oft schutzlos ausgeliefert ist. „Ich fühle mich wie lebendig begraben. Oft höre ich Nachts, wenn ich auf meiner Matratze versuche zu schlafen, wie Männer an die Wand meiner Hütte pinkeln“, erzählt Dagmar. Und auch wenn man endlich der Straße entkommen ist – wie die 26-Jährige Steffi – heißt das noch lange nicht, dass man wieder ein normales Leben führen kann. Noch immer leidet sie unter Erfahrungen, die sie gemacht hat, als sie Monate lang unter einer Brücke schlief. Bisher gibt es seitens Politik und Gesellschaft wenig Hilfsangebote für obdachlose Frauen wie Steffi, Dagmar und Maike. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 01.10.2020 WDR Oliver, 44 Jahre, Analphabet
Folge 29 (45 Min.)Mitternacht in Essen: Oliver M. ruft seine Schwester an. Er arbeitet bei einem Sicherheitsdienst und eine Fehlermeldung ist auf einem Monitor aufgetaucht. Buchstabe für Buchstabe diktiert er seiner Schwester die Wörter ins Telefon, denn Oliver kann den Text nicht lesen. Seine Arbeitskollegen um Hilfe bitten kann er nicht – sie wissen nichts von seinem Handicap. Wenn jemand davon erfährt, verliert er seinen Job. Dabei hat er sogar seinen LKW-Führerschein geschafft, weil er gelernt hat, sich vieles vom Zuhören zu merken. „Ich bin ja nicht dumm,“ sagt der 44-Jährige.„Ich kann nur nicht lesen!“ Wie ihm geht es 6,2 Millionen Erwachsenen in Deutschland, mehr als die Hälfte von ihnen sind deutsche Muttersprachler. Vielen gelingt es zwar wie Oliver M., einzelne Wörter oder kurze, einfache Sätze zu entziffern. Zusammenhängende Texte sind für sie trotzdem eine große Hürde – obwohl drei Viertel der Betroffenen sogar einen Schulabschluss haben und fast zwei Drittel von ihnen auch berufstätig sind. Ihre Umgebung erfährt oft nichts von der Leseschwäche: Die meisten haben Techniken und Tricks entwickelt, damit niemandem auffällt, dass sie die Speisekarten, Kinoprogramme, Gebrauchsanweisungen, Hinweise oder Behördenbriefe nicht lesen können. Auch Oliver hat gelernt, seine Schwäche im Alltag zu verstecken, bestellt im Restaurant dasselbe wie sein Gegenüber oder tippt auf irgend eine Zeile in der Speisekarte. Er erfand Ausreden wie „Ich habe meine Brille vergessen“ oder diktierte Texte in sein Smartphone. Auf der Arbeit flog er damals auf und verlor seinen Job. Zu Hause hilft ihm sein ältester Sohn und wenn Oliver Behördenbriefe und ähnliche Schreiben bekommt, bittet er seine Schwester um Unterstützung. Seit fünf Jahren belegt Oliver Alphabetisierungskurse an der Volkshochschule. Sein großes Ziel: Er will, dass seine eigenen vier Kinder die Schule abschließen – und hadert mit sich, weil er ihnen dabei so wenig helfen kann. Er macht sich Sorgen, weil sie schlechte Noten nach Hause bringen und will unbedingt, dass sie sich mehr anstrengen, um einen besseren Start ins Leben zu haben als er selbst. Eines aber, sagt er, ist schon geschafft: Lesen – das können seine Kinder. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 08.10.2020 WDR Zum Glück zu zehnt – Leben in der Großfamilie
Folge 30 (45 Min.)Monika und Paul haben eine echt Großfamilie gegründet: acht Kinder, darunter zwei Mal Zwillinge. Das Paar empfindet das als großes Glück und vermisst nichts, sagen sie. Auch wenn Paul einräumt, dass nicht allzu viele Freiräume für die Eltern bleiben. Monika war früher Model, hatte angefangen zu studieren, dann abgebrochen und Kinder bekommen. Paul wollte Schauspieler werden und hat diesen Traum aufgegeben als die erste Tochter kam. Er wurde Inspizient, ist im Düsseldorfer Schauspielhaus der „Dirigent hinter der Bühne“. Geld und materielle Dingen sind dem Paar nicht so wichtig; was zählt ist das gemeinsame Leben, zusammen mit ihren Kindern Luise, Emil, Anton, Lotte, Serafin, Nepomuk, Alvar und Linnea.Musik und Sport spielen im Leben der Kinder eine große Rolle. Bei Bundeswettbewerben zu „Jugend musiziert“ schneiden einige der Geschwister immer gut ab. Im Jahr 2010 hat Autorin Susanne Brand Familie Adler kennengelernt und filmisch porträtiert. Wie geht es ihnen heute, neun Jahre später, wo ein Kind nach dem anderen das Haus verlässt? Wie gestalten Monika und Paul nun ihre neuen Freiräume? Haben sie jetzt doch das Gefühl, etwas verpasst zu haben? In der Doku „Zum Glück zu zehnt – Leben in der Großfamilie“ erleben die Zuschauer*innen Familie Adler noch einmal – heute und in Rückblicken. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 15.10.2020 WDR Ich weiß nicht mal, wie er starb – Wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde
Folge 31 (45 Min.)Als das Virus erkannt wurde, war es zu spät: Innerhalb weniger Tage infizierten sich 112 der 160 Bewohner*innen des Wolfsburger Hanns-Lilje-Heims mit Corona, 48 von ihnen starben. Auch viele Pflegekräfte erkrankten an Covid-19. Die diakonische Einrichtung für dementiell erkrankte Menschen war zur Todesfalle geworden. In der Öffentlichkeit entstand bald das Bild vom „Horrorheim“. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, anonyme Vorwürfe fanden weite Verbreitung. In einer aufwendigen Recherche rekonstruieren Arnd Henze und Sonja Kättner-Neumann die tragischen Wochen vor Ostern im Hanns-Lilje-Heim.Über mehrere Wochen konnten sie Pflegekräfte im Schichtdienst in den für Besucher*innen immer noch gesperrten Wohnbereichen begleiten. Sie sprachen mit Angehörigen von Verstorbenen und von Überlebenden, mit Ärzten, Verantwortlichen der Diakonie, dem Wolfsburger Oberbürgermeister als Leiter des Krisenstabes und mit Medizinethikern. Dramatische Entscheidungen, Überforderung und Kampf ums Leben Viele der Beteiligten sind noch immer traumatisiert – von dramatischen Entscheidungen im Blindflug, der permanenten Überforderung und dem oft vergeblichen Kampf um das Leben der Erkrankten, von den Kontaktverboten und nicht zuletzt von den rigiden Isolationsmaßnahmen zum Schutz der Bewohner*innen. Denn niemand konnte den Menschen im Heim begreiflich machen, warum sie plötzlich von Pflegekräften in Raumanzügen in ihre Zimmer eingesperrt wurden. „Ich habe mich wie eine Gefängniswärterin gefühlt“, erzählt eine Pflegerin. Noch immer sucht das Heim einen Weg zurück in einen Alltag unter Corona-Bedingungen. Das Betretungsverbot gilt weiter, Besuche sind nur unter strengen Hygieneauflagen auf dem Außengelände erlaubt – Einschränkungen, die den Kontakt mit den dementiell Erkrankten für die Angehörigen kaum erträglich machen. Umso größer ist die Sorge vor dem Winter und einer zweiten Welle. „Ein Krieg ist irgendwann vorbei – Corona hört nicht auf“, sagt eine Pflegerin aus Kroatien, die als Kind einst vor dem Krieg in ihrer Heimat nach Niedersachsen geflüchtet war. Exklusiver Einblick in widersprüchliche Erfahrungen Die Dokumentation vermittelt einen exklusiven Einblick in die oft widersprüchlichen Erfahrungen der Betroffenen dieser Katastrophe. So entsteht ein Bild, in dem Dankbarkeit für das Engagement der Pflegekräfte und hilflose Wut über das einsame Sterben von Verwandten nebeneinander stehen. Fehler und Versäumnisse werden benannt, ohne zu verurteilen. Denn wichtiger als die Suche nach Schuldigen ist die Frage: Welche Lehren lassen sich aus den Erfahrungen von Wolfsburg ziehen, damit Pflegeheime nicht immer wieder zur Todesfalle werden? Und vielleicht noch dringlicher: was muss getan werden, damit der Schutz vor dem Virus nicht zum sozialen Tod in Einsamkeit führt? „Ich weiß nicht mal, wie er starb – Wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde“ ist eine Koproduktion von WDR (Federführung, Redaktion: Christiane Mausbach) und NDR (Redaktion: Gabi Bauer) für Das Erste. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.10.2020 WDR Marias Neuanfang – Weiterleben nach dem Tod des Partners
Folge 32 (45 Min.)„Sein Tod ist gar nicht mehr das Schlimmste, obwohl ich meinen Mann unendlich vermisse“, sagt die 36-jährige Maria heute. „Viel schlimmer sind die Wunden, die der Krebs in unserer Familie hinterlassen hat“. Die jahrelange Krankheit ihres Mannes Andrea Bizzotto hat sie und ihre beiden Kinder Fynn (14) und Giulia (3) verändert. Im ersten halben Jahr nach seinem Tod am 1. März 2019 überrollt Maria die Bürokratie: Beerdigung, Urkunden, Anträge … dann stürzt sie sich in Arbeit, um ein Buch, das ihr italienischer Mann noch kurz vor seinem Tod geschrieben hat, auf Deutsch herauszubringen und Lesungen damit zu machen. Und jetzt? Ihr wird klar, die kleine Wohnung steckt voller Erinnerungen an schmerzliche Situationen mit ihrem sterbenskranken Mann.Auch die alte Arbeitsstelle passt nicht mehr zu ihr. Sie braucht eine neue Umgebung – und einen neuen Job. Maria muss den Schritt in ein neues Leben wagen und gleichzeitig ihren Kindern Giulia (3) und Fynn (14) genug Stabilität geben, damit sie wieder Vertrauen ins Leben gewinnen. Wie geht das zusammen? Nach der Reportage „Das will ich Dir noch sagen“ (WDR 2019) über Maria und ihren Mann Andrea Bizzotto, der in seinen letzten Lebensmonaten noch einen italienischen Bestseller schrieb, haben wir Maria und ihre Kinder ein weiteres Jahr mit der Kamera begleitet. Die Alleinerziehende ist neue Wege gegangen – ohne ihren Mann. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 05.11.2020 WDR Unsere Heimat auf Rädern – Diana und Phillip auf der Reise zu sich selbst
Folge 33 (45 Min.)Diana: „Wir haben die Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wer wir sind, was wir wollen.“ Noch vor fünf Jahren führten Diana Knigge und Phillip Alexander Schubert, beide Mitte 40, ein Leben im sogenannten Wohlstand: eigenes Café, schickes Auto und große Wohnung. Eines Tages bekommen sie, unerwartet, ein Kaufangebot für ihr Café. Der erste Gedanke der beiden: „Wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Einfach aus dem Hamsterrad? Wie soll denn das gehen?“ Die Entscheidung des Paares fällt erstaunlich schnell.Der Preis sich täglich erschöpft zu fühlen, nur um die Rechnungen zu bezahlen, ist ihnen zu hoch. Sie steigen aus. Das Umfeld reagiert zunächst irritiert. Die beiden entscheiden sich für einen Weg, den sie selbst noch nicht kennen: Diana und Phillip wählen ein Leben in Bewegung. Sie kaufen ein Wohnmobil und leben mittlerweile seit fünf Jahren auf 12 qm, ihrer „Heimat auf Rädern“, wie sie es nennen. Sie suchen ein Leben, das zu ihnen passt, und keines, in das sie passen müssen. Im Sommer verdienen sie in Deutschland ihren Lebensunterhalt für den Winter. Im Winter rollen die Räder Richtung Süden. So romantisch, wie das „Vanlife“ in den Medien oft dargestellt wird, ist es jedoch nicht. Oft bahnen sich Diana und Phillip auf Strandspaziergängen den Weg durch jede Menge Müll. Erst sind sie entsetzt, doch dann entdecken sie eine Möglichkeit darin. Sie kriechen über Strände, sammeln Plastikmüll und gestalten daraus kleine Kunstwerke, die sie tauschen oder verkaufen. Reich macht es sie nicht, aber glücklich. Phillip: „ Der Planet braucht viel Aufmerksamkeit, sonst sieht es irgendwann düster aus. Wir lieben das Meer und haben uns entschieden, hier etwas zu tun.“ Vor Herausforderungen sind die beiden auch in der Ferne nicht geschützt. Nicht alles fühlt sich „frei“ an. Die Gedanken reisen fast täglich nach Deutschland. Der Vater von Diana entwickelt eine Demenz und auch die Mutter braucht Unterstützung. Diana entlastet Schwester Nina, die neben den Eltern wohnt, telefonisch und jeden Sommer kehrt das Paar in die frühere Heimat Ratingen zurück, um für alle da zu sein. Sie sind dankbar, dass ihre Familien ihr Leben im Minimalismus voll respektieren. Auf ihrem Wohnmobil steht „Das große Glück mag kleine Dinge“. Phillip: „Wir haben erkannt, es ist nicht der BMW und nicht 125 Quadratmeter. Das Glück und die Freude ist hier: Sonnenaufgänge, Natur, Kuchen backen, ein Pferd sehen. Es sind solche Dinge, die kosten nichts. Die stehen an keinem Plakat. Natürlich können wir uns keinen Mercedes kaufen. Aber wir können klar damit kommen, dass wir keinen haben und glücklich sein.“ (Text: WDR) Deutsche Streaming-Premiere Mo. 16.11.2020 ARD Mediathek Deutsche TV-Premiere Do. 19.11.2020 WDR Tod ohne Abschied
Folge 34 (45 Min.)„Als Jörg erfährt, dass seine Frau Carola an Krebs erkrankt ist, ahnt er nicht, dass ihnen nur noch ein paar Wochen bleiben. „“Sie war voller Zuversicht. Die Chemo war erfolgreich, sie fühlte sich gut, wir wollten sogar verreisen.““ Carola ist erst 39 Jahre alt, Mutter der vierjährigen Clara. Sie hat doch das ganze Leben noch vor sich. Als Jörg einmal versucht, mit seiner Frau darüber zu sprechen, was denn wäre, wenn das Ganze nicht gut ausgeht, habe sie ganz bestürzt reagiert: „“Du tust ja gerade so, als wäre ich gleich tot!““ Der Gedanke ans Sterben wird verdrängt.Doch dann ganz plötzlich sagen die Ärzte, Carola müsse ins Koma gelegt werden. Daraus wacht sie nie mehr auf. Abschied nehmen können Jörg und Clara nicht. Jörg quälen Schuldgefühle. Was hätte er seiner Frau nicht noch alles sagen wollen! Eine Trauergruppe hilft ihnen bei der Verarbeitung. Gemeinsam bemalen sie einen Sarg mit Botschaften an Carola. Eine Hilfe und ein Trost, wenn ein Abschied nicht möglich war. „“Wenn ein Mensch stirbt, ohne dass die Angehörigen dabei sein können, zum Beispiel auch bei einem Unfall, können bei den Hinterbliebenen jahrelange Spätfolgen entstehen““, sagt Seelsorger Friedrich Brand. Hinzu kommen Horrorvorstellungen: Ist mein Angehöriger einsam, qualvoll, voller Angst gestorben? Beim Lockdown wegen der Corona-Pandemie herrscht in Kliniken zeitweise ein totales Kontaktverbot. Patienten sind isoliert. So wie bei Familie Hucks in Duisburg. Wochenlang darf niemand aus der Familie Annemarie (83) besuchen. Nach sechs Wochen erhalten sie plötzlich die Todesnachricht aus der Klinik. Auch sie plagen Schuldgefühle: Haben sie ihre Ehefrau und Mutter im Stich gelassen? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 26.11.2020 WDR Vollenden – Bestatten und mehr
Folge 35 (30 Min.)Der Film beginnt da, wo unser Körper unwiderruflich fremden Händen ausgeliefert ist. Händen wie jenen von Tini und Markus. Ihre Arbeit als Thanatologen fängt da an, wo für andere das Leben endet. Tini und Markus bereiten Verstorbene für die Aufbahrung am offenen Sarg vor und begleiten Angehörige beim Abschiednehmen. Liebevoll sorgen sie für den toten Körper – ob entstellt, verstümmelt oder erst nach Tagen aufgefunden. Sie waschen, restaurieren und konservieren die Toten so, dass ein letztes Berühren, ein letzter Kuss möglich werden.Der Film nähert sich den beiden bestechend offenen Menschen mit diesem außergewöhnlichen Beruf, die uns mit Körper, Tod und eigenen Grenzen konfrontiert. Da wo Kirche und Kult allgegenwärtig sind, setzen Tini und Markus auch auf individualisierte Abschiedsrituale und tun für die Angehörigen all das, wovor uns normalerweise ekelt. In diesem umstrittenen Geschäft mit dem Tod gibt es kaum ein Tabu, das sie noch nicht gesehen, gerochen, ertastet und erlebt haben. Doch sie seien hart im Nehmen, beteuern die zwei Profis. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 26.11.2020 WDR Verliebt in ein Fake-Profil – Liebesbetrüger im Internet
Folge 36 (45 Min.)Nach dem Tod ihres Mannes macht sich Meta auf die Suche nach einem neuen Partner. Sie ist 60 Jahre alt und will nicht alleine bleiben. Es dauert nicht lange, da schreibt sie ein äußerst attraktiver Mann auf einer Online-Partnerbörse an. Er gibt an, ein in Dubai lebender amerikanischer Antiquitätenhändler zu sein. Schon nach kurzer Zeit schreiben sich die beiden lange, persönliche Nachrichten. Meta verliebt sich über beide Ohren – obwohl sie den Mann nie gesehen hat, sondern nur online mit ihm Nachrichten austauscht. Dann geht alles ganz schnell.Der Mann schreibt eines Tages, er sei überfallen worden, liege im Krankenhaus und benötige dringend Geld für die Behandlung. Geld, das sie ihm schicken soll. Wenn Meta heute, ein Jahr später, daran zurückdenkt, kann sie kaum fassen, wie sie so blind sein konnte, dem Mann große Summen Geld zu überweisen. Denn am Ende stellt sich heraus: Nicht nur die Geschichte mit dem Überfall war erfunden, auch der Mann war eine Erfindung. Es gab ihn gar nicht. Meta war einem Liebestrickbetrüger auf den Leim gegangen – und viel Geld los. Hunderte deutsche Frauen fallen jedes Jahr auf Liebestrickbetrüger im Internet herein. Die Hintermänner sitzen meist im westlichen Afrika. Mit gestohlenen Fotos von attraktiven Männern schmeicheln sie ihren Opfern, um ihnen schließlich mit raffinierten Methoden Geld aus der Tasche zu ziehen. Helga kennt hunderte Opfer von Liebesbetrügern. Die Norddeutsche hat vor zehn Jahren ein Onlineforum gegründet, nachdem sie beinahe selbst auf einen sogenannten Romance-Scammer hereingefallen wäre. In dem Forum veröffentlichen Betroffene ihre Geschichten und die Bilder der Betrüger. Pro Tag melden sich zwischen drei und sieben Betroffene. Helga sammelt Informationen, um andere zu warnen und ihnen zu helfen. Und: Sie dreht den Spieß um, um gemeinsam mit anderen Frauen und der Polizei die Betrüger zu stellen. Die Frauen erfinden ihrerseits Scheinidentitäten und organisieren vermeintliche Geldübergaben. Dann schlagen sie bzw. die Polizei zu. Menschen hautnah portraitiert drei Frauen: Opfer von Liebesbetrügern und Jägerinnen, die die Betrüger überführen wollen. Wie funktioniert die „Masche“ der Betrüger? Und warum fallen so viele Frauen darauf herein? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 03.12.2020 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.