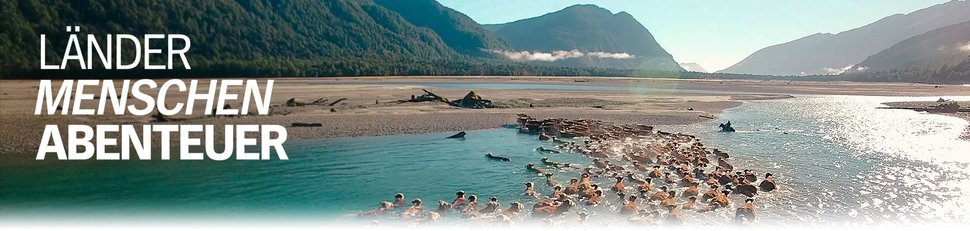1783 Folgen erfasst, Seite 45
Myanmar – Im Schatten der Pagoden
Bis 1989 hieß das Land Birma oder Burma und war für Menschen aus dem Westen kaum zugänglich. Heute heißt der größte Festlandstaat Südostasiens Myanmar und ist doppelt so groß wie Deutschland. Myanmar, das vom Militär regiert wird, sucht den Anschluss an die Industrieländer und öffnet sich behutsam dem Tourismus, denn das Land ist mit einer fast unbeschreiblichen Schönheit beschenkt worden, malerisch und zugleich verzaubernd. Ein Team des Hessischen Rundfunks hat das Land besuchen können, wenngleich „der Mann der Regierung“ immer bei den Dreharbeiten dabei war und „Empfehlungen“ gab, was zu filmen sei und was nicht. Dennoch gelang es, die touristischen Höhepunkte des Landes zu erleben, wie etwa die Shwedagon-Pagode in der Hauptstadt Rangoon oder aber die Arbeit der Fischer auf dem Inle-See.Vor allem aber war das Fernsehteam von einem kleinen Volk fasziniert, das im Nordosten des Landes lebt und Pa-O heißt. Die Region war noch vor wenigen Jahren „Sperrgebiet“ – auch das ist ein Grund dafür, warum das Volk derart bescheiden und im Einklang mit der Natur und dem Buddhismus lebt. „Moderne Errungenschaften“ gibt es nicht bei den Pa-O, kein Plastik, Radio, Fernsehen oder Coca Cola. Es ist ein glückliches Volk, vielleicht auch deshalb, weil das Zentrum der Militärmachthaber weit weg in der Hauptsstadt liegt. (Text: hr-fernsehen) Myanmar – Leben am Großen Strom (1): Ayeyarwady – Von Bhamo bis Mandalay
Eine Reise entlang des Ayeyarwady, der über 2.170 Kilometer Myanmar durchfließt. Myanmar, das einstige Birma, wird von einem Fluss geprägt: dem Ayeyarwady. Über 2.170 Kilometer durchfließt er das Land. Er verbindet die wichtigsten historischen Orte Myanmars und ist gesäumt von Stupas, Tempeln und Pagoden. Und nirgendwo sonst in Asien reihen sich so viele buddhistische Klöster auf wie am Ayeyarwady, der von der Mündung bis fast an die chinesische Grenze schiffbar ist. Am Mittel- und Oberlauf ist er noch heute oft die einzige Verbindung zur Außenwelt und viel befahren.Einen Monat lang fuhren die Filmemacher Rolf Lambert und Bernd Girrbach auf dem Fluss. Die Reise beginnt in der Kleinstadt Bhamo und führt im ersten Teil der Dokumentation bis in das zauberhafte Mandalay, der letzten Hauptstadt des birmanischen Königreichs. Die Kleinstadt Bhamo war schon zu Kolonialzeiten der letzte Außenposten im Norden des Landes und Endstation der Ayeyarwady-Dampfer. Nicht weit entfernt wird in einer Mine das Gold des Ayeyarwady geschürft. In Katha, der ersten kleinen Stadt am Oberlauf, legt frühmorgens ein privates „Expressboot“ ab, eine junge Frau von 27 Jahren ist die Eignerin. Sie fürchtet den gefährlichen Frühnebel, denn der Ayeyarwady ist breit, aber nicht tief. Gegen Mittag stoppt sie an der kleinen Tempelstadt Ti Giang. Deren Bewohner leben davon, für die vielen durchfahrenden Bootspassagiere köstliches Mittagessen zu kochen. Eine Tagesreise flussabwärts liegt das Dorf Myit Tan Gyi, ein „Delfindorf“. Dort hilft eine Population Süßwasserdelfine den Fischern bei der Arbeit. Immer wieder sieht man auf dem Fluss große Bambusflöße, auf denen Familien campieren. Ihr Ziel ist Mandalay. Zauberhaft ist die zweitgrößte Stadt Myanmars und letzte Hauptstadt des birmanischen Königreiches umgeben von Tempeln und Klöstern. Hier betreibt die 30-jährige San San Shwe ein Geschäft, das es nur in Mandalay gibt. Ihre „Goldschläger“ hämmern jenes hauchfeine Blattgold, das die Buddha-Statuen im ganzen Land verziert. (Text: BR Fernsehen) Myanmar – Leben am Großen Strom (2): Ayeyarwady – Von Mandalay ins Delta
Eine Reise entlang des Ayeyarwady, der über 2.170 Kilometer Myanmar durchfließt. Der zweite Teil der Dokumentation beginnt in Mandalay und führt bis zum Flussdelta. Das größte Schiff auf dem Fluss Ayeyarwady, die „Mya-Ayeya“, kennt jedes Kind. Die 100 Jahre alte zweistöckige Fähre mit ihren zwei vertäuten Lastkähnen ist ein schwimmender Supermarkt, der viermal jährlich Myanmars großen Strom rauf- und runterfährt, Über die Schiffslautsprecher ertönt der „Marktbootsong“, wenn sich das Schiff einem Dorf nähert. Dann wird bis abends um zehn Markt abgehalten, eine Sensation für die entlegenen Dörfer. Leider will die Regierung das Marktboot stilllegen, heißt es. Mit der Öffnung Myanmars setzt man auf Straßenbau. (Text: BR Fernsehen)Das Mysterium der sibirischen Mumie
Mitten in der sibirischen Steppe, nahe der mongolischen Grenze und nur hundert Kilometer vom Baikalsee entfernt, steht das Kloster Ivolginsk. Es war das einzige buddhistische Kloster, in dem die Mönche auch während der Sowjetzeit ihren Glauben praktizieren konnten. Ihnen gelang es, ein Geheimnis zu bewahren, das erst jetzt an die Öffentlichkeit gelangt ist. Im Inneren ihres Tempels bewahren sie die Leiche des Chambo Lama Itigilow auf. Das Besondere daran: Der buddhistische Priester starb vor über 75 Jahren, sein Körper ist jedoch bis heute nicht verwest. Zwei Männer wollen dieses Rätsel nun ergründen – jeder auf seine Weise.Der 27-jährige Mönch Bair ist zu sowjetischer Zeit in einer Kleinstadt aufgewachsen. Obwohl der Buddhismus damals unterdrückt wurde, haben ihn seine Eltern religiös erzogen. Seit vier Jahren lebt Bair im Kloster Ivolginsk, wo er in die Geheimnisse der buddhistischen Philosophie und der tibetischen Heilkunst eingeweiht wird – und sich nebenbei der Erforschung des Lebens und Sterbens des Chambo Lama Itigilow widmet. Auch der Pathologe Juri Tampoleev versucht, das Geheimnis des Lama zu lösen. Er durfte den Leichnam vor einigen Jahren einmal untersuchen und möchte eine wissenschaftlichen Erklärung für dessen guten Zustand finden. (Text: hr-fernsehen) Mythos Gotthard – Pass der Pioniere
Der Gotthard zählt heute zu den wichtigsten Alpenübergängen Europas. Wo einst ein kleiner Pfad über das Hochgebirge führte, verläuft heute der längste Eisenbahntunnel der Welt. Die Filmautorin begibt sich auf Spurensuche nach den unbekannten Seiten des Gotthards. Die Bilder des preisgekrönten Kameramanns Thomas Riedelsheimer zeigen die außergewöhnliche Schönheit der alpinen Gebirgslandschaft. Spektakuläre Drohnenaufnahmen ermöglichen dem Zuschauer eine bisher unbekannte Perspektive. Die Musik des vielfach ausgezeichneten Komponisten Fabian Römer lässt die Reise über den Gotthard zu einem unvergesslichen Abenteuer werden. (Text: BR Fernsehen)Mythos Katar – Wüstenstaat der Gegensätze
45 Min.Es ist eine schillernde und bunte Welt voller arabischer Abenteuer: die Welt der Scheichs, die Welt des Big Business. Und es ist auch ihre Welt: Millionen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter machen den Traum einer modernen Monarchie erst möglich. Katar! Für viele Menschen ist das Land ein korruptes, steinreiches Emirat voller Zwangsarbeiter ohne Rechte und Geschäftemacher mit dubiosen Machenschaften. Und tatsächlich, vieles hier ist fragwürdig und undemokratisch, denn Katar ist eine absolute Monarchie mit dem Emir an der Spitze.Zugleich aber ist Katar fortschrittlich und modern. Alles in Katar ist auf Doha ausgerichtet, die Hauptstadt an der Ostküste. Ihre imposante Skyline ist mittlerweile weltberühmt. Vor 30 Jahren stand hier nur das altehrwürdige Sheraton Grand als einziges Hotel. Heute ist Katar ein einziger Boom. Öl und Gas haben die Entwicklung des Emirats rasant beschleunigt. Abdullah Bin Hamad Al Attiyah ist daran nicht ganz unschuldig. Geboren in den 1950er-Jahren hat er den rasanten Aufstieg nicht nur selbst miterlebt, sondern sozusagen ausgelöst. Er gehört zu den handverlesenen Katari, die mit Euer Exzellenz angesprochen werden. Er ist ranghoher Staatsmann, Diplomat und kennt den Emir persönlich. Und Abdullah war 20 Jahre lang Katars Öl- und Energieminister: „Dass wir zum größten Exporteur für LNG, für Flüssiggas, wurden, das ist mein Verdienst. Darauf bin ich stolz. Ich konnte nicht nur meinen Traum verwirklichen, sondern den Traum aller Katari. Jetzt sind wir zu einem der reichsten Länder der Welt geworden.“ Abdullah hat dieses verschmitzte Lachen und die einladende Herzlichkeit, die die meisten Menschen in Katar sympathisch machen. Den phänomenalen Aufschwung haben die Katari natürlich nicht allein geschafft, im Gegenteil. Es gibt nur rund 400.000 katarische Staatsbürger. Die Hauptlast, dieses Land voranzubringen, tragen die 2,2 Millionen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Etwa acht von zehn Menschen, die in Katar leben, sind Migranten. Knapp eine Million von ihnen arbeitet auf den Baustellen des Emirats, die meisten kommen aus Nepal, Indien, Bangladesch oder den Philippinen. Ihre Schicksale lassen den Glanz des Emirats mitunter in einem ganz anderen Licht erscheinen: „Bisher ist keiner von meinen Freunden gestorben“, sagt Yogendra Chhiteri. „Aber sowas passiert manchmal. Meistens hört man von Vorfällen mit Herzanfall.“ Die Bauarbeiter schuften bei zum Teil großer Hitze und für wenig Geld. Der Mindestlohn in Katar liegt bei 1000 Ryal, gut 260 Euro. Es gibt nur wenige Orte hier, an denen sich Gastarbeiter und Einheimische auf Augenhöhe begegnen und dasselbe wollen. Das Beirut Restaurant ist so ein Ort. Für wenig Geld essen hier alle, Bauarbeiter, Akademiker, Zugewanderte, echte Kataris mit ihren Familien. Und alle wollen Falafel, das Beste im ganzen Land. Der Charme des Lokals erschließt sich nicht unmittelbar, spätestens aber dann, wenn die Gäste ins Schwärmen kommen: „Dieses Restaurant ist das Restaurant meiner Kindheit. Die Qualität hier ist die Beste. Es ist so einzigartig, dass man immer wiederkommt.“ Das Beirut gibt es schon seit 1959. Bis heute ist es fest in der Hand von Familie Shahin. Ursprünglich kommt die Familie aus dem Libanon. Seit mehr als 60 Jahren ist ihr Erfolgsrezept ziemlich simpel. „Einfach gesagt: die Liebe zum Kochen und der Stolz“, sagt Ali Shahin junior. „Ich bin sehr stolz darauf!“ Der Stolz und die Leidenschaft treiben auch Lolwa Al-Marri an. Ihr großes Ziel: die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Sie möchte die erste katarische Triathletin bei Olympischen Spielen sein. Doch Tag für Tag kämpft Lolwa für noch viel mehr: „Manche raten mir immer wieder vom Sport ab! Weil wir in Katar Gebräuche und Traditionen haben, dass Frauen zu Hause bleiben, daher sieht man beim Sport leider nur wenige Frauen“, sagt sie. „Ich glaube aber, dass Sport für die Psyche der Frauen sehr wichtig ist. Hoffentlich können wir die männliche Denkweise ändern.“ Tatsächlich hat sich in Katar in puncto Frauenrechte schon sehr viel getan. Auch wenn es aus europäischer Sicht seltsam klingen mag: Frauen fahren hier völlig selbstverständlich Auto und sind berufstätig. Fast 70 Prozent der Studierenden an katarischen Universitäten sind Frauen. Trotzdem ist die Gesellschaft in Teilen noch immer konservativ. Lolwa will also nicht nur sich selbst beweisen, was sie kann: Sie nimmt an der legendären „Al Adaid Desert Challenge“ teil, einer Kombination aus Fahrradrennen und Lauf quer durch die Mesaieed-Wüste im Süden Katars, kurz: einer Tortur für Sportverrückte. In der Metropole Doha dagegen sieht so gar nichts mehr nach Wüstenstaat aus. Tatsächlich rüstet sich das Emirat längst mit Milliardeninvestitionen für die Zeit, wenn Öl und Gas zu Ende gegangen sind. Ein Paradebeispiel für dieses moderne, andere Katar ist Education City: Auf dem Reißbrett hat das Emirat ein ganzes Universitätsviertel entworfen und kurzerhand gebaut, inklusive Parks, Fußball- und Reitstadion, Moschee, Krankenhaus und Kongresszentrum. Manch renommierte Universität der Welt hat hier einen Standort, die Northwestern University oder George Washington University etwa. Mitten in Education City arbeitet Ebrahim Al Bishri im imposantesten Bau des Viertels, einem neuen Wahrzeichen der Stadt: der Nationalbibliothek, natürlich die größte Bibliothek im Mittleren Osten. „Manchmal kann ich es nicht glauben, dass ich hier arbeiten darf“, sagt Ebrahim. „Wer diesen Ort besucht, vergisst ihn nie.“ Es ist ein ikonischer, sonnendurchfluteter Bau des niederländischen Stararchitekten Rem Koolhaas und soll das Aushängeschild sein für einen neuen Geist im Land: offen, transparent und klug. Katar hat eines der besten Bildungssysteme in der Golfregion. Schule, Universität, auch die Bibliothek: alles kostenlos, für alle. Auch das ist Katar. Ein Land, von dem jeder gehört hat und das kaum einer wirklich kennt. Ein Wüstenstaat der Gegensätze. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 27.10.2022 NDR Mythos Ostsee
Kilometerlange weiße Strände, uralte Buchenwälder, durch die das Blau des Meeres schimmert, verwunschene Badeorte und noble Hotels in Jugendstilvillen – seit der Wende ist sie wieder da, die deutsche Ostseeküste. Rundum herausgeputzt, aber doch mit dem altbekannten Charme. Lisa Eder-Held spürt dem Mythos Ostsee nach und porträtiert Menschen, für die die Küste Heimat, Passion und Sehnsuchtsziel ist. Es ist Juni, die Zeit der Segelregatten mit den Zeesbooten. Für den 23-jährigen Paul Thamm sind die traditionellen Fischerboote der Ostsee „mit ihrem Rumpf aus Eichenholz, den braunen Segeln und einem Gewicht von 13 Tonnen ein Traum“. Seit 200 Jahren ist die Ostsee ein Ort der Verheißung.Damals kamen das Baden im Meer und das Kuren an der See in Mode. Bald kamen nicht nur Reiche und Adelige zur Sommerfrische, die Ostsee wurde zur „Badewanne Berlins“ und zum Treffpunkt von Literaten und Künstlern. Sie suchten, was auch die Germanistin Ute Fritsch bis heute anzieht: der unendliche Horizont, das klare Licht und die unberührte Natur. Ute Fritsch wandelt auf den Spuren illustrer Künstlergäste und bietet literarische Führungen an. Das einzigartige Naturschauspiel von Werden und Vergehen fasziniert auch den Berufsfotografen Heinz Teufel. Er hält seit Jahren in Bildern fest, wie sich die Landschaft am Weststrand verändert. Das Meer entreißt dem Land Sand und Geröll und spült es dann an ruhigeren Küstenabschnitten wieder an. Ein Teil dieser Strände liegt im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Hier versammeln sich jedes Jahr im Herbst rund 70.000 Kraniche zu ihrem Weiterflug nach Süden. „Die Ostsee ist einer der größten Kranichrastplätze weltweit“, erzählt der Biologe Günther Nowald. Dem Tourismus beschert der Kranichzug „eine fünfte Jahreszeit“. Vogelfreunde und Ornithologen reisen aus aller Welt an, um dieses Spektakel zu erleben. Von alldem unbeeinflusst fährt der Fischer Siegfried Thornow jeden Tag zur selben Zeit mit seinem Boot hinaus, seit 46 Jahren macht er das. (Text: BR Fernsehen) Mythos Ural – Gold, Edelsteine und ein toter Zar
„Ja, gibt es denn bei euch in Deutschland keine Hitlerbüsten?“ Juri Iwanowitsch fragt ganz naiv, während Filmautor Albrecht Reinhardt in seinem Garten eine Bronzefigur von Stalin anschaut. Juri ist der reichste Mann in Satka, einem der vielen Stahlkocherorte im Industriegürtel des Süd-Ural. Früher war er Baggerführer. Heute gehören ihm Nähereien, Tankstellen und Lebensmittelgeschäfte, und er ist ein Waffen-Narr. Die zweite Reise durch den Ural führt Albrecht Reinhard in die Welt der Waffenschmieden und der Malachitkönigin, der Steinzeithöhlen und der Bergtundra. In den Wäldern stehen die Lärchen und Kiefern wie Soldaten Spalier. Vor allem aber ist der südliche Ural eine schier unerschöpfliche Schatzkammer von Gold- und Kupferadern, Smaragdfeldern und seltenen Mineralien. Ob Jekaterinenburg, die Ignatijewska-Höhle oder die kasachische Steppe – der Mythos Ural zieht jeden in seinen Bann. (Text: hr-fernsehen)Mythos Ural – Vom Polarkreis ins Tal der Petschora
Das Kettenfahrzeug keucht und faucht. Seine schwarze Rauchfahne verdunkelt die Schneewehe, in der das Gefährt von Filmautor Albrecht Reinhardt festsitzt. Endlich hebt es sich über die verkarsteten Schneemassen, und er ist wieder frei. Doch schon nach einer Viertelstunde sitzt er in der eisigen Weite der polaren Tundra erneut in einer Schneefalle. Um dem Mythos Ural auf die Spur zu kommen, tritt Albrecht Reinhard eine weite Reise an. Er besucht die nomadischen Rentierzüchter der Nenzen, die eisige Wüste von Workuta und die rätselhaften Felsgestalten von Manj-Pupu-Njer. (Text: hr-fernsehen)Nachbarschaftshilfe – Die Mousgoum und Mbororo in Zentralafrika
Es sind zwei ganz unterschiedliche Völker, die im Grenzgebiet zwischen dem Tschad und Kamerun im Norden Zentralafrikas am Logone-Fluss leben. Die Mbororo sind Nomaden und Viehzüchter. Etwa 50.000 Menschen sollen es sein. Das Hab und Gut der Großfamilie, mit der das Filmteam von Peter Weinert eine Woche umherzieht, besteht aus Zelten, 1.300 Rindern, 200 Schafen, 150 Ziegen und vierzig Pferden. Die Mousgoum auf der anderen Seite des Grenzflusses in Kamerun leben vor allem vom Fischfang und betreiben Landwirtschaft. Die Mousgoum gehören mit knapp 40.000 Menschen zu den kleinsten Ethnien in Afrika.Sie sind ebenso strenggläubige Moslems wie die Mbororo. Regiert wird das Volk aus einem Lehmpalast, der das Zentrum eines traditionellen Sultanats ist – ein Staat im Staat, von der Regierung Kameruns akzeptiert. Es gibt einige solcher Königreiche in Afrika, doch sie sind selten offen für Gäste aus einer anderen Welt. Für das Filmteam von Peter Weinert hat Sultan Paye Yaya eine Ausnahme gemacht. Seit 1965 herrscht der 77-Jährige, der mit „Seine Majestät“ angesprochen wird, über sein Volk, seine 16 Minister ernennt er auf Lebenszeit. Ardo Assan ist das Oberhaupt einer siebzigköpfigen Großfamilie der Mbororo. Er hat vier Frauen und zwölf Kinder. Mit dem Sultan in Kamerun verbindet ihn eine langjährige Freundschaft – ein Glück für seine Familie: Wegen der Trockenheit in Tschad verenden immer mehr Tiere. Wie schon so oft in der Vergangenheit erlaubt der Sultan der Familie mit ihrer Herde, nach Kamerun überzusiedeln, um die Weidegründe der Mousgoum zu nutzen. Etwa 1.700 Tiere durchqueren den Logone-Grenzfluss, ein beeindruckendes Schauspiel. Für das Weiderecht wird ein Pachtzins ausgehandelt, teils in bar, teils in Naturalien – Nachbarschaftshilfe über die Grenze hinweg. (Text: hr-fernsehen) Nach Surinam – der Falter wegen – Die beschwerliche Reise der Maria-Sibylla Merian in die Tropen
Deutsche TV-Premiere So. 02.06.1991 S3 von Rainer SchirraNachtexpress nach Surabaya – Mit dem Zug durch Java
Inspiriert von Bertolt Brechts Ballade „Surabaya Johnny“ besteigt Robert Hetkämper mit einem Filmteam in Jakarta den Nachtexpress nach Surabaya. Die Reise mit der Eisenbahn führt den Filmemacher quer über die indonesische Hauptinsel Java, von West nach Ost. Er taucht ein in eine Welt aus uralten Tempeln buddhistischer und hinduistischer Tradition, Moscheen, rauchenden Vulkanen und grünen Reisterrassen. Surabaya: Der Name weckt Assoziationen von Abenteuer, Exotik und Verruchtheit. Inspiriert von Bertolt Brechts Ballade „Surabaya Johnny“ besteigt Robert Hetkämper mit einem Filmteam in Jakarta den Nachtexpress nach Surabaya.Die Reise mit der Eisenbahn führt den Filmemacher quer über die indonesische Hauptinsel Java, von West nach Ost. Er taucht ein in eine Welt aus uralten Tempeln buddhistischer und hinduistischer Tradition, Moscheen, rauchenden Vulkanen und grünen Reisterrassen. In der alten Königsstadt führt die Tochter des amtierenden Sultans den Reporter durch den alten Palast. Eisenbahnromantik pur findet er in Cepu in Zentraljava. Dort fährt bisweilen noch eine alte Dampflok aus deutscher Fabrikation durch den noch vorhandenen Rest des inzwischen abgeholzten Dschungels. Bei den Ölpiraten von Bojonegoro erlebt das Filmteam apokalyptische Szenen wie aus alten „Mad Max“-Filmen. Mit einer Gruppe von Offroad-Enthusiasten geht es zum Vulkan Bromo, einer der spektakulärsten Vulkanlandschaften der Erde. Links und rechts der Strecke finden Begegnungen mit Menschen aus unterschiedlichen Schichten und Berufen statt, ein Land in tief greifendem Wandel. Für Robert Hetkämper ist die Reise auch eine Bestandsaufnahme dieses Wandels. Vor 15 Jahren ist er schon einmal mit dem Zug durch Java gefahren. Manches ist geblieben, vieles hat sich verändert. Nach der Ankunft in Surabaya macht sich das Team auf die Suche nach der legendären Exotik der Stadt. (Text: BR Fernsehen) Nafoun – oder es gibt kein Feuer
Deutsche TV-Premiere So. 19.04.1992 S3 von Paul SchlechtNamibia – Die Rückkehr der Wüstenlöwen
Wüstenlöwen sind sicher die geheimnisvollsten Raubkatzen der Welt. Jahrhunderte lang durchstreiften sie die einsame Dünenlandschaft und die schroffen Bergregionen entlang der Skelettküste Namibias. Doch vor mehr als zwei Jahrzehnten verschwanden die Könige der Wildnis und galten fortan als ausgestorben. Erst vor kurzem machte der Biologe Dr. Philip Stander eine sensationelle Entdeckung. Eine Handvoll Löwen hatte in einem abgelegenen Tal überlebt. Der Film zeigt, wie Philip Stander diese einmaligen Tiere aufspürt und ihr Verhalten erforscht. Zum ersten Mal ist zu sehen, wie die Löwen ihre Beute jagen, um in der Wüste zu überleben. Die Anpassung an die extreme Umgebung birgt noch eine weitere überraschende Erkenntnis.Stander hat herausgefunden, dass die Tiere sich anders verhalten als ihre Verwandten in der Savanne. Wüstenlöwen jagen meist am Tag und auch der Nachwuchs eines Löwenmännchens wird nicht von Konkurrenten getötet. Als ob die Katzen wüssten, dass jeder kleine Löwe wichtig für die Erhaltung der Art ist. Auch die Ursache für das einstige Verschwinden der ungewöhnlichen Löwen macht Raubtierexperte Stander ausfindig. Schuld daran sind die Menschen. Um ihre Herden zu schützen, töteten sie die Raubkatzen. Jetzt versucht der Forscher die Einheimischen davon zu überzeugen, die Tiere als Attraktion für Touristen am Leben zu lassen. (Text: SWR) Namibia – Land der roten Stille
Schwarzwälder Kirschtorte und Rosinenbrot im Café Schneider, der Gesangsverein von Swakopmund und die deutsche Zeitung von Windhoek – Namibia scheint immer noch ein Stück weit „Deutsch Südwest-Afrika“ zu sein – oberflächlich betrachtet. In der seit 1990 unabhängigen Republik Namibia finden sich tatsächlich noch Spuren der jüngeren kolonialen Vergangenheit. Die deutsche Besatzung war aber nur eine knappe Episode um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Geschichte des Landes ist unendlich viel reicher und komplexer. Am Brandberg und bei Twyfelfontein findet man Petroglyphen und Spuren einer Besiedlung, die 20.000 Jahre zurück reichen.Im Nordwesten, im Kaokoveld, lebt das Volk der Himba ein traditionelles nomadisches Leben. Himba, San, Herero, Nama – zwölf verschiedene Völker siedeln auf dem Gebiet der Republik Namibia. Jedes hat seine eigene Geschichte, seine Mythen, Traditionen und Bräuche. Namibia ist gleichzeitig ein sehr altes und ein junges Land; vierzig Prozent der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt. Daneben ist Namibia ein unvergleichlich vielfältiges Naturparadies. Filmautor Peter M. Kruchten besucht die sternförmigen Sanddünen im Sossusvlei, den Fish River Canyon im Süden, die Köcherbäume von Keetmanshoop und die rätselhafte Welwitschia-Staude in der Wüste Namib unweit der Skelettküste. Der Film spannt den Bogen von der prähistorischen Vergangenheit in die Gegenwart und stellt Menschen vor, die dem Land sein heutiges Gesicht gegeben haben. Namibia – so groß wie Deutschland und Frankreich zusammen, aber mit unter zwei Millionen Menschen dünn besiedelt – ist so etwas wie die Arche Noah Afrikas. Ein stilles, bezauberndes Land zwischen Kalahari und Namib, ein Land der roten Stille. (Text: hr-fernsehen) Namibia – Leben mit der Wüste
45 Min.Namibia – Leben mit der Wüste Im ausgetrockneten Flussbett des Ugab leben die letzten Wüstenelefanten Namibias.Bild: NDR/Extravista/Erik LötschDie Namib ist die älteste Wüste der Welt, Millionen Jahre alt. Sie prägt den jungen Nationalstaat Namibia im Südwesten Afrikas. Endlos scheinende Dünenberge und unwegsames Gelände. Hitze, Staub, kaum Regen. Eine Region mit extremen Herausforderungen haben sich Menschen ausgesucht, um hier ihr Glück zu finden. Denn die Wüste ist voller Leben. Als Bauarbeiter ist Immanuel Frederick vor fünf Jahren auf die Farm Koiimasis am Rande der Tirasberge gekommen. Inzwischen ist der 26-Jährige der Mann für die komplizierten Pferdefälle auf der Ranch. Mit viel Geduld zähmt er die Nachfahren der berühmten Namib-Wildpferde.Ein harter Job in gefährlicher Umgebung. Gerade treibt sich ein Leopard in der Gegend herum, aber die einjährigen Fohlen wollen partout nicht in den Stall. Edelsteine sind die Leidenschaft von Lorri Raaths. Unter sengender Hitze schürft der 68-Jährige im Minengebiet in der Nähe des Brandbergmassivs. Amethyste, Turmaline, Bergkristalle gräbt er mit Stemmeisen und sogar mit bloßen Händen aus dem Millionen Jahre alten Vulkangestein. Seine Begleiter: eine Gitarre und viele Träume. Gerade hat er einen neuen Krater im Damaraland entdeckt. Sein Trinkwasser will er gewinnen, indem er den Nebel auffängt. Nebel ist ein wichtiger Feuchtigkeitslieferant für die Pflanzen in der Namib. Je näher am Atlantik, desto dichter und ergiebiger. Im Hinterland von Walvis Bay reicht die Feuchtigkeit aus, um die Nara-Melonen gedeihen zu lassen, Hauptnahrungsmittel der Topnaar, einer der ärmsten Ethnien Namibias. Martha ist am liebsten früh am Morgen unterwegs, um die saftigen und nahrhaften Früchte aus den stacheligen Büschen zu holen. Bevor sie erntet, muss sie erst die Schlangen und Skorpione vertreiben. Nandi Mazeingo hält die Erinnerung an seine Vorfahren wach. Er pflegt das Grab seines Großvaters. Die Herero und Nama hatten sich gegen die deutschen Kolonialisten erhoben. Die Deutschen ließen sie in der Wüste verdursten oder internierten sie in Lagern. Deshalb verlangt die Ovaherero Genocide Foundation weges des Völkermordes Reparationszahlungen und die Enteignung von Nachfahren deutscher Siedler. Hermann Kasona gehört zum Volk der Herero. Er arbeitet als Ranger für die Elephant-Human Relations Aid, kurz EHRA. Elefanten sind seine Lieblingstiere, er will sie unbedingt schützen. Denn im ausgetrockneten Flussbett des Ugab konkurrieren sie mit den Menschen um das lebensnotwendige Wasser. Hermann kämpft für ein besseres Verständnis der Menschen für diese Tiere. Seine Kollegin Fiona geht dafür in die Schulen, bringt den Kleinsten das Einmaleins im Umgang mit Elefanten bei. Wie eine Fata Morgana taucht die Forschungsstation Gobabeb mitten in den Wüstendünen auf. Mit futuristischem Wasserturm, Solaranlagen, Hightechpark. Junge Wissenschaftler erforschen hier die Auswirkungen des Klimawandels und unterstützen Forscher weltweit mit Klimadaten aus der Wüste. Sogar die NASA-Experten waren schon hier. Nicht umsonst trägt eine Düne auf dem Mars den Namen Namib. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 23.02.2023 NDR Namibias schöner, karger Süden – Farmen am Rand der Namib
Deutsche TV-Premiere Mi. 19.11.1997 S3 von Anna SoehringNaree – Mitbürger aus der Steinzeit
Deutsche TV-Premiere Sa. 17.01.1981 S3 von Eugen R. EssigNari Jhyowa – Das Geheimnis der Göttin
Deutsche TV-Premiere Mi. 20.02.1991 S3 von Susanne von der Heide und Joachim PriemNationalpark Komodo – Leben mit Waranen
Sie sind die größten Echsen der Welt, leben seit etwa vier Millionen Jahren auf der Erde, wurden aber erst vor 100 Jahren entdeckt – und sie sind gefährlich: Komodowarane. Ihr letzter Rückzugsort ist der Nationalpark Komodo in Indonesien. Die 45-minütige Dokumentation porträtiert die drachenähnlichen Urtiere und den Ranger David Robert Hau, der die Riesenechsen wie kaum ein zweiter kennt. Seit über 30 Jahren ist David Robert Hau Chef-Ranger im Nationalpark Komodo. Er hat in seinem Leben mit den Waranen mehr Zeit verbracht, als mit seiner Familie.Es ist sein Traumjob, die Bestände der Riesenechsen zu kontrollieren und dicht an dicht mit ihnen zu leben. So hat er sich im Laufe der Jahre ein einmaliges Wissen über Verhalten und Charakter der Tiere angeeignet. Doch ist er immer auf der Hut, auch vor anderen gefährlichen Tiere, wie der javanischen Speikobra, die er in den entlegensten Winkeln des Parks aufspürt. Wenn ein Kreuzfahrtschiff auf Komodo anlegt, ist Nationalparkhüter David Robert Hau besonders gefordert, denn die Komodowarane sind zu einer beliebten Touristenattraktion geworden. Der Nervenkitzel beim Urlaubsfoto ist garantiert. David muss nicht nur die Sicherheit der Besucher gewährleisten, er muss auch dafür sorgen, dass die Tiere nicht gestört werden. Eine schwierige Gradwanderung. Außerdem weiß er, dass der Nationalpark die Touristen als Einnahmequelle braucht und auch die Einheimischen mit dem Verkauf von Souvenirs ein gutes Auskommen haben. Doch sollte es je zu einem tödlichen Biss kommen, wäre die Existenz des Nationalparks in Gefahr – und die Warane damit dem Untergang geweiht. (Text: SWR) Die Nats – Buddhas irdische Geister
Deutsche TV-Premiere Mi. 03.05.2000 Südwest Fernsehen von Hermann SturmNaturjuwel Südkorea: Kragenbären, Kimchi und Klosterleben
45 Min.Spektakuläre Gebirgsketten, einzigartige Nationalparks und buddhistische Tempelanlagen: Die erste Folge des Zweiteilers „Naturjuwel Südkorea“ begibt sich auf eine Reise in das von Bergen dominierte Inland der Halbinsel und zur Megacity Seoul. Im Upo-Feuchtgebiet in der Provinz Gyeongsang dreht sich viel um einen sagenumwobenen Vogel: den Ibis. Der in vielen Volksliedern besungene Vogel galt hier seit den 1970er-Jahren als ausgestorben. Die Provinz Gyeongsang rief 2008 ein Wiederansiedlungsprojekt ins Leben und importierte Ibisse aus China.Im Süden befindet sich der größte und älteste Nationalpark Südkoreas: der Jirisan-Nationalpark. Mit fast 5000 Pflanzen- und Tierarten, der einzigen Bärenpopulation Südkoreas und endlosen Tälern umfasst das Gelände eine Fläche von mehr als 480 Quadratkilometern. Im Ostteil des Parks leben die Ordensschwestern des Tempels Daewonsa. Der Tempel stammt aus dem Jahr 548 und ist einer der ganz wenigen buddhistischen Nonnentempel Südkoreas. Die Nonnen bauen hier ihr eigenes Gemüse an. Mehr als 400 Gäste kommen jedes Jahr zu Besuch. An den Ausläufen des Jirisan-Parks befindet sich ein Forschungsgebiet für den Reisanbau. Die Jeolla-Provinz gilt als Kornkammer Südkoreas. Anhand mehr als 800 entwickelter Reissorten experimentiert man hier erfolgreich mit nachhaltigen Anbaubedingungen. Nur wenige Kilometer vom nördlichen Ende entfernt pulsiert das pralle Leben. Seoul ist mit knapp zehn Millionen Menschen eine Megacity und Anziehungspunkt für das moderne, zukunftsorientierte Südkorea. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.05.2025 NDR Naturjuwel Südkorea: Sinan und die 1004 Inseln
45 Min.Die Küstenregionen Südkoreas gehören zu den schönsten und traditionsreichsten Gegenden des Landes. Von den 1004 Inseln im Landkreis Sinan bis zu der abgeschiedenen Insel Heuksando erkundet die zweite Folge des Zweiteilers „Naturjuwel Südkorea“ die maritimen Nationalparks und ambitionierten Projekte der Südkoreaner. Das Biosphärenreservat Suncheon ist eines der artenreichsten Ökosysteme Südkoreas: ein Küstenfeuchtgebiet, in dem Meer, Marschlandschaft, Salzwiesen, Dämme und Deiche miteinander verbunden sind.Im Jahr 2018 wurde es zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. Umgeben von Bergen ist die Suncheon Bay ein Paradies für Vogelfans und Ornithologen. Im Südwesten Südkoreas, im Landkreis Sinan, wird das Leben von der Fischerei und der Landwirtschaft dominiert. Die Inseln wurden im Laufe der vergangenen Jahre durch unzählige Brücken miteinander verbunden. Um das Gebiet für Touristen attraktiver zu gestalten, fördert der Landkreis ungewöhnliche Forschungsprogramme wie die Zucht von Austern. Trotzdem kämpft die Region ums Überleben. Immer mehr junge Koreanerinnen und Koreaner sehnen sich nach dem pulsierenden Leben der Metropolen. Während in der einen Region der Tourismus gefördert werden soll, hat man sich auf der Insel Heuksando für die Abgeschiedenheit entscheiden. Ob Bootsbau oder Rochenfang, die Südkoreaner kümmern sich mit Leidenschaft darum, dass ihre Naturgüter nicht aussterben. Besonders auf den abgelegenen Inseln pflegen die Menschen das einfache Leben im Einklang mit der Natur. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.05.2025 NDR Die Neandertaler – Ihr Leben – ihr Untergang (1)
Es war eine Weltsensation, als Steinbrucharbeiter 1856 in einer Höhle im Neandertal bei Düsseldorf einen Schädel entdeckten, der zwar von einem Menschen stammte, doch starke Oberaugenwülste besaß – wie bei einem Affen. Der Neandertaler war entdeckt, eine zweite Art Mensch, die nicht zu unseren Ahnen zählt und in Europa eine Zeitlang die gleichen Lebensräume besiedelte. Wer waren die Neandertaler? Wie lebten sie? Diese Fragen will die Dokumentation anhand neuester Forschungsergebnisse beantworten – nicht mit Wissenschaftler-Statements und Bildern aus Museen.Die Produzenten inszenierten ein faszinierendes Urwelt-Drama, das packender nicht sein kann. Sieben Schauspieler in genialer Maske und perfekt einstudiertem Verhalten stellen eine Neandertal-Familie dar. Glaubhaft wird deren täglicher Kampf ums Überleben in Szene gesetzt. Der Zuschauer ist dabei, wenn der Anführer mit seinen zwei Brüdern einen Hirsch über eine Klippe hetzt, das jüngste Mitglied der Sippe von einem Wolf angegriffen und eine junge Frau einer Nachbargruppe gekidnappt wird, um die eigene Familie zu vergrößern. Gegen Ende der letzten Eiszeit beginnt der Niedergang der Neandertaler. Der Homo sapiens ist von Asien nach Europa eingewandert und macht dem Urmenschen den Lebensraum streitig. Ein „Showdown“ beginnt – nach dem Prinzip „Survival of the fittest“. Doch der überlegenen Technik – vor allem den neuen Waffen des modernen Menschen – haben die Neandertaler nichts entgegen zu setzen. So werden sie in die kargen Randbereiche Europas abgedrängt; ihre Spur verliert sich vor etwa 35.000 Jahren auf dem heutigen Balkan. (Text: hr-fernsehen) Die Neandertaler – Ihr Leben – ihr Untergang (2)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail