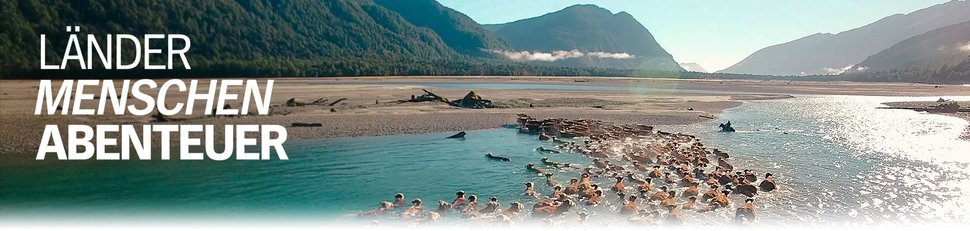1783 Folgen erfasst, Seite 44
Mit dem Zug zum Great Barrier Reef – Australiens Sunlander Express
Vom Paradies der Surfer an Queenslands Goldküste bis hinauf in den tropischen Regenwald im Norden Australiens führt diese Zugreise des ARD-Korrespondenten Robert Hetkämper durch Down Under. Der Sunlander-Express verkehrt auf alter romantischer Strecke zwischen Brisbane und der australischen Tropenmetropole Cairns, dem Ausgangspunkt für Tauchtouren auf dem Great Barrier Reef. Die Reise des ARD-Korrespondenten Robert Hetkämper führt unter anderem zu den Walen vor Fraser Island. Auf Magnetic Island trifft das Team auf deutsche Forscherinnen, die sich um den Erhalt des Großen Barriereriffs sorgen, umweltbewusste Zuckerfarmer und furchtlose Krokodilwärter.Deutlich wird die wachsende Bedeutung des „Sonnenscheinstaates“ für den gesamten Kontinent: Die gewaltigen Kohlevorkommen von Queensland machen Australien zum größten Steinkohle-Exporteur der Welt. Da Australien selbst seine Rohstoffe nicht verarbeitet, sondern ausschließlich auf deren Ausfuhr setzt, wird das Land mehr und mehr abhängig von seinen Großkunden, allen voran China. Für die Australier selbst wird Queensland mehr und mehr zum „Florida am Pazifik“. Rund um Cairns entstehen die Villensiedlungen für reiche Rentner. Aber noch ist genug Raum für Abenteuer: Der Hubschrauberpilot Chris Rose liebt die unglaubliche Farbenpracht des Great Barrier Reefs und macht sich einen Heidenspaß daraus, wenige Meter über den Brechern der Brandung hinwegzufliegen. Auf die Frage an ihn: „Haben Ihre Passagiere nicht manchmal Angst?“, antwortet er: „Aber ja. Und ich auch …“ (Text: BR Fernsehen) Mit der Feuerwehr nach Indien
Matthias Mesletzky, 42, aus Berlin wagt zusammen mit seiner Familie, Frau Jacqueline, 33, Tochter Désirée, 10, sowie Sohn Sebastian, 18, ein einzigartiges Abenteuer: Mit einem umgebauten Feuerwehrwagen als Expeditionsfahrzeug begibt er sich während einer einjährigen Reise auf dem Landweg nach Indien. Die Family-Orient-Tour 1997/98 führt über Südosteuropa, die Türkei, Syrien, den Iran, Pakistan nach Indien und zurück. Ziel der Reise ist das hautnahe Kennenlernen von Ländern und Menschen, das Erleben fremder Kulturen im Alltag. (Text: rbb)Mit der Transsib in die Olympia-Stadt
Wer sich dem Austragungsort der Olympischen Spiele 2008 mit Muße annähern will, nimmt einfach den Zug. Man steigt in Berlin ein, in Moskau um und rollt durch bis Peking. Eine abenteuerliche Reise über fünf Grenzen, sieben Zeitzonen, 10.000 Kilometer – zunächst durch Polen, dann durch die Wälder Weißrusslands. Man überquert den Ural, zuckelt durch die Taiga Sibiriens, rumpelt am Baikalsee entlang, braust durch die Steppen der Mongolei und die Wüste Gobi, an der Großen Mauer und chinesischen Dörfern entlang bis nach Beijing, dem Austragungsort der Olympischen Spiele im Sommer 2008. Wir lernen russische Lokführer und sibirische Mütterchen, chinesische Zugbegleiter und mongolische Köchinnen kennen.Wir sind dabei, als eine Mitreisende in Sibirien verlorengeht, an der nächsten Station wieder auftaucht und der ganze Zug ihre glückliche Rückkehr feiert. Zehn Tage Transsib heißt: Zeit fürs Gucken, Träumen, Lesen, Schlafen, Feiern auf der längsten und legendärsten Eisenbahnstrecke der Welt. Man lernt Menschen kennen, die man im Flugzeug nie getroffen hätte, sieht Landschaften, über die man sonst nur hinübergerauscht wäre, und am Ende finden alle Reisenden: Es hat sich gelohnt. (Text: hr-fernsehen) Mit Hurtigruten in die Mitternachtssonne – Eine Seereise von Bergen nach Kirkenes
Sie nennt sich die „schönste Seereise der Welt“, die Fahrt auf der Hurtigrute, der „Reichsstraße Nr.1“ entlang der norwegischen Küste. Sie führt nordgehend von Bergen nach Kirkenes an der russischen Grenze und südgehend zurück nach Bergen. Insgesamt elf ganz unterschiedliche Hurtigrutenschiffe bedienen als Express-Linienschiffe für Passagiere und Fracht täglich mehr als dreißig Häfen pro Strecke. Als Postschiffe waren sie einst die wichtigste Verbindung der norwegischen Küstenorte zur Welt. Das hat sich inzwischen geändert, doch noch immer nutzen die Norweger die Schiffe als Bus von Station zu Station. Dann gibt es die Touristen, die eine ganze Rundreise mitmachen. Sie führt in Fjorde und durch Sunde, vorbei an einer oft dramatischen Landschaft, die ihresgleichen sucht. Die Filmautorin Ute Werner ist sieben Tage lang auf der MS „Midnatsol“ die nordgehende Tour gefahren und war im Juni zur Zeit der Mitternachtssonne unterwegs. (Text: hr-fernsehen)Mit Lippenstift und Lasso – Cowgirls im australischen Outback
Eine neue Zeit bricht im Outback an – die Zeit der Jillaroos, der Cowgirls. Die Reportage begleitet eine Farmerfamilie und deren Töchter durch Wochen voller Arbeit. Australiens Rinderfarmer stehen vor einem Problem: Ihnen laufen reihenweise Cowboys weg. Die Männer satteln um und arbeiten lieber als Kumpel im Bergbau – für besseres Geld. Statt harter Kerle treiben nun immer mehr junge Frauen die riesigen Viehherden kilometerweit durch das Outback. Sie reparieren Zäune, reiten Pferde zu und verkaufen die Herden auf Viehauktionen.Eine neue Zeit bricht im Outback an – die Zeit der Jillaroos, der Cowgirls. In der Reportage werden eine Farmerfamilie und deren Töchter durch Wochen voller Arbeit und großer Entscheidungen begleitet. Die 19-jährige Flicky arbeitet auf der Farm ihrer Eltern als Jillaroo. Zusammen mit ihrer Schwester Emma Jane muss sie in harten Zeiten mit anpacken. Denn es gibt keine Cowboys mehr, seit die Bergbauminen im ganzen Land mit lukrativen Jobs locken. Es müssen ohnehin schon fast alle Rinderfarmer im Outback um ihre Existenz kämpfen. Eine fünfjährige Dürre zwang sie, hohe Kredite zum Kauf von Futter aufzunehmen, die sie durch die fallenden Fleischpreise nicht zurückzahlen können. Dazu kommt, dass wochenlange Regenfälle auf dem ausgetrockneten Land zu Überschwemmungen geführt haben – ein Problem löst das andere ab. Doch die Farmer lieben ihre Tiere und ihren Beruf. Aufgeben, um einen Job in der Stadt anzunehmen, ist nur die allerletzte Option. Zum Glück vieler Farmer gibt es neuerdings junge Frauen wie Flicky, die die harte Farmarbeit nicht scheuen. Die Mädchen kommen oft mit verklärten Ansichten in die Wildnis. Sie träumen von romantischen Abenden am Lagerfeuer und Ausritten bei Sonnenuntergang. Doch die Realität aus Arbeit, Einsamkeit und Abgeschiedenheit sieht anders aus. Im Outback funktioniert kein Fernsehen und kein Mobiltelefon. Die nächste Stadt ist oft eine Tagesreise entfernt. Freunde treffen oder sich verlieben klappt hier nicht ohne weiteres. Und dennoch wächst die Zahl der Jillaroos. (Text: rbb) Mit Rentiernomaden über den Ural
Ein Porträt der Komi in Russland mit ihren Rentierherden Komi ist die Eigenbezeichnung mehrerer Bevölkerungsgruppen in Russland, die zu den finno-ugrischen Völkern gehören. Den Sommer in der Taiga verbringen die Komi in den Bergen, nach dem ersten Schnee ziehen sie dann über den Ural in die weiter unten gelegenen Wälder, denn dort gibt es Nahrung für ihre Rentierherden. Eine Strecke bedeutet 400 Kilometer unter sehr harten Bedingungen für Mensch und Tier. Früher waren die Komi-Nomaden beim Staat angestellt, heute gehört ihnen ein Drittel der Herde, der andere Teil ist in kommunalem Besitz. Im Film werden die Familien von Vassili und Alexej während ihres Aufenthalts und bei den Arbeiten auf ihrer Sommerweide im europäischen Teil des Urals vorgestellt. Mühsam ist der 400 Kilometer lange Weg für Tiere und Menschen zu dem Ort, der ihnen im Winter Heimat bietet. (Text: BR Fernsehen)Mit Volldampf durch die Karpaten – Die letzte Waldbahn Europas
In den rumänischen Karpaten gibt es die letzte Dampflok-betriebene Waldbahn Europas. Seit über siebzig Jahren schnauft dieses Relikt vergangener Zeiten fast täglich über ausgefahrene Gleise und mit mindestens einer Reparatur pro Fahrt durch das sogenannte Wassertal in der Nähe der Ortschaft Oberwischau. Die großen noch intakten Waldgebiete der Karpaten und die Schafzucht sind die Existenzgrundlage der hier lebenden Menschen, darunter auch noch etliche Deutschstämmige. Die Schmalspurbahn transportiert Holzfäller hinauf in die tiefen Wälder der Maramures und pro Fahrt rund 200 Tonnen Holz zurück ins Tal.Obwohl die Waldbahn in ihrer Existenz bedroht ist, durch Überschwemmungen wie auch durch die ökonomische Schwäche der Region, hat der junge Feuermacher Gheorghe Andreica nur einen Traum: Er will Lokführer der Waldbahn werden. Die Reportage führt uns in eine Welt, in der die Zeit stehen geblieben ist. Sonntags in der Kirche gibt es regelmäßig noch Teufelsaustreibungen und der Schnaps, den die Holzfäller und die Schäfer trinken, hat mindestens 50 % und ist selbstverständlich selbstgebrannt. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere So. 20.02.2005 Südwest Fernsehen von Titus FaschinaMohenjo Daro – Das Geheimnis der Induskultur
In den 1920er-Jahren wird im Ufergebiet des Indus eine Metropole aus dem dritten Jahrtausend vor Christus entdeckt: Mohenjo Daro, das Zentrum einer Zivilisation, die Ägypten und den Städten Mesopotamiens gleichrangig war. An die 100.000 Einwohner zählte die Stadt, die auf künstlichen Plateaus mit breiten Alleen wie am Reißbrett entworfen erbaut wurde. Michael Jansen, Professor für Stadtbaugeschichte an der RWTH Aachen, erforscht Mohenjo Daro seit 30 Jahren. Er führt in der Dokumentation von Hannes Schuler durch die Geheimnisse der antiken Stadt. Die ungewöhnliche Bauweise von Mohenjo Daro – sie besteht aus Millionen einheitlicher Ziegel – hat schon ihre Entdecker in den 1920er-Jahren fasziniert.Wohnhäuser mit moderner Raumaufteilung und jeweils eigenen, nicht öffentlichen Brunnen, Straßen mit Abwasser-Kanalisation und wie nach einem Bebauungsplan getrennte Produktions- und Wohnviertel. Michael Jansens Vermutung: Mohenjo Daro ist das Ergebnis eines Schwellenereignisses der Menschheit, eines einzigartigen zivilisatorischen Sprungs. Innerhalb von nur 50 Jahren explodierte am Indus der Fortschritt auf geradezu allen Gebieten, eine Schrift wurde erfunden, Großsiedlungen entstanden, die ihre Produktionsstätten auslagerten und Handel über Tausende von Kilometern trieben. Aber wer waren die Lenker dieses Umbruchs, wer waren die Herrscher von Mohenjo Daro? Wenig ist bekannt über sie, die raren Hinweise wie etwa die Kleinplastik des sogenannten „Priesterkönigs“ geben Rätsel auf, die Schriftzeichen, die auf Siegeln entdeckt wurden, sind noch nicht entziffert, erst zehn Prozent der Stadt sind ausgegraben, die Erforschung der Indus-Zivilisation steht noch immer fast am Anfang. Ebenso rätselhaft ist der Untergang der Metropole vor 4.000 Jahren. Ohne Zeichen von Zerstörung, Krieg oder Vertreibung gaben die Bewohner die Stadt auf, die bald unter dem Schwemmland des Indus’ verschwand. (Text: ARD-alpha) Moldawien – ein vergessenes Land
Moldawien, ein vergessenes Land: Wer weiß schon, dass die kleine, seit 1991 unabhängige Republik zwischen Rumänien und der Ukraine liegt? Wer weiß schon, dass die meisten Moldauer rumänischstämmig sind, rumänisch sprechen und von einer Wiedervereinigung mit Rumänien dennoch nichts wissen wollen? Wer weiß, dass Moldawien zu den größten Weinproduzenten der Welt gehört? Wer weiß schon, dass einhunderttausend Kolonisten aus Süddeutschland bis 1940 im damaligen Bessarabien friedlich neben Moldauern, Ukrainern, Russen, Polen, Juden, Gagausen und Bulgaren lebten? Moldawien, ein vergessenes Land: Einen Reiseführer über Moldawien sucht man bis heute vergeblich.Moldawien, auch Moldau genannt, gehörte einst zu den reichsten Republiken der Sowjetunion. Inzwischen ist es das ärmste Land Europas, ärmer als Vietnam, Senegal und Papua-Neuguinea. Heizöl kann sich kaum jemand leisten, und Benzin schon gar nicht. Das Pferd gehört wieder zum Dorfbild. Die Schönheit Moldawiens erschließt sich nicht auf den ersten Blick. „Landschaft“ ist hier gleichbedeutend mit „Landwirtschaft“. Das hügelige Land mit seiner berühmten Schwarzerde ist sehr fruchtbar. 63 Prozent der Fläche Moldawiens stehen unter dem Pflug. Das ist Rekord. Doch, Ironie des Schicksals: das „reiche“ Land bringt seinen Wein, sein Getreide, sein Gemüse und sein Obst auf dem Weltmarkt nicht los. Schnittpunkt zwischen Asien und Europa: Das fruchtbare Land war schon immer ein Zankapfel. Seit der Altsteinzeit lebten hier hundert Kulturen und Völker. Doch keiner Kultur ist es bisher gelungen, langfristig sesshaft zu werden. Die zahlreichen Felsenklöster, die liebevoll restaurierten Kirchen oder der von den Römern errichtete Trajan-Wall erzählen aus dieser Geschichte. Im Süden Moldawiens erstreckt sich Bessarabien, ein verheißungsvoller Name, der einst an die zehntausend Schwaben ins Land lockte. 66 Hektar Land stellte das russische Zarenreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts jedem Siedler zur Verfügung. Bald erzielte das kleine Bessarabien ein höheres Bruttosozialprodukt als Württemberg und Baden zusammen. 1940 verordnete Nazideutschland den Kolonisten die „Heimkehr ins Reich“. Umso mehr überrascht es, dass in dem kleinen Dorf Soviewka noch immer eine deutsche Frau lebt. (Text: hr-fernsehen) Monaco – Geschlossene Gesellschaft
Auf nicht einmal zwei Quadratkilometern leben in Monaco über 32.000 Menschen: ein Traumziel für Touristen und Wirtschaftsflüchtlinge aus aller Welt und ein Symbol für Luxus, Mode und Wohlstand. Arbeitslosigkeit ist in dem Zwergenstaat unbekannt, das Wirtschaftswachstum liegt bei über zehn Prozent. Das kosmopolitische Fürstentum ist ein Ort der Erholung und des Spiels. Der schillernde Kleinstaat wird von Fürst Albert II. straff wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt. Der Grimaldi-Fürst setzt auf Hightech, Industrieansiedlung und gehobenes Entertainment. Er will endlich weg vom Image des halbseidenen Steuerparadieses. Der Erfolg gibt dem neuen Fürsten Recht, und seine 7.000 Untertanen danken es ihm mit Treue und Verehrung.35.000 handverlesene Dauergäste leben mit Genehmigung des Fürsten in Monaco und sind im Besitz eines Passes. Sie genießen den verschwiegenen Freiraum, der ihnen hier geboten wird. Eine allgegenwärtige Polizei und Hunderte von Überwachungskameras schützen die betuchten Gäste und lassen Monaco für Außenstehende wie einen Hochsicherheitstrakt erscheinen. Aber niemanden im Kleinstaat stört das – im Gegenteil: Einheimische und Gäste sind froh über die Sicherheit auf den Straßen. Sie alle lieben ihren Fürsten und den Erfolg, den er ihnen sichert. (Text: rbb) Mongolei – Bei den Rentiernomaden
Vor etwa 3.000 Jahren zähmten die Samoyeden das Rentier im hohen Norden der Mongolei. Ihre Nachfahren, die Tsaatan-Nomaden, leben noch heute vom Rentier. Sie halten es als Reit- und Packtier, trinken seine Milch, verwenden seine Haut zum Bau ihrer Zelte und erhalten durch den Verkauf von Geweihen das wenige Geld, das sie zum Leben brauchen. In ihrer Lebensweise richten sie sich ganz nach dem Instinkt des Herdentieres. Es bestimmt ihre Jahreszeiten, es bestimmt, wo sie ihre Zelte aufschlagen; es stellt ihre alleinige Lebensgrundlage dar. Umso härter trifft es den Stamm, wenn einige ihrer Tiere sich losreißen, um sich wild lebenden Herden anzuschließen. Diese Ausreißer wieder einzufangen, ist eine sehr schwierige, zeit- und kräftezehrende Aufgabe, die die Tsaatan nur mit Hilfe von Lasso und Skiern, mit denen sie sich in der tief verschneiten Waldlandschaft besser fortbewegen können, bewältigen müssen.So ergeht es auch Galzan, der sich mit seinen 18 Jahren bei der Suche nach einem ausgerissenen Rentierbullen als guter Hirte beweisen muss. Nebenbei muss er sich auch als Bräutigam auf den Prüfstand stellen lassen. Denn von seinem Jagderfolg und dem Sieg über den Ausreißer-Bullen hängt ab, ob sein Heiratsantrag an die 17-jährige Solongo die Zustimmung von deren Eltern finden wird. Der Film begleitet den jungen Mann und gibt anhand der Herausforderungen, denen er sich stellen muss, Einblick in die archaische und faszinierende Lebenswelt der Nomaden des Nordens. (Text: SWR) Die Mongolei – Im Land der Nomaden
45 Min.Schier unendliche Weiten und so dünn besiedelt wie kaum ein anderes Land der Welt: die Mongolei. Durchschnittlich nur zwei Einwohner leben hier pro Quadratkilometer. Und mehr als eine Million Menschen sind nach wie vor Nomaden und ziehen mit ihren Tieren durch das Land. Die Dokumentation begleitet eine Nomadenfamilie in ihrem harten, aber harmonischen Alltag, ist dabei, wenn ein Teenager in der Hauptstadt Ulaanbaatar versucht, den Kehlkopfgesang zu lernen, und geht mit Motorrad-Rangern rund um den riesigen Chöwsgöl-See auf Patrouille. Außerdem sind die Filmemacher dabei, wenn eine Edeljurte entsteht.Die hätte bestimmt auch Dschingis Khan gefallen. Orkhoo Lkhagva ist im siebten Monat schwanger und muss dennoch die 60 Kamele der Familie in einen Pferch bugsieren. Im Frühjahr treiben alle Nomaden ihre Tiere zusammen, um zu kontrollieren, wie sie den Winter überstanden haben. Orkhoo und ihr Mann führen ein Leben wie ihre Vorfahren. Eine uralte Spezialität ist Öröm, eine Rahmschicht, die direkt aus dem Topf genascht wird. Im äußersten Norden des Landes liegt der Chöwsgöl-See, das größte Süßwasservorkommen der Mongolei, und als Nationalpark geschützt. Baterdene Zayabayar und ihr Kollege Tumursukh Munkthenger sind die Umweltinspektoren des Parks. Sie müssen raus auf den See, denn immer wieder gibt es Meldungen über illegale Fischer in der Schutzzone. Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei, ist das pulsierende Zentrum des Landes – geprägt von alter Kultur und lebendiger Aufbruchstimmung. In einem Apartmentblock lebt der 15-jährige Chinguun Batbold. Er trifft sich fast jeden Tag mit seinen Freunden auf dem Basketballplatz. Die größten Idole des 15-Jährigen sind Musiker aus dem eigenen Land. Deshalb nimmt Chinguun seit ein paar Jahren auch Privatunterricht in den Fächern Pferdekopfgeige und Kehlkopfgesang. Im äußersten Randbezirk von Ulaanbaatar entstand vor ein paar Jahren eine kleine Firma, die schnell im ganzen Land bekannt wurde: ein Handwerksbetrieb, der Jurten nach altem Vorbild herstellt. Otgonbaatar ist Gründer, Geschäftsinhaber – und studierter Holzbildhauer. Seine Kundschaft ist bereit, bis zu 60.000 Euro für eine voll ausgestattete Variante zu zahlen. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 22.01.2026 NDR Die Mongolischen Steppenreiter – Bericht aus einem Königreich der Pferde
Monlam – Tibetisches Neujahrsfest im Kloster Labrang
Deutsche TV-Premiere Mi. 13.01.1999 Südwest Fernsehen von Edy KleinMontenegro – Von den Schwarzen Bergen zum Meer
45 Min.Der Skutarisee ist ein bedrohtes Paradies für Wasservögel.Bild: NDR/elbmotion picturesDas Balkanland Montenegro verdankt seinen Namen den schwarzen Bergen. Dabei findet sich dort noch viel mehr: steile Felsen, tiefe Schluchten, malerische Seen, orthodoxe Klöster, venezianische Baukunst, dazu Sandstrände und sogar Fjorde wie in Norwegen. Ganze drei Klimazonen durchziehen das Adrialand, das gerade einmal so groß ist wie Schleswig-Holstein. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen noch immer ihren Weg zwischen den Herausforderungen eines postsozialistischen Systems, der viel gerühmten Balkangelassenheit und den Chancen eines noch weithin unentdeckten Reisezieles in Europa finden.Montenegro ist ein noch sehr junges Land und hat doch eine jahrhundertealte Geschichte. Nach wechselhaften Zeiten war Montenegro eine Teilrepublik Jugoslawiens. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie zunächst Bestandteil des Rumpfstaates Serbien-Montenegro, bevor die Bürgerinnen und Bürger 2006 für die Unabhängigkeit Montenegros stimmten. NDR Autor Torben Schmidt beginnt seine Reise im Nachtzug an der Grenze zu Serbien. In Bijelo Polje, einer Kleinstadt mit sozialistischem Charme, begleitet er zwei Zugpolizisten auf ihrem Weg durch die Berge bis ans Meer. Die Strecke durch das Dinarische Gebirge, über Serpentinen und Brücken bis in die Küstenstadt Bar, gilt als die schönste Bahnstrecke des Balkans. Als sogenannte Tito-Bahn war sie der Stolz jugoslawischer Eisenbahnarchitektur. Jenseits der Bahnstrecke stellt der Film einen passionierten Bergsteiger vor, der als erster Montenegriner auch einen Achttausender bestiegen hat, die schwarzen Berge dennoch für die schönsten der Welt erklärt. Im Felsenkloster Ostrog, zu Zeiten der osmanischen Bedrohung ein Zufluchtsort der Einheimischen, trifft der Autor eine junge Pilgerin. Und auf dem Skutarisee einen Ornithologen, der sich dem Schutz der Pelikane verschrieben hat. An der Küste schließlich, wo bescheidene alte Fischerboote in Sichtweite von Superjachten dümpeln und der Bauboom schillernde Casinos in die Natur stellte, wird der Gegensatz zwischen Armut und neuem Reichtum deutlich. Am Ende geben Feuerwehrleute und ein Wasserballtrainer Einblicke in ihren kuriosen Alltag. Zum einen, weil Lösch- und Rettungsfahrzeuge in denkmalgeschützten Hafengassen gelegentlich nur rückwärts durchkommen. Und zum anderen, weil ausgerechnet den an der Weltspitze mitspielenden Wassersportlern noch immer eine Schwimmhalle fehlt. (Text: NDR) Mont St. Michel
Auguste Poisny hat für den weltberühmten Ort wenig übrig. ?Ich sehe ihn ja täglich,“ brummt der 68-Jährige, der in den Marschwiesen vor dem Mont Saint-Michel Schafe hütet und das seit über 50 Jahren. Phillipe Luizard dagegen besucht den „Mont“ jeden Tag. Trotz seiner 80 Jahre, trotz seiner Gehbehinderung. Für ihn hat der kleine Granitfelsen 2 km vor der französischen Atlantikküste magische Anziehungskräfte. Schon im Mittelalter war das Kloster über dem kleinen Dorf eine Attraktion ersten Ranges – zehn große Pilgerwege führten hierhin, Tausende wanderten wochenlang bis sie die Insel sahen, von weitem schon.So ist es noch heute – mit einem Mal taucht es auf, majestätisch – mythisch: Weltkulturerbe, französisches Nationaldenkmal – und ganz nebenbei auch die Kommune Mont Saint-Michel. Ein französisches Dorf mit einem Gendarmen, einer Post, einer Feuerwehr – aber ohne Schule und ohne Lebensmittelladen. 151 stimmberechtigte Bürger gibt es, aber auf der Insel ist kaum jemand von ihnen anzutreffen. Dafür Touristen, die sich die kleine ?Grande Rue“ hinaufschieben, Richtung Abtei. Dem Ansturm der Besucher stehen einige gegenüber, die hier die Mitte ihres Lebens gefunden haben. Wie die 90-jährige Madame Lebrec, die auf dem Mont ein Ferienhaus hat, das aus dem 14. Jahrhundert stammt. Oder wie der ehemalige Zisterzienser-Mönch François Lancelot, der so gerne ein Grabstelle auf dem Inselfriedhof finden würde: ?Selbst im Tod hätte ich dann noch das Vergnügen, hier zu sein.“ Eine Insel zwischen Tourismus und Tradition, zwischen Kultur und Kommerz, ein Ort, der eine eigenartige Faszination ausübt: Mont Saint-Michel, der heilige Berg im Atlantik. (Text: BR Fernsehen) Moskau
Bislang war Russland nur mit der legendären Transsibirischen Eisenbahn vollständig zu durchqueren. Doch jetzt wurde nach 25 Jahren Bauzeit in Fernost das letzte Teilstück eines großen Straßenprojekts vollendet. Länder-Menschen-Abenteuer macht sich auf genau diesen Weg, um mit dem Auto die neue Strecke zu entdecken, Geschichten von Menschen rechts und links des Weges zu erzählen. Moskau ist der Ausgangspunkt einer Reise, die 10.000 Kilometer durch das riesige Land führt, durch Sibirien bis an den Pazifischen Ozean, nach Wladiwostok. (Text: WDR)von Eric Friedler und Natalia KasperovichMoskau, Jalta, Kiew – Eine Zugreise
Moskau, Bahnhof Pawelezkaja – hier beginnt die Abenteuerreise mit dem Zug durch drei Länder mit spannenden Begegnungen. Drei Wochen dauert sie und die Bahnstrecke verläuft über 6.500 Kilometer. Die Fahrt führt über Saratow an der Wolga und Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad, nach Sotschi am Schwarzen Meer, dem Badeort der Schönen und Reichen Russlands. In Jalta auf der Krim verrät ein Winzer Geheimnisse der Kultivierung eines exzellenten Rotweins. Durch Moldavien, dem Armenhaus Europas, geht es weiter in die Ukraine, wo die Reise wenige Wochen vor der friedlichen Revolution in Kiew endet. (Text: NDR)Moskau lässt die Puppen tanzen – Konsumrausch in der russischen Hauptstadt
Nirgendwo sonst gibt es mehr Milliardäre als in Moskau, nirgends wird Reichtum provokanter zur Schau gestellt. Hier gibt es Mädels und Mittelstreckenraketen, Klunker und Kaviar, wenige lupenreine Demokraten, aber viele lupenreine Karat: Moskau vergisst 70 „graue“ Jahre seiner Geschichte, will alles, und zwar sofort. Graues Häusermeer, Servicewüste – das war gestern. Heute kann man in Moskau um drei Uhr morgens einkaufen, um vier Uhr dinieren, sich um fünf Uhr die Haare schneiden lassen. Jeder hat eine Idee, wie sich irgendwie Geld verdienen lässt.Nicht nur Bonzen schwelgen im Konsumrausch. Auch Durchschnittsverdiener haben Einkaufen als Hobby entdeckt. Unteroffiziere der russischen Armee verdienen sich als Wachleute ein Zubrot in bzw. vor edlen Einkaufspassagen, Nachtklubs oder auf wilden Partys. Im Mutterland der Emanzipation, der Kosmonautinnen und Ingenieurinnen, Chefärztinnen und Bauarbeiterinnen sind Frauen wieder Schmuckstücke: Jung und langbeinig schmücken sie kleine, ältere, reiche Männer, die, befragt, womit sie ihr Geld verdienen, nur lakonisch antworten: „Business!“ Sie leben schwer bewacht hinter hohen Zäunen: die Businessmen, die Superreichen. Und sie genießen das Leben mit einer Mischung aus Größenwahn und Gier, leben, als sei Sparen eine Schande. Wer da nicht mithalten kann, ist auf Mitleid angewiesen. Babuschkas trifft es vor allem. Sie kämpfen in einer der teuersten Städte der Welt ums Überleben. Das GUM, früher das staatliche Universal-Kaufhaus, ist heute eine hippe Einkaufspassage: Früher bekam man dort aus dem Textilkombinat „Die Bolschewikin“ graue Sackkleider in Übergrößen, Filzstiefel sowie Süßigkeiten der Schokoladenfabrik „Roter Oktober“. Inzwischen schweben Moskauerinnen auf atemberaubenden Absätzen durch die Stadt, es haben sich hier Gucci und Pucci, Schweizer Uhrenfirmen und amerikanische Nobelmarken einquartiert. Dabei wissen Moskowiter aber: Der Zar ist nicht weit, und dem darf man nicht in die Suppe spucken. Wer Geschäfte machen will, muss sich aus der Politik heraushalten. (Text: rbb) Murano
Murano ist eine Insel, die seit über 700 Jahren von der Glasherstellung geprägt wird. Ein Stück Land,14 Quadratkilometer groß, in der Lagune von Venedig. Im 13. Jahrhundert haben die Venezianer die Glasbläser auf die Nachbarinsel ausgelagert, weil es in deren Werkstätten zu oft brannte und sie ein Übergreifen des Feuers auf ihre Palazzi befürchteten. Die Glasmacher waren angesehene Leute in Venedig. Es war ihnen sogar erlaubt in die vornehmsten Familien einzuheiraten. Aber sie mussten mit der Todesstrafe rechnen, so erzählt man sich, wollten sie die Insel jemals wieder verlassen. So gelang es Venedig über Jahrhunderte das Monopol für die Glasmacherei zu behalten und Venedigs Kaufleute beherrschten den ganzen Mittelmeerraum.Der Kitsch, der den Touristen als Souvenirs angeboten wird, stammt meistens aus Ländern, wo Glas als Massenware billig produziert wird und hat wenig zu tun, mit ,,echtem“ Muranoglas, das in einer der 60 Glasbläsereien der Insel aufwendig angefertigt wird. Kostbare Gläser, exklusive Vasen und Lampen, riesige Lüster, die in Hotelhallen und Opernhäusern hängen. Glas ist ein Luxusartikel und so ist die kleine Insel seit Jahrhunderten abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in der ganzen Welt. (Text: BR Fernsehen) Die Muschel-Piraten – Kampf in der Lagune von Venedig
Venedig ist die Grande Signora der Adria. Doch über das seichte Wasser der Lagune hinweg, versteckt auf einer Insel im Süden, liegt seit Jahrhunderten ein zweites Venedig – ein kleines, unbekanntes. Eines ohne Gepränge und Touristenströme, ein Aschenputtel im Schatten der Signora: Chioggia. „Wasservolk“ nennen sich stolz die Chioggiotti. Jeder, der von jenseits der 850 Meter langen Altstadt kommt – sei er aus Rom oder New York -, gilt hier als Hinterwäldler. Jahrhundertelang war Chioggia vom Festland abgeschnitten: Von 53 000 Einwohnern tragen heute noch zwei Drittel dieselben wenigen Nachnamen.Der abgeschiedene Mikrokosmos hat bizarre Eigenheiten ausgebrütet – Spielsucht etwa, die von der Gesundheitsbehörde offiziell zum kollektiven Syndrom erklärt wurde. So wie ihre Vorfahren, die auf dem Wasser jeden Tag das Schicksal herausforderten, sitzen heute Hunderte Chioggiotti, Frauen vor allem, schon am frühen Morgen in den unzähligen Bars der Stadt beim illegalen Lotto, Kartenspiel oder Video-Poker und lassen sich dabei von Hellsehern beraten. Als „das Neapel des Nordens“ gilt in Italien diese Stadt, die immer noch im Aberglauben verharrt. (Text: BR Fernsehen) Deutsche TV-Premiere So. 18.12.2005 Südwest Fernsehen von Carmen ButtaDie Mutter der Bonobos – Schutz einer gefährdeten Affenart
Nur in der Republik Kongo leben die Bonobos – eine Affenart, die dem Menschen genetisch ähnlicher ist als jedes andere Tier der Erde. In dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Land sind die Bonobos jedoch eine begehrte Beute – geräuchert wird ihr Fleisch auf den Märkten des Landes verkauft, während die Jungtiere den Wilderern lebendig am meisten Geld einbringen. Vor zwölf Jahren hat Claudine André das „Lola ya Bonobo“, das „Paradies der Bonobos“, gegründet. Hier kümmern sich die Belgierin und ihre Mitarbeiterinnen um verwaiste Bonobojunge, deren Eltern als Räucherfleisch auf den Märkten endeten.Claudine André erspart ihnen so ein Schicksal als Haustier, allein und eingezwängt in enge Käfige. Mittlerweile beheimatet das Reservat 45 Bonobos. Aber noch nie haben sich die Tierschützer über Nachwuchs freuen dürfen – sie bangen deshalb um die trächtige Etumbé. Die Reportage zeigt die erste Geburt eines Bonobo-Jungen in der Schutzstation und begleitet Claudine André bei ihrem Versuch, die gefährdeten Bonobos zu schützen und ihnen wieder ein Leben in freier Natur zu ermöglichen. (Text: hr-fernsehen) Mutter des Wassers – Der Menam in Thailand
Deutsche TV-Premiere Sa. 06.04.1985 S3 von H. Jürgen GrundmannMyanmar – Durch das Land der tausend Pagoden
Myanmar: Dort trifft man auf weite Ebenen, grüne Berge, Dschungel und immer wieder auf die märchenhafte Pracht der goldenen Pagoden. Robert Hetkämper und das ARD-Team des Studios Singapur waren mit dem Schiff „Pyi Gyi Ta Gon“ auf dem Irrawaddy unterwegs, zusammen mit über 330 anderen Passagieren und 52 Tonnen Fracht. Das Schiff befährt den oberen Lauf des Flusses nur in gemächlichem Tempo. Zwei Tage und eine Nacht dauert die knapp 450 Kilometer lange Flussfahrt von Bhamo nach Mandalay. Zeit, ein faszinierendes Land zu entdecken.Auf dem noch nicht regulierten Fluss, in dem es noch Delfine gibt, geht es vorbei an goldenen Pagoden und Bambushütten. An manchen Stellen ist der Irrawaddy kilometerbreit, an manchen windet er sich durch enge Schluchten. Es besteht ständig die Gefahr, dass das Schiff auf den stets wechselnden Sandbänken strandet. Auf den Decks lagern bepackte Händlerinnen, Mönche, ganze Familien, die auf dem Weg zu Verwandtenbesuchen sind. Auf der Brücke lenkt der Kapitän die schwierigen Anlegemanöver. Die „Pyi Gyi Ta Gon“ legt häufig Zwischenstopps ein. Für manche Dörfer ist der Fluss die einzige Verkehrsanbindung. Die Fahrt mit dem Passagierschiff auf dem Irrawaddy endet in Mandalay. Von hier aus wechselt das ARD-Team auf ein kleines lokales Boot. Der Kontakt zu den freundlichen Menschen ist nah. In Myanmar beherrscht die Kraft der Religion noch den Alltag. In einem Tempel der alten Königsstadt Mandalay wird Korrespondent Robert Hetkämper eine drei Meter lange Python um den Hals gelegt. Die Menschen glauben von der Schlange, dass sie alle Wünsche erfüllen kann. Ein blühender Geschäftszweig in Mandalay ist die massenhafte Produktion von Buddha-Statuen aus Marmor. In Vollmondnächten zünden Gläubige Abertausende von Kerzen an, um den Buddha zu ehren. In der alten Hauptstadt Sagaing besucht das Team eine Klosterschule mit Hunderten von Kindern in Mönchsroben. Die legen sie auch beim Fußballspielen nicht ab. Diese Flussreise endet im berühmten Bagan mit einer romantischen Ballonfahrt über die vielen Tausend Pagoden und Tempel. (Text: NDR) Myanmar – Eine Reise durch mein Land
- Alternativtitel: Myanmar - Eine Reise in meinem Land
Eine junge, in den USA lebende Burmesin besucht ihr Heimatland. Sie versucht herauszufinden, wohin das heutige Myanmar treiben wird. Khine Khine, eine junge, in den USA aufgewachsene Burmesin, bereist ihr im Umbruch befindliches Heimatland. Auf ihrer Reise sieht Khine Khine Orte, deren Armut und Vernachlässigung deprimierend sind. Ein Kulturerbe, mit dem der burmesische Aufbruch nichts anzufangen weiß; Pagoden, Tempel und religiöse Prachtbauten, die dem Verfall preisgegeben sind. Khine Khine möchte Mrauk U, das Zentrum des einstigen Königreichs Arakan, aufsuchen, eine „Goldene Stadt“, die einst einen Teil Bengalens und das westliche Niederbirma regierte.Heute bildet das untergegangene Reich die Provinz Rakhine, die in den Medien immer dann auftaucht, wenn es um Konflikte mit den in Myanmar lebenden Muslimen geht. Deren Vorfahren kamen als Zwangsarbeiter ins Land; die Könige von Arakan brauchten sie, um ihre riesige Kriegsflotte aufrechtzuerhalten. Von der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit wurden die Zuwanderer nie anerkannt; auch nach vier Jahrhunderten sind sie nicht integriert. Neuerdings kommt es zu brutalen Übergriffen; mehrfach wurden ganze Dörfer niedergebrannt. Doch Myanmar, das Land, an dem seit der Öffnung so viele Hoffnungen hängen, verdrängt seine gesellschaftlichen und ethischen Konflikte. Die Reisedokumentation von Roman Teufel übernimmt die Erzählperspektive der jungen, aus den USA in ihr Land zurückgekehrten Burmesin – mit einem Kommentar im Stil eines tagebuchartigen inneren Monologs. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail