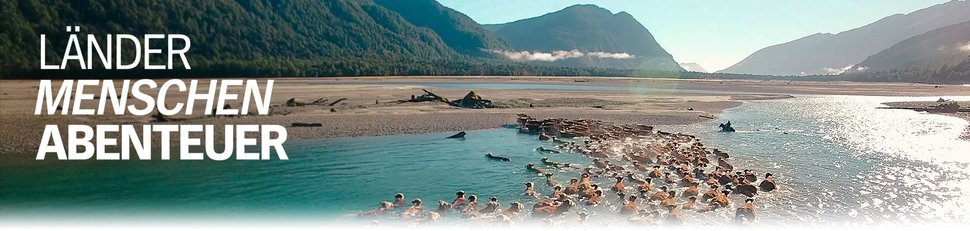1783 Folgen erfasst, Seite 32
Der Kaiser-Kanal in China
Der Kaiserkanal in China ist mit seinen 1.800 Kilometern die längste künstliche Wasserstraße der Welt. Er ist 2.500 Jahre alt und bis heute größtenteils in Betrieb. Der Da Yunhe, Großer Transportfluss, wie die Chinesen ihn nennen, passiert von Hangzhou nach Peking 30 Städte mit mehr als drei Millionen Einwohnern. Der Kanal transportiert seit Jahrhunderten Waren und Kultur quer durch Ostchina. Er ist mit seinen 1.800 Kilometern die längste künstliche Wasserstraße der Welt, 2.500 Jahre alt und bis heute in Betrieb – der Kaiserkanal in China. Er verbindet Peking mit dem Gelben Fluss und der fruchtbaren Jangtse-Mündung.Neben der Chinesischen Mauer gilt er als bedeutendstes Bauwerk des alten China. In seinem Wasser spiegeln sich die wechselvolle Geschichte der Kaiserdynastien und der dramatische Wandel des heutigen China. Der Da Yunhe, Großer Transportfluss, wie die Chinesen ihn nennen, passiert 30 Städte mit mehr als drei Millionen Bewohnern. Er führt mitten durch das boomende Ostchina. Das Filmteam folgt dem ältesten Kanal der Welt: von der Stadt Hangzhou, dem „Venedig des Ostens“ bis nach Peking in die „Verbotene Stadt“, wo der Kaiserkanal endet. Das Filmteam fährt auf Reisbarken, Schleppern und Kohlekonvois, trifft Seidenraupenzüchter, stoppt in Reishäfen und alten „Wasserstädten“, quert den mächtigen Jangtse, passiert Tempel und Pagoden am Kanalufer, begegnet Fischern, die noch mit gezähmten Kormoranen fischen. Abends wird eine volkstümliche Oper auf einem Bootsdeck gegeben. Auf einem Ziegelfrachter trifft die Fernsehcrew eine italienische Denkmalschutzexpertin, die im Behördenauftrag reist. China will bei der UNESCO beantragen, den Kaiserkanal zum Weltkulturerbe zu ernennen. Ob die betriebsame Wasserstraße die strengen Auflagen der UNESCO erfüllt, soll die Wissenschaftlerin prüfen. (Text: BR Fernsehen) Der Kaiserkanal – Leben an einer Wasserstraße in China
Deutsche TV-Premiere Sa. 01.12.1984 S3 von Gisela MahlmannKaliforniens Traumküste – Leben in Big Sur
Sinnsucher, Hippies, Abenteurer, Naturfreunde und Touristen – seit Generationen pilgern sie nach Big Sur an der kalifornischen Küste. Autor Sven Jaax hat sich dort umgesehen und hat dabei Einblicke in das Leben der Menschen vor Ort gewonnen. Die schroffe, dünn besiedelte Region Big Sur liegt an Kaliforniens Küste, südlich von San Francisco. Seit Generationen pilgern Sinnsucher, Hippies, Abenteurer, Naturfreunde und Touristen hierher. Autor Sven Jaax hat sich dort umgesehen und die Menschen getroffen, die mit der Schönheit des Landes ebenso leben wie mit den Schwierigkeiten.In Big Sur, dem „Große Süden“, lebt zum Beispiel Blake Forrest: Ökolandwirt, Bauunternehmer, moderner Hippie und Hofbesitzer mit Fernsicht. Von seinem selbst gebauten Haus aus hat er einen der schönsten Ausblicke auf den Pazifik. Aber wenn er nicht aufpasst, holen ihm nachts Luchse oder Berglöwen seine Hühner aus dem Stall. Blakes Lebensgefährtin Michelle Magdalena Maddox geht einer typischen Big-Sur-Leidenschaft nach. Sie fotografiert. Und was in anderen Ecken Amerikas als unmoralisch gilt, ist in Big Sur völlig normal: Sie arbeitet mit Aktmodellen. Der Elektriker Allan Bubar klappert mit seinem verrosteten Pick-up seine Kunden ab. Gut gelaunt kümmert er sich auch um exzentrische Aufträge. Das sind zum Beispiel durchgesägte Container, die als Luxushütten weiterverkauft werden. Sean Tucker zählt zu den besten Flugakrobaten der Welt und liebt es, zum Training an der kalifornischen Küste entlang zu fliegen. Das Kamerateam durfte mit an Bord. Don Nix ist der Baumchirurg von Big Sur. Er klettert in die höchsten Bäume der Welt, in die Küstenmammutbäume. Wenn die hölzernen Riesen altersschwach werden, stutzt er sie zurecht, damit niemand von abfallenden Ästen verletzt wird. Jeder Baum ist eine neue Herausforderung. So harmonisch das alles klingt: Big Sur ist nicht frei von Problemen: Viele Einheimische mussten schon die Koffer packen, weil sie die Lebenshaltungskosten einfach nicht mehr bezahlen konnten. Die Superreichen aus Amerika, vor allem aus dem Silicon Valley, haben die Region für sich entdeckt und vertreiben mit der Macht des Geldes alteingesessene Familien. (Text: BR Fernsehen) Kalt, riskant und gut fürs Karma – Mit Hindu-Pilgern durch die Berge Kaschmirs
- Alternativtitel: Kalt, riskant und gut - Mit Pilgern in den Bergen
Mit Hindu-Pilgern durch die Berge Kaschmirs Im Sommer, wenn die Pfade halbwegs schneefrei sind, brechen sie auf: Bauern, Wanderasketen, smarte Yuppies aus Indiens Megastädten. Zu Tausenden pilgern sie durch grandioses Hochgebirge, schlafen in exponierten Zeltlagern, essen in provisorischen Hochgebirgs-Raststätten. Drei Tage dauert die Wallfahrt. Ihr Ziel ist eine einsame, 4000 m hoch gelegene Höhle. Dort hat einst Gott Shiva seiner Frau das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, so die Legende. Deshalb ist die Höhle den Hindus heilig. Steil schneidet der Pfad durch Bergflanken, durch Eis- und Geröllfelder.Der höchste Pass liegt 5000 Meter hoch. Höhe, Kälte, Steinschlag und die ungewohnte Anstrengung fordern ihren Preis. Letztes Jahr haben 67 Pilger die Wallfahrt nicht überlebt. Zudem führt der Weg durch ein gefährliches Krisengebiet. Um Kaschmir haben Indien und Pakistan zwei Kriege geführt. Im indischen Teil Kaschmirs leben mehrheitlich Muslime. Militante Gruppen richten Terror und Anschläge gegen Indiens Regierung und Armee im Kaschmirtal, aber auch gegen die Hindu-Pilger. Deshalb schützt Indien die Yatra mit einem massiven Aufgebot an Armee, Grenz- und Sondertruppen. 12.000 Soldaten säumen den Weg. Mit der Amarnath-Yatra zeigt Indien seinen Anspruch auf Kaschmir. Der Film begleitet vier Pilger. Premal, Abishek und Vijay sind 19, 23 und 31 Jahre alt. Mit ihrem Onkel Mukesh, 40, einem Börsenhändler, fahren sie von Bombay aus nach Kaschmir. Der Film zeigt Strapazen, Spaß und religiöses Verständnis der jungen Männer. Er zeigt ihre Furcht vor Unwetter und Terroranschlägen und thematisiert ihr Verhältnis zu den muslimischen Kaschmiri. Der Film zeigt auch den massiven Militärschutz der Yatra und welch immense Logistik nötig ist, die Pilgermassen im unwirtlichen Hochgebirge zu versorgen. (Text: Tagesschau24) Kambodschas großes Wasser – Unterwegs auf dem Tonle Sap
In der Regenzeit tritt Kambodschas Fluss, der Tonle Sap, über die Ufer und wird zu einem Binnenmeer, das ein Drittel der Fläche des Landes bedeckt. Für Tausende von Menschen bedeutet die Überschwemmung ein Leben „auf dem Wasser“: auf Schiffen oder in Pfahlbauten. Mensch und Tier passen sich den neuen Gegebenheiten an. In den Wipfeln, die gerade noch aus dem Wasser ragen, bauen Vögel ihre Nester und werden, solange die Erde überflutet ist, als Bestattungsplätze für die Toten eingerichtet. (Text: ARD-alpha)Kambodschas weibliches Gesicht
Filmemacher Pierre Combroux hat sich in Phnom Phen mit Frauen unterschiedlichster Herkunft getroffen und mit ihnen über Weiblichkeit und Schönheit gesprochen. Themen, die unter den Roten Khmer als dekadente Produkte des Klassenfeindes galten und gefährlich waren. Sogar der klassische Apsara-Tanz war verboten, die Tänzerinnen und Musiker des königlichen Balletts wurden in Arbeitslager gesteckt und fast alle ermordet. Dass alte Choreografien noch erhalten sind, ist allein der überlebenden Tänzerin Vong Metry zu verdanken.Der Filmautor besucht die Schule, die sie mithilfe von Spendengeldern gegründet hat, um Waisenkindern eine Ausbildung im klassischen kambodschanischen Tanz zu ermöglichen. Aus der jungen Szene von Phnom Phen trifft er die Performerin Belle Chumvan, die sich nach der neunjährigen klassischen Ausbildung von Break Dance und Michael Jackson beeinflussen ließ und eine erfolgreiche junge Truppe aufgebaut hat. Die Rapperin und Fassaden-Künstlerin Lisa Mam beschäftigt sich in ihren Songs und Bildern mit Weiblichkeit und Mutterschaft, denn für sie sind das die Säulen von „Frauen-Power“. Eine der großen Kino-Diven aus der Zeit vor der Diktatur erzählt von der blühenden Filmindustrie der 60er-Jahre, auch sie fiel dem Wüten des Terrorregimes zum Opfer. Ein traditionelles Handwerk der Khmer, ihre einzigartige Webtechnik, zeigt der Designer Eric Raisina, der die Stoffe der Kambodschanerinnen auf die Laufstege der internationalen Haute Couture brachte. Von jungen Barmädchen und Schülerinnen einer Hotelfachschule erfährt der Filmautor von den Bedingungen, unter denen die Landbevölkerung lebt, und wie schwer es für Jugendliche aus dem ländlichen Milieu ist, eine Schule abzuschließen und anschließend eine Ausbildung zu bekommen. Die Frauen und Mädchen, die sich in Pierre Combroux’ Film äußern, zeigen ein Land im Umbruch. Ein Land, dessen Bevölkerung im Durchschnitt 22 Jahre alt ist und das sich, um sein Trauma zu überwinden, neu definieren muss. Dabei sind es vor allem die Frauen, die mit tradierten Rollen brechen, um den Weg in eine bessere Zukunft zu bahnen. (Text: BR Fernsehen) Kampf dem Opium – Bei den Bergstämmen in Thailand
Deutsche TV-Premiere Sa. 21.05.1983 S3 von Edy Klein und Karl SchüttlerKampf um Amazonien (1): Razzia im Regenwald
José de Souza schlendert über einen Straßenmarkt in Rio de Janeiro. Vor ihm preisen die Händler ihre Waren an – Früchte, Haushaltsgegenstände oder Geflügel. Doch Souza hat etwas anderes im Visier: Er interessiert sich für die Waren, die versteckt unter den bunten Ständen auf ihre Käufer warten – Affen, Papageien oder Schlangen, die illegal in den Wäldern Brasiliens gefangen wurden und hier unter der Hand weiter verkauft werden. Auf diese Händler hat Souza es abgesehen, ihnen will er das Handwerk legen. José de Souza ist seit 25 Jahren Kontrolleur der Naturschutzbehörde Ibama im bergigen Hinterland von Rio de Janeiro. Gerade die Regenwälder des Amazonas sind besonders artenreich, ein begehrtes Jagdgebiet für Wilderer.Von ihren Booten aus entern die Kontrolleure Kanus und sogar größere Passagierschiffe, um nach gewilderten Tieren zu suchen – ein nicht ungefährliches Unterfangen, denn nicht immer geben die Wilddiebe ihre Beute freiwillig heraus. Zudem haben sie im Laufe der Jahre aufgerüstet. Kaum einer von ihnen ist heute noch ohne Waffe unterwegs, einige arbeiten im Auftrag größerer illegaler Organisationen. Gejagt wird alles, was Profit verspricht: etwa Jaguare, Kaimane, Schlangen und Affen. Für einen Ara aus der Wildnis Brasiliens zahlt manch ein ausländischer Sammler sogar ein halbes Vermögen. (Text: hr-fernsehen) Kampf um Amazonien (2): Das Justizschiff
Der brasilianische Staat weiß bis heute nicht genau, wie viele Menschen überhaupt am Amazonas leben. Viele haben weder Pass noch Geburtsurkunde und sind somit bei keiner staatlichen Stelle registriert. Sie leben in unzugänglichen Weilern und Dörfern, zu denen keine Straße führt. Diese Menschen haben keinen Zugang zu Sozialleistungen, nicht zum Gesundheitssystem, nicht zur Justiz. „Diese Menschen wurden über viele Jahre vom brasilianischen Staat ignoriert und schlicht vergessen“, sagt Richterin Sueli Pini. Mit ihrem Justizschiff bringt sie ein ganzes Bündel staatlicher Dienstleistungen zu der Bevölkerung am nördlichen Amazonas. Der Dampfer beherbergt ein Gericht mit Staatsanwalt, Gerichtsvollziehern und Pflichtverteidigern, ein Ärzteteam und Krankenschwestern.Schnell füllt sich der Dampfer mit Menschen aus der Region, die mit ihren kleinen Fischerbooten am Justizschiff anlegen. Verhandelt werden neben Grundstücksstreitigkeiten vor allem familienrechtliche Angelegenheiten und kleinere Gewaltverbrechen. Außerdem berät die Crew die Menschen vor Ort bei Behördengängen jeder Art und hilft bei der Formulierung von Anträgen auf Familiengeld, Rente oder Gesundheitsleistungen. Mittendrin ist Richterin Sueli Pini, die immer wieder versucht, einen Kompromiss oder Vergleich zwischen Täter und Opfer, zwischen Klägern und Beklagten zu vermitteln. (Text: BR Fernsehen) Kampf um Amazonien (3): Die Internet-Indianer
Die Ashaninka leben im brasilianisch-peruanischen Grenzgebiet. Ihre Region ist reich an wertvollem Tropenholz und lockt regelmäßig Invasionen illegaler Holzfällertrupps an, die mit Maschinen und Waffen anrücken, rücksichtslos jahrhundertealte Urwaldriesen fällen, brandroden und Schneisen in den Regenwald schlagen. Wo die Indianer sich der Holzmafia in den Weg stellen, werden ihre Dörfer überfallen und die Menschen getötet oder verjagt. Als vor einigen Jahren die brasilianische Regierung begann, isoliert lebende indigene Völker mit Internetstationen auszustatten, änderte dies vieles. Plötzlich hatten die Regenwaldbewohner die Möglichkeit, die Behörden gezielt um Hilfe zu bitten. Illegale Holzfäller konnten gefasst werden, weil innerhalb kürzester Zeit Militär und Polizei per Helikopter im Indianergebiet eintrafen und Rohstoffpiraten auf frischer Tat ertappten.Der Kampf um die Rechte der indigenen Völker bekam dadurch entscheidenden Auftrieb, und vor allem die Ashaninka machten Schlagzeilen, weil sie vorlebten, wie sich Indianertraditionen mit modernem Bewusstsein und der Verantwortung für die Umwelt vereinen lassen. Sie wurden zu Vorreitern in Sachen Umweltschutz, gründeten eine Umweltschule, in der sie Methoden nachhaltiger Landwirtschaft lehren, machten ihre Dörfer wieder autark, begannen mithilfe von Spenden Flächen wieder aufzuforsten und fanden Verbündete in den Organisationen, die sich seit dem Umweltgipfel von Rio verstärkt in Brasiliens Großstädten gründeten. (Text: BR Fernsehen) Kamtschatka – Ein Ende der Welt im Schatten der Vulkane
Deutsche TV-Premiere Mi. 26.05.1993 S3 von Martin Thoma und Michael Mattig-GerlachKamtschatka – Frühling auf Sibirisch
45 Min.In der kalten Jahreszeit verschwindet die Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten Russlands komplett unter Schnee und Eis. Wenn aber der Frühling naht, werden die Bewohner Kamtschatkas von einer ganz besonderen Leidenschaft erfasst. Die milde Jahreszeit beginnt in Kamtschatka dann, wenn man wieder vor die Tür treten kann, ohne in einen Schneesturm zu geraten, und die ersten Bären aus dem Winterschlaf erwachen. Dann geht es auf die Suche nach Abenteuern in die Wildnis. Kamtschatka ist berühmt für seine Vulkane und die beeindruckenden Naturschutzgebiete. Man muss nur irgendwie dorthin kommen, nur wenige Orte sind mit Straßen verbunden.Der Film von Sven Jaax wurde auf der dünn besiedelten Halbinsel im Osten Russlands gedreht und zeigt atemberaubende Bilder der rauen, unberührten Natur. Und er stellt die Menschen dort vor. Unter ihnen ist Sergey Samoilenko. Der Vulkanforscher weiß nur zu gut, dass es vielerorts unter der Halbinsel brodelt und ist daher stets in Alarmbereitschaft. Und auch im Privatleben ist Sergej heftig „entflammt“ und zeigt seinem Schwarm die Hotspots seiner Heimat. So lange es richtig kalt ist, gehen die meisten Einheimischen in die Sauna. Anton Morozov jedoch surft lieber, egal bei welchen Temperaturen. Er ist ständig auf der Suche nach der perfekten Welle im winterlichen Pazifik. Die meisten Gebiete sind so unberührt, dass ihre Bewohner sagen, es gebe in Kamtschatka keine Straßen, sondern nur Richtungen. Ohne Hubschrauber wären Dörfer wie Osernowski von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ort ist als Hauptstadt der Fischerei bekannt, obwohl dort gerade einmal 1.800 Menschen leben. Die meisten arbeiten als Seeleute, Filetierer oder Fischzähler. Nach mageren Jahren ist Osernowski zur Mustersiedlung geworden und dient als Beweis, dass die kleinen Küstendörfer trotz aller Widrigkeiten eine Zukunft haben. (Text: NDR) Kamtschatka – Kochende Erde – Eine Vulkanologin bei der Arbeit
Nirgendwo brodeln so viele kochend heiße Quellen und gibt es so viele Feuerberge wie auf der Halbinsel Kamtschtka im Osten Russlands. Daher war es schon immer der Traum der Vulkanologin Ludmilla Ossipenko, genau dort zu arbeiten. Vor 31 Jahren ereignete sich hier einer der größten Ausbrüche der vergangenen 2.000 Jahre. An der Oberfläche sind die Lavaströme von damals zwar erstarrt, aber noch immer entströmen den Spalten giftige und brennend heiße Gase – im Innern arbeitet die Erde weiter. Auf ihrer aktuellen Reise will Ludmilla Ossipenko mit einem Forscherteam zum ersten Mal im größten Geysir Kamtschatkas auf den Grund sehen. Mit einer eigens entwickelten Spezialkamera wollen sie die Funktionsweise des unterirdischen Dampfkessels ergründen. Filmautor Wolfgang Mertin begleitet die Vulkanologin bei ihrer Arbeit am Rand gigantischer Vulkankrater und ins sagenumwobene Tal der Geysire. (Text: hr-fernsehen)Kanada. Auf Eisstraßen zum Polarmeer
Der Hafen von Inuvik: Siedlung am Delta des Mackenzie River.Bild: NDR/SR/Karl TeuschlSeit Jahrzehnten werden im hohen Norden Kanadas jeden Winter Fahrbahnen auf den gefrorenen Flüssen und Seen angelegt. Über Hunderte Kilometer verbinden diese Eis-Highways in den Northwest Territories abgelegene Dörfer mit der Außenwelt. Sie führen in eine menschenfeindliche Urwelt am Rand des Polarmeers, wie sie in Europa kaum noch vorstellbar ist. In eine wilde, abweisende Natur, die aber in ihrer eisigen Schönheit tief beeindruckt. Nur für einige Monate gibt es diese Pisten jenseits des Polarkreises, ehe sie mit der Schneeschmelze im April wieder versinken. Straßenbauer wie Kurt Wainman beginnen gegen Anfang Dezember damit, die Eisdicke auf dem Fluss vor Inuvik zu messen.Mindestens 70 Zentimenter muss das Eis auf dem Mackenzie River stark sein, damit der Bau beginnen kann, mindestens 107 Zentimeter muss es messen, damit große, bis zu 40 Tonnen schwere Trucks mit Anhängern und voller Ladung auf den Eisstraßen fahren können. Im Januar und Februar, wenn die Temperaturen bis auf minus 50 Grad sinken, wächst das Flusseis aber sogar manchmal auf mehr als zwei Meter Dicke an. Die wenigen Monate, in denen die Eis-Highways bestehen, bedeuten für die Menschen im weiten Delta des Mackenzie River in Kanada die beste Reisezeit des Jahres. Dann können sie zum Einkaufen in der Stadt nach Inuvik fahren und bei Festen wie dem Muskrat Jamboree Verwandte und Freunde treffen. Inuit und Dene-Indianer sind es meist, aber auch zugewanderte Weiße, die bei diesen Dorffesten gerne mitmachen. Temperaturen von minus 20 Grad können dabei die abgehärteten Locals nicht davon abhalten, im Freien zu feiern. Tagsüber werden sportliche Meisterschaften wie Motor- und Hundeschlittenrennen ausgerichtet – aber auch skurrile Wettbewerbe wie Bisamrattenhäuten. Abends trifft man sich in der großen Sporthalle der Schule Inuviks zu traditionellen Trommeltänzen und einem Festmahl mit gebratenen Wildgänsen und Karibu-Eintopf. Das Kamerateam beginnt die Fahrt in den Norden auf dem legendären Dempster Highway, der vom einstigen Goldgräberort Dawson City im Yukon 700 Kilometer weit nach Norden in die Northwest Territories nach Inuvik führt, dem Versorgungsort der Region. Dort beginnen die Eisstraßen ins Delta des Mackenzie River und hinaus bis ins Polarmeer zum Inuit-Ort Tuktoyatuk. Familien und Trucker nutzen sie, aber auch Jäger, Rentierzüchter und sogar der Pfarrer von Inuvik, der im Winter seine abgelegenen Kirchengemeinden gut über das Eis erreichen kann. Doch die Ära der Eis-Highways neigt sich dem Ende zu. Eine neue Schotterstraße wird ganzjährig Inuvik mit Tuktoyaktuk am Eismeer verbinden, nur einige kürzere Strecken werden in Zukunft noch auf dem Eis angelegt werden. Das bedeutet Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklung einerseits, doch andererseits werden mit den Eisstraßen auch lieb gewonnene Traditionen verschwinden – und die Möglichkeit auf dem blanken Eis des gefrorenen Polarmeers zu fahren. (Text: NDR) Kanada – Die Rückkehr der Blackfoot
45 Min.Elroy Jerry hat die Misshandlungen im staatlichen Internat überlebt. Die Wunden auf der Seele sind nicht verheilt.Bild: NDRIn der Provinz Alberta in Kanada ist die Landschaft in vielen Regionen noch unberührt und von atemberaubender Schönheit. Hier sind die Blackfoot zu Hause. Sie gehören zu den First Nations in Kanada. Ihr Stammesgebiet erstreckte sich einst über 160.000 Quadratkilometer, eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland. Aufgrund eines umstrittenen Vertrages mit den Weißen behielten sie aber nur noch das Wohnrecht in drei kleinen Reservaten. Die Blackfoot waren Jäger, Sammler, begnadete Reiter und gefürchtete Krieger. Von den Weißen wurden sie als Wilde verachtet.Die kanadische Regierung verfolgte Ende des 19. Jahrhunderts eine Politik der kulturellen Auslöschung. Heutzutage sind die Blackfoot mit ihrer Kultur wieder in der Öffentlichkeit präsent. Sie leben ihre Rituale, feiern ihre Traditionen. Dazu gehören Staffelrennen mit Pferden, das sogenannte Indian Relay Racing. Natürlich geht es bei diesen Veranstaltungen auch ums Geld. Aber die Blackfoot-Gemeinschaft hat einen anderen, schonenderen Umgang mit Pferden. Die Indigenen feiern ihre Powwows, das sind Zusammenkünfte der verschiedenen Stämme. Und sie zelebrieren den Sonnentanz. Vier Tage lang. Kyle, ein junger Mann von Anfang 30, hat so wieder zurück ins Leben gefunden. Seitdem er seine Kultur wieder pflegen darf, sich zu seiner Herkunft bekennen kann, führt er ein normales Leben, vor allem ohne Alkohol. Die Blackfoot leben einen respektvollen Umgang mit ihrer Umwelt, vor allem mit Tieren. Für sie haben weiße Bisons, die extrem selten sind, heilende Kräfte. Die Blackfoot sagen, viele Menschen glauben, es würde sie nur im Märchen geben. Aber sie sind einfach immer noch da. (Text: NDR) Kanada – Mit Rodeo-Cowboys unterwegs
- Alternativtitel: Rodeo-Cowboys in Kanada
Die Rodeosaison ist hart: Einen Sommer sind Jeremy Harden und seine Freundin Kirsty White mit ihren drei Pferden auf Achse. Mit einem Ziel: die Canadian Finals in Edmonton, bei denen es das große Geld zu gewinnen gibt, für den Truck, die Pferde, das Futter, die Motels und für die nächste Saison. Tausende von Kilometern spulen sie ab, um sich bei Kleinstadt-Turnieren zu qualifizieren. Wenn alles gut geht, schaffen sie es unter die zwölf besten Rodeo-Reiter des Landes. Denn nur die dürfen ins große Finale. (Text: SWR)Kanadas deutsche Küste – Lunenburg in Nova Scotia
45 Min.An der Ostküste Kanadas klingt ein Ort, dessen Name seltsam vertraut klingt. Die kleine Stadt Lunenburg, westlich von Halifax, wurde 1753 von norddeutschen Einwanderern gegründet. Der idyllische Ort mit vielen Holzhäusern zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im 19. Jahrhundert war Lunenburg eine der reichsten Städte des Britischen Königreichs, durch Fischerei und Schiffsbau zu Wohlstand gekommen. Glenn Rhodenizers Familie geht über zehn Generationen direkt auf die deutschen Einwanderer zurück. Und was die Rhodenizers auf ihren Feldern direkt am Meer vor allem anbauen, könnte kaum typischer sein: Es ist Weißkohl, den die Bauernfamilie zu Sauerkraut verarbeit.Sauerkraut gibt es in dieser Gegend in jedem Restaurant und in jedem Supermarkt, es ist die Spezialität der Region. Das Erbe des Holzbootbaus wird von David Westergard erfolgreich gepflegt. In seinem uralten Schuppen setzt er gerade einen 20 Meter langen Schoner aus vier verschiedenen heimischen Holzarten zusammen. Holzboote zu bauen, sagt er, ist wie „Slow Food“: nachhaltig, bewusst, umweltschonend, abfallfrei. Auch die traditionellen Dorys, die Ruderboote dieser Gegend, die früher von Fischern genutzt wurden, sind aus Holz. Einmal im Jahr treten Teams aus Kanada und den benachbarten USA gegeneinander zum großen Dory-Rennen direkt vor der idyllischen Wasserfront der Stadt an. Danette Eden hat im Vorjahr gewonnen und den ganzen Winter über hart trainiert, um ihren Titel zu verteidigen. Auch Ollie Cote ist im Dory unterwegs, aber beruflich. Er sammelt „Irish Moss“, Seegras, das ein sehr wertvoller Grundstoff für Lebensmittel und Kosmetik und hier in Nova Scotia von besonders guter Qualität ist. Auch wenn die Industrie große Mengen benötigt: geerntet wird von Hand und vom kleinen Boot aus, als wäre die Zeit stehen geblieben. Lunenburg konnte sich in seinen Glanzzeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogar ein Opernhaus leisten, gestiftet von den reichen Schiffsbauern, obwohl hier nur knapp 3.000 Menschen leben. Den Niedergang des Schiffbaus überlebte die Oper zunächst als Kino, doch seit den 1970er-Jahren war sie dem Verfall preisgegeben. Farley Blackman hat sich die Rettung des Opernhauses zur Lebensaufgabe gemacht und kann jetzt, nach einem Jahrzehnt Arbeit, die Wiedereröffnung feierlich begehen. So ist Lunenburg ganz auf Holz gebaut. Die hölzernen Schiffe, die einst den Reichtum brachten, die hölzernen Häuser, die den Charme des Städtchens ausmachen, die hölzerne Oper, die in neuem Glanz erstrahlt. Das Holz wird in Nova Scotia bis heute auf traditionelle Art gewonnen: Mit Pferden ziehen Horse Logger die gefällten Stämme aus den hügeligen und felsigen Wäldern, die unpassierbar für Motorfahrzeuge sind. Kristan Kelley bildet mit seinem Lieblingspferd Belle ein eingespieltes Team. Im tiefverschneiten Winterwald kennen beide ihre Rollen und Wege, um den Baustoff, der Lunenburg reich und schön machte, aus den endlosen Küstenwäldern zu holen. Ein kanadisches Team aus Halifax hat für diese Naturdokumentation im Auftrag des NDR die Bewohner Lunenburgs ein ganzes Jahr lang begleitet, in allen Jahreszeiten. So entstand das berührende Porträt einer Stadt und Region, die von einem wohlhabenden Zentrum der Fischerei und des Holzschiffbaus nach langen Jahren des Niedergangs wieder zu einem betriebsamen Juwel an der kanadischen Küste wurde, UNESCO-Weltkulturerbe mit reicher Tradition und hoher Lebensqualität. (Text: NDR) Kanadas deutsche Küste – New Brunswick und die Bay of Fundy
45 Min.In der Bay of Fundy sind Fischwehre mit Holzpfosten im Meeresboden seit Jahrhunderten die traditionelle und ertragreichste Methode, Fisch zu fangen.Bild: NDR/Fundy Media Inc.Die Provinz New Brunswick an Kanadas Ostküste wurde einst nach dem welfischen Königshaus (Braunschweig) benannt, wurde aber durch Einwanderer*innen aus aller Welt geprägt. Heute ist New Brunswick die einzige offiziell zweisprachige Provinz Kanadas, in der gleichermaßen englisch wie französisch gesprochen wird. New Brunswick und die Bay of Fundy offenbaren ein ganz anderes Kanada mit liebenswerten und zuweilen etwas verschrobenen Bewohnerinnen und Bewohnern und einer zu den sieben Naturwundern Nordamerikas zählenden spektakulären Meeresbucht. In dieser Dokumentation sind die erstaunlichsten Geschichten über alle vier Jahreszeiten hinweg zusammengetragen.Kanada, wie man es noch nicht so kennt. New Brunswick ist eine Region der Extreme. In der Bay of Fundy herrscht der höchste Tidenhub der Welt. Hier fällt tatsächlich zwei Mal am Tag der 18 Meter tiefe Ozean trocken. Der launige Titel des alljährlichen Zehn-Kilometer-Wettlaufs auf dem Meeresboden, bei dem die Teilnehmenden guten Grund haben, rechtzeitig ins Ziel zu kommen, heißt dann auch „Just like Moses“ (wie einst Moses). Zur Sicherheit gibt es aber auch Taucher als Streckenposten. Das ständige Auf und Ab des Meerwassers spült regelmäßig spektakuläre Funde aus der Frühgeschichte der Erde aus der Steilküste, bis zu 300 Millionen Jahre alte Fossilien. Auch wenn die Küste von New Brunswick felsig ist, wird ausgerechnet hier in großem Stil Wein angebaut. Nicht zuletzt ein von Gourmets besonders geschätzter Eiswein. Die Trauben werden nach den ersten heftigen Schneefällen des Winters geerntet, haben aber in den warmen Sommermonaten ausreichend Sonne abbekommen. Das Land ist dünn besiedelt, die Menschen hier sind von einem ganz besonderen Schlag. Im Herbst kann man an der Stelle, wo der Wettlauf im Sommer stattgefunden hat, bei Flut im Kürbis um die Wette paddeln. Denn es gedeihen hier auch die größten Kürbisse der Welt, bis zu 500 Kilogramm schwer. Ausgehöhlt und bunt angemalt, dienen sie beim großen „Pumpkin Race“ als Rennboot. Bis zu vier Leute quetschen sich in einen Kürbis und hoffen, nicht zu kentern. Gar nicht so einfach. Eine der vielen bewohnten Inseln ist komplett von US-amerikanischem Territorium umschlossen. Wer einkaufen will, muss zwei Mal durch den Zoll, die Ein- und Ausfuhr von frischem Obst und Gemüse ist aber verboten. (Text: NDR) Kanadas Queen Charlotte Inseln – Trapper und Indianer
Sie gehören zum Schönsten, was Kanada zu bieten hat: die 150 Inseln im Pazifik, südlich von Alaska und nördlich von Vancouver Island. Queen Charlotte Islands heißen sie offiziell, aber die Haida-Indianer, die Ur-Einwohner der größten Inselgruppe von Britisch Columbia, nennen die Charlottes Haida Gwaii: „Inseln der Menschen“. Die Charlottes üben auf viele Besucher eine magische Anziehungskraft aus. Trapper Jim Larose kam 1965 aus Quebec nach Queen Charlotte City. Als Fallensteller lebt er bis heute vom Land und der See wie seine Vorbilder, die Haida.Die Ureinwohner wollen das Erbe ihrer Vorfahren bewahren, dafür nutzen sie auch modernste Technik. Mit Wasserflugzeugen überwachen sie den Fischfang und sorgen dafür, dass ihre Hauptnahrungsquelle, der Lachs, nicht ausgerottet wird. Auch die Haida-Kunst blüht wieder auf. Der Bildhauer Jim Hart arbeitet an einem mächtigen Totempfahl aus roter Zeder. Die Figuren und Symbole berichten aus dem Leben eines verstorbenen Freundes, dessen Leidenschaft die Jagd war. (Text: BR Fernsehen) Die Kanarischen Inseln – Gran Canaria und La Gomera
Ein Porträt der Kanarischen Inseln Gran Canaria und La Gomera. Auf Gran Canaria begleitet das Filmteam Jugendliche, die den kanarischen Ringkampf Lucha Canaria betreiben, eine Modedesignerin, Naturschützer, Wissenschaftler und Mandelbäcker. Auf La Gomera wird immer noch die alte Pfeifsprache El Silbo gesprochen und gelehrt. Die Landwirtschaft ist geprägt vom Bananenanbau und der Gewinnung von Palmensaft. Drei Millionen Menschen machen jedes Jahr Urlaub auf Gran Canaria, allein Maspalomas hält hunderttausend Betten für die Besucher parat.Dennoch findet man im Süden und im Inselinneren immer noch verträumte Dörfer und fast unbewohnte Täler, das unbekannte Gran Canaria. In Maspalomas brüten in der Charca, einem erst vor kurzem angelegten Süßwassertümpel, inzwischen wieder seltene Wasservögel. Die Filmautorin begleitet den Leiter der Umweltbehörde von Gran Canaria, wenn er früh morgens am Rande der Charca in Tarnkleidung Teichhühner fotografiert. Das ist sein Hobby, seine große Sorge aber gilt den zunehmenden Stürmen, die bewirken, dass immer mehr Dünensand ins Meer getragen wird. Am Stadtstrand von Las Palmas, in Las Canteras, trainiert regelmäßig eine der besten Lucha-Canaria-Kämpferinnen der Kanaren, Soledad Guerra. Sie schafft es, sogar einen 110-Kilo-Mann aufs Kreuz zu legen. In der Altstadt von Las Palmas, in La Vegueta, hat die junge preisgekrönte Modedesignerin Aurelia Gil ihr Atelier. Im verträumten Dorf Tejeda verrät die Zuckerbäckerin Rosa Marí Medina Vega das Rezept für ihre berühmte Mandeltorte, und in Galdár erzählt eine Archäologin, woran die Ureinwohner, die Guanchen, einst glaubten. La Gomera ist die kleine Schwester von Gran Canaria. Wer hier lebt und arbeitet, hat sich für ein Leben in Muße entschieden. So wie der Schuhmacher Domingo, der aus einem Hobby seinen Beruf machte. Kinder zeigen, wie sie die gomerische Pfeifsprache El Silbo erlernen. Weiter geht es zum zauberhaften Nationalpark Garajonay und zum besten Koch der Insel, der ein ganzes Menü aus Bananen zaubert. Man erfährt, wie Palmhonig ökologisch korrekt hergestellt wird, und warum man bei seiner Herstellung schwindelfrei sein muss. (Text: BR Fernsehen) Die Kanarischen Inseln – Lanzarote und Fuerteventura
Filmautor Christian Stiefenhofer stellt die kanarischen Inseln Lanzarote und Fuerteventura vor. Auf der Vulkaninsel Lanzarote gibt es eine reiche Kultur: Besucht wurden ein Keramikkünstler, ein Instrumentenbauer und ein Kamelzüchter, gezeigt wird Architektur von César Manrique. Auf Fuerteventura spielt neben der Viehwirtschaft und dem Betrieb traditioneller Getreidemühlen der Naturschutz eine große Rolle, so etwa setzen die Inselbewohner sich für den Erhalt der Sanddünen ein. Auf Lanzarote haben unzählige Vulkanausbrüche eine bizarre Mondlandschaft geformt. Für die Bewohner ist es eine große Herausforderung, dem karstigen, trockenen Boden den Anbau von Nahrungsmitteln abzugewinnen.Doch es gelingt ihnen, sogar Wein zu produzieren. Im Schutze Tausender kleiner Mulden, die als Wasserspeicher wirken, ziehen sie auf porösem Vulkangestein Rebstöcke. In der Landwirtschaft nutzte man früher Kamele als Lastentiere. Sindo Morales hat als Kind mit ihnen auf dem Feld gearbeitet. Heute züchtet er Kamele. Jeden Morgen führt er 30 bis 40 Tiere quer durch die Vulkanlandschaft zu den „Feuerbergen“. Dort befördern sie auf ihren Höckern Touristen durch den Nationalpark. Lanzarote, die „schwarze Perle“ im Atlantik, ist vielen Menschen eine Quelle der Inspiration. Der spanische Künstler und Architekt César Manrique verwirklichte auf „seiner“ Insel zukunftsweisende Projekte wie das Aussichtsrestaurant Mirador del Rio, bei dem Landschaft und Gebäude ineinanderzufließen scheinen. Der Töpfer Aquilino Rodriguez stellt aus der einzigartigen vulkanischen Erde, die er auf Streifzügen in die Berge sammelt, seinen eigenen Ton her. So enthält jedes Objekt aus seinem Ofen ein Stück Lanzarote. Fuerteventura ist Anziehungspunkt für Wassersportler aus aller Welt. Vor allem an den unzähligen kleinen Buchten der Nordküste finden sie ideale Bedingungen. Auf dieser Insel hat der Surfer Luis de Dios seine Heimat gefunden. Um sein Paradies zu erhalten, befreit Luis die Strände, an denen er surft, regelmäßig vom Müll – und macht daraus Kunst. Den scheinbar nie abflauenden Wind, den die Surfer so lieben, nutzen die Bewohner von Fuerteventura seit Langem. Hunderte von Windmühlen zeugen davon, doch nur drei sind heute noch in Betrieb. Die Mühle von Tiscamanita ist seit 18 Jahren in der Obhut von Jorge Padilla. Jeden Morgen setzt er die Segel des „widerspenstigen Tieres“, wie er seine Windmühle nennt. Die Inselbewohner dürfen sich von ihm laut Gesetz jederzeit ihr Getreide kostenlos mahlen lassen. Die vielen Brauntöne der Insel erinnern aus der Ferne an eine nordafrikanische Wüstenlandschaft. Tatsächlich gibt es hier kilometerlange Sandgebiete, wie die Wanderdüne El Jable, deren Erhalt jedoch gefährdet ist. Die junge Umweltwissenschaftlerin Yanira Arocha hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Düne bei Corralejo zu retten, um ein einzigartiges Stück Fuerteventura für zukünftige Generationen zu bewahren. (Text: BR Fernsehen) Die Kanarischen Inseln – Teneriffa, El Hierro und La Palma
Ein Filmteam begleitet auf Teneriffa Geologen, die auf dem Pico del Teide Messungen durchführen. El Hierro ist die kleinste Kanaren-Insel und ein Taucherparadies. Hier setzen sich Menschen für den Tierschutz ein. Auf La Palma werden neben einer seltenen Pflanzenwelt im Nationalpark Caldera de Taburiente auch traditionelles Handwerk wie die Seidenherstellung und ökologischer Weinbau gepflegt. Die kanarischen Gewässer werden von mehr Walarten durchzogen als jede andere Region der Weltmeere. Die Meeresbiologin Natacha Aguilar de Soto hat sich auf die Kommunikation der Meeressäuger spezialisiert und forscht in kanarischen Gewässern.Ihr jüngster Auftrag führt sie vor die Küste von El Hierro. El Hierro ist die kleinste Insel der Kanaren. In einer von Menschen weitgehend unberührten Natur konnten Rieseneidechsen bis heute überleben. Juan Pedro hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sie zu hegen und zu pflegen. Er ist ein stolzer Herreno, groß und kräftig, einst Meister im kanarischen Ringkampf. Auch den „Salto del Pastor“ beherrscht er noch, den Sprung mithilfe eines langen Stocks, mit dem die Hirten sich früher mühelos durch das felsige Gelände bewegten. Auf Teneriffa befindet sich Spaniens höchster Berg, der gut 3.700 Meter hohe Pico del Teide. Für die Geologin Gladys Rodriguez ist der vielgestaltige Teide „ein einzigartiges Freiluftlaboratorium“. Gemeinsam mit seinem Pendant auf La Palma, dem 2.426 Meter hohen Roque de Los Muchachos, dient der Teide als Standort für die Europäische Nordsternwarte. Auch der Forschungskomplex auf La Palma liegt inmitten einer unwirklichen Kraterlandschaft. Er verfügt über ein gutes Dutzend Teleskope, darunter das größte Spiegelteleskop der Welt. La Palma trägt den Beinamen „La Isla Bonita“, die schöne Insel. Dieser Schönheit kann sich auch Victoria Torres nicht entziehen. Nach langen Auslandsaufenthalten hat sie sich ihrer Wurzeln besonnen und erfüllt sich hier einen Traum. Sie bewirtschaftet alte Weinberge wieder und erntet Malvasier-Trauben. Der schwere, honigsüße Weißwein war lange Zeit das wichtigste Exportprodukt der Insel. Die vulkanischen Böden sorgen für das Aroma der Trauben, daher entwickeln die Weine eine einzigartige Charakteristik. (Text: BR Fernsehen) Kappadokien – Im Herzen der Türkei
45 Min.Skurrile Tuffsteinformationen im „Love Valley“, benannt nach der phallusartigen Form der Felsen.Bild: NDR/Till LehmannKappadokien ist eine märchenhafte Landschaft in der Türkei voller skurriler Tuffsteinfelsen wie zum Beispiel das Love Valley, das Tal der Liebe, benannt nach der phallusartigen Anmutung der Felsen. Seit 1985 ist das ganze Ensemble UNESCO-Weltkulturerbe. Der Job von Mehmet Bozgül beginnt immer bei Sonnenaufgang. Er ist Ballonpilot und startet jeden Morgen mit rund 160 anderen in den Himmel. Das Gedränge ist groß und Mehmet muss aufpassen. 2013 sind bei einer Kollision zwei Ballons abgestürzt, zwei Passagiere starben. Überall sichtbar sind die spitzen Felsen, die von den Türken Peri Bacalari genannt werden, Feenkamine.Diese Felsenpyramiden sind bis heute bewohnt. Auch Sabir Kavak und ihre Kinder wohnen darin. Mit dem Verkauf von Tee versuchen sie, über die Runden zu kommen. Avanos ist die Keramik-Hauptstadt der Türkei. Auch das Leibgericht der Kappadokier wird in einem Tontopf zubereitet: Testi Kebab. Hakki Cöl ist Töpfermeister in dritter Generation und spezialisiert auf die Töpfe, die nur einmal benutzt werden. Kappadokien ist auch ein Kürbisland. Auf dem Hof von Familie Yüce beginnt die Ernte. Manchmal wird Öl aus den Kernen gepresst, aber der Großteil der Ernte wird verzehrt. Geröstete Kürbiskerne sind ein Hauptbestandteil der Küche Kappadokiens. Eingezwängt zwischen schicken Hotels liegt das Haus von Hava Cakir. Die 75-jährige Witwe lebt allein. Direkt neben ihrem Gehöft hat gerade ein Boutiquehotel eröffnet. Die Besitzer würden sich am liebsten Havas Haus auch noch einverleiben. Für die ursprünglichen Bewohner Kappadokiens wird es immer schwieriger, in ihren Häusern wohnen bleiben zu können. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.03.2024 NDR Kapverden – Die vergessenen Inseln
Der Archipel der Kapverden liegt etwa tausend Kilometer südlich der Kanaren. Die Inseln sind sehr unterschiedlich. Manche haben weite Strände und hohe Vulkane mit grünen Tälern. Andere sind flach wie ein Pfannkuchen und mit Wüsten bedeckt. Eine Flugstunde südlich von Gran Canaria fühlen sich die Kapverdianer nicht als Afrikaner, sondern als Weltbürger. Kein Wunder, denn die Mehrheit aller Kapverdianer wohnt nicht auf den 15 Heimatinseln vor dem Senegal, sondern im Ausland. Kaum eine kapverdianische Familie, die nicht Angehörige in den Vereinigten Staaten von Amerika oder Europa hat, um die zurückgebliebenen Verwandten finanziell zu unterstützen.Trotz ihres Reichtums an Naturschönheiten ist die „Republica de Cabo Verde“ ein armes Land. Es fehlt an Regen und an Bodenschätzen. Die Inseln sind trocken, und nur dort, wo Passatwinde am Gebirge aufsteigen und sich Niederschläge bilden, können die Bauern Bananen und Maniok, Kaffee und Wein anbauen. Dass sich hier überhaupt Menschen ansiedelten, hat mit der Geschichte der Sklaverei zu tun: Auf dem Weg zwischen Westafrika und Brasilien waren die Kapverden der letzte Ankerplatz, um noch einmal die Wasser- und Lebensmittelvorräte aufzufüllen. Die Portugiesen machten sich die „Perlenkette im Atlantik“ zu Eigen und entließen die Eilande erst 1975 in die Unabhängigkeit. Der Einfluss Portugals ist bis heute geblieben und unübersehbar, nicht nur an der Architektur. Viele Kapverdianer leben vom Fischfang. Thunfisch und Langusten aus Cabo Verde landen auch hierzulande auf den Tellern. Der am Vulkan der Insel Fogo produzierte Kaffee und der Wein sind zwar berühmt für ihre Qualität, werden aber mangels Masse nicht exportiert. Auch Ziegenkäse und Bananen bleiben auf den heimatlichen Märkten oder auf den Frühstücksbuffets der Hotels. Die schießen auf der Badeinsel Sal mittlerweile wie Pilze aus dem Boden. So ist der Tourismus die große Hoffnung der Kapverdianer – mit Recht, denn das „grüne Kap“ ist während des ganzen Jahres von der Sonne verwöhnt. Wassersportler kommen voll auf ihre Kosten. Die Rebelados wollen von derlei „Teufelszeug“ nichts wissen. Sie leben zurückgezogen auf der Hauptinsel Santiago: eine Gruppe streng gläubiger Katholiken, die sich ohne Strom und fließend Wasser in die Berge zurückgezogen haben. Sie tragen keine Schuhe, aber große Holzkreuze. Sie leben von den Früchten ihres Bodens und verschließen sich allen Fremden. (Text: hr-fernsehen) Die Kapverden – Sound der Sehnsucht
45 Min.Eine Königin – fünf Tage lang. Caterina aus Mindelo hat das Zepter für den Karneval in der Hand. Natürlich wurde ihr gesamtes Outfit nur für diese Zeit entworfen.Bild: NDRDie Kapverden liegen mitten im Atlantik vor der Küste Senegals. Jede Insel hat ihren eigenen Charme und ihre eigene landschaftliche Vielfalt zu bieten: von dramatischen Vulkanlandschaften über die grünen Gärten auf Santo Antão bis zu den endlosen Sandstränden von São Vicente. Die afrikanische Inselgruppe besticht vor allem durch ein ganz eigenes Musikgenre, die Morna, die durch Sängerin Cesária Évora weltweit bekannt wurde. Es ist eine Art von klagendem Blues, der die Seele berührt und von Liebeskummer, Sehnsucht und den Herausforderungen des Lebens erzählt. Für die junge Sängerin Claudia ist Évora ein großes Vorbild. Sie studiert Jura, träumt aber von einer Karriere auf der großen Bühne.Die Musik ist ihre Leidenschaft und so investiert sie jede freie Minute in das Gitarrenspiel und den Gesang. Musik steht auch für den Trommler Nuno ganz oben auf dem Programm. Er leitet die Trommelband des Karnevals, das wichtigste Ereignis im Jahreskalender der Kapverder. Monatelang fiebern die Menschen diesem Fest entgegen und jeder, der kann, beteiligt sich an den Vorbereitungen. Auch die Zahnärztin Catarina ist diesmal prominent dabei: Sie tritt als Königin auf und hat dafür ein aufwendiges Kostüm in Auftrag gegeben. Wird der große Auftritt gelingen? Die Dokumentation begleitet Menschen, die auf den Kapverden leben, zeigt ihren Alltag und lässt sie von ihren Träumen erzählen. (Text: NDR) von Lourdes Picareta
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.