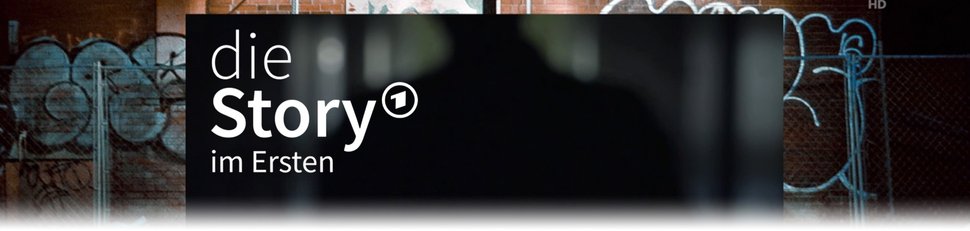Staffel 8, Folge 38–70
258. Klimafluch und Klimaflucht – Massenmigration – Die wahre Umweltkatastrophe
Staffel 8, Folge 38Es wurde immer heißer und trockener, so dass Mohammed Ibrahim entschied dort hinzugehen, wo die Temperaturen nicht so unmenschlich waren und es noch ein wenig Wasser gab: vom Niger hinüber in den Tschad und dann immer weiter Richtung Süden. Über mehrere Jahre, mit seiner Frau, seinen Kindern und seinen 70 Kamelen. Die Hitze verfolgte Mohammed und seine Tiere, von denen immer mehr verdursteten. Jetzt lebt er mit seiner Familie in einem Flüchtlingscamp nahe des Tschadsees und nur sieben Kamele sind ihm geblieben. Mohammed Ibrahim ist einer der ungezählten Menschen in der Sahelzone, die ihre Heimat verlassen haben. Nicht wegen Kriegen und Krisen, sondern wegen der hohen Temperaturen. Er ist ein Klimaflüchtling. Migration hat es immer gegeben, als Anpassungsstrategie an eine sich verändernde Umwelt.Doch die Zahl derer, die ausschließlich wegen des Klimawandels zur Migration gezwungen werden, hat sich etwa seit den 90er Jahren drastisch erhöht. Es ist eine doppelte Ungerechtigkeit: Die Industriestaaten, die auf Kosten anderer Länder reich geworden sind, schädigen mit ihren Emissionen die Atmosphäre und lassen ein zweites Mal die Bewohner der ärmeren Regionen zu Opfern werden. Wie viele Menschen werden bis zur Mitte unseres Jahrhunderts gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen? Dieser Frage geht die Dokumentation „Klimafluch und Klimaflucht“ nach: in der Sahelzone, in Indonesien und in der russischen Tundra, sogenannten Hotspots des Klimawandels. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 22.07.2019 Das Erste 259. Der Hartz IV-Report
Staffel 8, Folge 39Die einen halten Hartz IV für gescheitert, wollen das System grundlegend ändern oder sogar ganz abschaffen. Die anderen sprechen von einem Erfolgsmodell. Was davon stimmt? Hartz IV – Fluch oder Segen? Die Dokumentation „Der Hartz IV-Report“ stellt die Sozialreform auf den Prüfstand. Faktenreich, pointiert und emotional. Autorin Katrin Wegner gibt den Menschen hinter Statistiken und Zahlenkolonnen ein Gesicht. Immerhin rund sechs Millionen Menschen in Deutschland leben im System Hartz IV. Und das mitten im Wirtschaftsboom, wo Arbeitskräfte händeringend gesucht werden? Wie kann das sein? Woran liegt das? In wenigen Wochen wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern gegen die Verfassung verstoßen.Wie wichtig ist das Druckmittel überhaupt? Funktioniert Hartz IV auch ohne? Fordern und Fördern war das Versprechen einer der größten Sozialreformen der jüngeren Geschichte. 15 Jahre später diskutiert ganz Deutschland, allen voran die Parteien, über das Schicksal von Hartz IV. Angst vor sozialem Abstieg, Aufstieg durch Leistung, Arbeit muss sich lohnen – es geht bei der Diskussion um Hartz IV längst um mehr als Grundsicherung zum Leben, es geht um das ganze Paket soziale Gerechtigkeit. Das zeigen die Ergebnisse der exklusiven Umfrage für den Film beeindruckend deutlich. So stimmen 94 Prozent der Bundesbürger der Aussage zu „Menschen, die arbeiten, müssen am Ende mehr in der Tasche haben als Hartz-IV-Bezieher“. Baustelle Hartz IV – Abriss, oder reichen ein paar Reparaturen? Wenn ja, wie müssten die aussehen? „Der Hartz IV-Report“ sucht Antworten auf diese Fragen, sortiert Fakten und Erfahrungen bei Verantwortlichen, Experten und Betroffenen. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 29.07.2019 Das Erste 260. Das Atomwaffen-Kartell – Ende der Abrüstung?
Staffel 8, Folge 40Das Jahr 2019 könnte zum Schicksalsjahr der nuklearen Abrüstung werden. Ausgerechnet zum 70. Jahrestag der Gründung der NATO stehen wichtigste Abrüstungsverträge vor dem Aus: Der INF-Vertrag zum Verbot nuklearer Mittelstreckenraketen und der NEW-START-Vertrag zur Begrenzung der Zahl strategischer Atomwaffen. Beides sind Grundpfeiler der atomaren Rüstungskontrolle. Nun droht ein neuer nuklearer Rüstungswettlauf. Der Film von Nick Golüke und Michael Müller macht sich in den USA, in Russland und in Europa auf die Suche nach den Hintergründen und Hintermännern dieses Rückfalls in die Denkweisen und Strategien des längst überwunden geglaubten kalten Krieges.Sie sprechen mit den Vordenkern einer neuen atomaren Abschreckungslogik, analysieren das Netzwerk von Denkfabriken und Unternehmen, die sich ein Milliardengeschäft erhoffen. Mit dabei sind auch deutsche Banken, die Kredite an Rüstungs-Unternehmen wie zum Beispiel Airbus vergeben. Airbus baut gerade 48 neue Atomraketen für die U-Boote der französischen Marine. Jede Rakete trägt sechs bis zehn Sprengköpfe, und jeder Sprengkopf hat die zehnfache Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe. Der Film deckt auf, dass US-amerikanische Rüstungskonzerne wie Honeywell, Northrop Grumman oder Bechtel die neue Nukleardoktrin der USA mitschreiben und sich dadurch Milliardengewinne sichern. Die Autoren zeigen, dass Deutschland nicht nur militärstrategisch Teil der neuen globalen Nuklearstrategie ist, sondern dass in Deutschland auch die nukleare zivile wie rüstungstechnische Industrie miteinander verknüpft sind. Sie fahren nach Gronau zu URENCO und hinterfragen, wozu die Bundesrepublik bis heute eine Wiederaufbereitungsanlage braucht, die waffenfähiges Material erzeugt und etwa die Hälfte davon an die USA liefert. Schließlich begleitet der Film diejenigen, vor allem junge Menschen, die glauben, dass der Kampf gegen die Atomwaffen heute wieder dringender geführt werden muss denn je. Und dass er immer noch gewonnen werden kann. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 05.08.2019 Das Erste 262. D-Mark, Einheit, Vaterland – Das schwierige Erbe der Treuhand
Staffel 8, Folge 42Die Treuhand war der Maschinenraum, von dem aus der wirtschaftliche Wandel nach der Wiedervereinigung Deutschlands organisiert wurde. Die Privatisierung tausender planwirtschaftlich geführter Betriebe durch die Staatsholding bedeutete für Millionen Ostdeutsche den Weg in die Arbeitslosigkeit und führte bei vielen zu einer tiefen Kränkung, die bis heute politische Ventile findet. Der Film „Einheit, D-Mark, Vaterland – Das schwierige Erbe der Treuhand“ von Inge Kloepfer und Jobst Knigge zeigt das Wirken dieses Unternehmens in den Jahren von 1990 bis 1994. Die Autoren befragen Manager der Treuhand, Politiker und Experten über die Arbeit, die Ziele und die politischen Herausforderungen der Staatsholding.Wie frei waren die Treuhandmitarbeiter in all ihren Entscheidungen? Und hätte es keine anderen Möglichkeiten der wirtschaftlichen Wende gegeben? An der Spitze der Treuhand stand Birgit Breuel. Als Präsidentin der Anstalt wurde sie für viele Ostdeutsche zur Symbolfigur des brachialen Systemübergangs einer Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Nach Jahrzehnten des Schweigens ist sie in dem Film bereit, dieses Kapitel ihres bewegten Lebens noch einmal aufzuschlagen und Rede und Antwort zu stehen. Wie hat sie gehandelt, wie sind sie, ihre Mitarbeiter und auch die Politiker mit den schwarzen Schafen und der Kriminalität in der Wendezeit umgegangen? Und wie hat sie die Anfeindungen von Ostdeutschen verkraftet, die durch die Treuhand millionenfach ihre Lebensgrundlage und ihr Selbstbewusstsein verloren? (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 19.08.2019 Das Erste 264. Chemnitz – Ein Jahr danach – Wir sind nicht eins
Staffel 8, Folge 44Im August vergangenen Jahres geriet Chemnitz in die internationalen Schlagzeilen. Nach dem gewaltsamen Tod von Daniel H. mobilisierte sich die rechte Szene. Denn der mutmaßliche Täter soll ein Flüchtling sein. Höhepunkt der Proteste: Am Montag, den 27. August gehen 6000 Menschen auf die Straße. Wütende Chemnitzer demonstrieren an der Seite von Neonazis und Hooligans. Angst machte sich breit unter Flüchtlingen, Scham unter Chemnitzern, die den Hass nicht teilen. Ein Jahr nach den verstörenden Ereignissen fragt der Film, wer in der Stadt nun den Ton angibt.Menschen aus verschiedensten Lebenswelten kommen zu Wort, zeigen ihren Alltag. Wie hat sich das Leben hier verändert – und das Sicherheitsgefühl? Viele Menschen mit Migrationshintergrund sind heute ängstlicher. Wir lernten die syrische Familie Algaber vor einem Jahr kennen – da wagte sie sich kaum noch vor die Tür aus Angst vor tätlichen Angriffen. Das Gefühl, ignoriert oder abgelehnt zu werden, schwand in den letzten Monaten nicht. Inzwischen sind die Algabers aus Chemnitz weggezogen. Hunderte Menschen mit ausländischen Wurzeln in der sächsischen Stadt sind keine Flüchtlinge, sondern Akademiker – Studenten oder Lehrende an der Technischen Universität. Ihr Leben findet auf dem Campus statt. Hier fühlen sie sich sicher – und akzeptiert. Aber außerhalb? Ist es eher keine Stadt für Migranten, meint die Professorin Olfa Kanoun seit den Demonstrationen im vergangenen Jahr. Sie stammt aus Tunesien und lebt seit über zehn Jahren in Chemnitz. Die Wissenschaftlerin freute sich eigentlich darüber, dass in den vergangenen Jahren das Leben in Chemnitz bunter wurde. Genau dieses „buntere“ Leben hat auf andere Chemnitzer eine eher negative Wirkung. Sie fühlen sich „nicht mehr zu Hause“, beklagen die gestiegene Migrantenkriminalität, meinen, die Innenstadt sei unsicher. Heute wie vor einem Jahr. Sie haben sich ein Leben in ihrem Viertel, zwischen Wohnung, Kleingartensparte und Vereinskneipe eingerichtet. Auch Matthias Singer, der Wirt des Gartenlokals „Zur Vogelweid“ und viele seiner Stammgäste sehen das so. Der Fakt, dass Chemnitz im Vergleich mit Leipzig und Dresden die sicherste Großstadt in Sachsen ist, tut dabei nichts zur Sache. Mit dem geschwundenen Sicherheitsgefühl in der Stadt müssen auch die Mitarbeiter des Ordnungsamts umgehen, die hier Streife laufen. Sie sollen zusammen mit der Polizei Präsenz zeigen. Die 21-jährige Krankenpflegerin Margarete Rödel war von den Demonstrationen vor einem Jahr schockiert. Sie hat sich entschlossen, politisch aktiver zu sein, will ihre Stadt nicht den Rechten zu überlassen und engagiert sich bei der grünen Jugend. Der grüne Aufwind unter jungen Leuten motiviert sie und ihre Freunde. Der Unternehmer und Immobilienbesitzer Lars Fassmann lässt Gebäude sanieren und unterstützt zahlreiche kulturelle Initiativen – auch um mehr junge Menschen nach Chemnitz zu locken. Denn Chemnitz ist eine überalterte Stadt – die älteste Großstadt Deutschlands. Ist das auch ein Grund dafür, weshalb Menschen wie Arthur Österle hier besonders Gehör finden? Er war Chefordner bei den Pro Chemnitz Demonstrationen vor einem Jahr. Heute bekennt sich Österle zur AfD, die sich inzwischen von Pro Chemnitz distanziert. Auch bei der AfD bringt er sich als Ordner ein. Es kommen deutlich weniger Menschen zu öffentlichen Veranstaltungen. Aber die Stärkung der deutschen Heimat ist ihm weiter ein Anliegen. Und Österle ist sich sicher: der Einfluss der AfD wird stärker. Bei den Stadtratswahlen hat seine Partei 18 Prozent geholt – Pro Chemnitz 7,6 Prozent. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 26.08.2019 Das Erste 265. Der rote Riese zockt ab – Wie Sparkassen bei den Zinsen tricksen
Staffel 8, Folge 45Seit der Bankenkrise 2008 gelten sie als besonders seriös. Sparkassen und Volksbanken haben deshalb mittlerweile mehr Umsatz als Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Doch die Kundenklagen häufen sich und mehr noch: Es gibt zahlreiche Geschädigte, die systematisch abgezockt worden sind. Experten beziffern die Schadensumme auf mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Was ist da auf den Konten los? Der niedersächsische Landwirt Johann G. ist einer der Sparkassen-Geschädigten. Um mehr 200.000 Euro ist er geprellt worden.Ein Oberlandesgericht hat ihm Recht gegeben und Rückzahlung verordnet. Der Trick der Sparkasse ist simpel: Zinsveränderungen werden nicht sofort an den Kreditnehmer weitergegeben, wie es der Gesetzgeber vorschreibt. Es kann jeden treffen, beim Dispo etwa, bei Konsumkrediten und sogar beim Sparkonto. Besonders oft passiert das bei kurzfristigen Überziehungskrediten, dem Standardgeschäft von Mittelständlern. Die eine Rechnung, die noch schnell beglichen werden muss und ein Kunde hat noch immer nicht bezahlt – schon ist das Konto überzogen. Klingt nach einer Petitesse, ergibt aber einen Riesenschaden: Denn auf jeden Zinsbetrag im Minus zahlt man Zinseszins. „Der Volkswirtschaft können durch Falschberechnungen der Sparkassen jährlich mehrere Milliarden Euro an Schaden entstehen“, sagt Hans-Peter Schwintowski, Professor für Bankenrecht an der Humboldt-Universität Berlin. Kreditsachverständiger Hans-Peter Eibl stimmt zu. Er beschäftigt sich mit Zinsbetrug durch Sparkassen und Volksbanken, rechnet seit 1988 Konten nach. „Ich habe Konten für rund 1000 Klienten geprüft. Und kann sagen: Bei den Sparkassen beträgt der Schaden im Durchschnitt, pro Fall, 170.000 Euro. Das ist Wahnsinn, das kann Unternehmen vernichten.“ Die verklagten Banken bestreiten systematische Tricksereien. Es handele sich um Einzelfälle. Mit Eibl treten wir eine Reise an: Vom Nord-Ostsee-Kanal bis nach Karlsruhe treffen wir auf Kunden, die ihre Sparkasse verklagen. Die fassungslos darüber sind, wie die öffentlich-rechtliche Bank mit ihnen umgesprungen ist: Reinhard und Thomas K., die eine familiengeführte Werkstatt besitzen, klagen auf 235.000 Euro Schaden. Alexander G., der einen Pflegedienst betreibt, reklamiert 25.000 Euro Schaden. Und Gerhard S., ehemaliger Geschäftsführer eines Betriebes mit 90 Arbeitsplätzen: Sein Schaden durch diverse Banken, sagt er, belaufe sich auf eine Million Euro. Mit fatalen Folgen: Die Firma musste Insolvenz anmelden, die Arbeitsplätze sind weg. „Das ist leider normal“, sagt Eibl. „Ich habe in 30 Jahren nur ein einziges Konto erlebt, bei dem Zins und Zinseszins korrekt berechnet wurden. „Laut BGH und laut der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkassen sind verspätete Zinsanpassungen nicht erlaubt.“, sagt Prof. Schwintowski. Dennoch gibt es bundesweit Sparkassen, die so weitermachen. Und manche offensichtlich häufiger als andere. Wie kann das sein? Ein Film über wütende und enttäuschte Kunden – und Banken, die eigentlich für sie da sein müssten – aber genau das Gegenteil tun. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 02.09.2019 Das Erste 267. Leonora – Wie ein Vater seine Tochter an den IS verlor
Staffel 8, Folge 47„Dein eigenes Kind geht lieber zu Terroristen, als bei dir zu sein und findet das auch noch cool!“ – Der Film „Leonora“ erzählt den verzweifelten Kampf eines Vaters um seine Tochter, die sich der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in Syrien angeschlossen hat. Vier Jahre lang begleitet ein Fernsehteam den Vater. Er weiß nicht, ob seine Tochter Leonora überleben wird. Der Bäcker aus der Provinz trifft syrische Schleuser, verhandelt mit Terroristen und erhält ungeahnte Einblicke in das Innere des IS, während er versucht, ein „normales“ Leben zu führen. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo. 09.09.2019 Das Erste 269. China – Die neue Weltmacht
Staffel 8, Folge 49Der Name des gigantischen Projekts ist eine Anleihe aus vergangenen glorreichen Zeiten. Für Chinas Präsidenten Xi Jinping ist seine Idee einer neuen „Seidenstraße“ das Projekt des Jahrhunderts und er lädt die Welt ein mitzumachen. Über 60 Staaten haben sich dazu bereits entschlossen. Peking hat hunderte von Milliarden für weltweite Infrastrukturprojekte von Afrika bis nach Griechenland bereitgestellt. Häfen wurden übernommen und Bahnstrecken werden gebaut. Zudem kauft und kaufte China im Ausland hunderte von Firmen.All das folgt dem Ziel, in ein paar Jahren die USA als Weltmacht abzulösen. Dabei geht es nicht nur um Investitionen im Ausland. Es geht um den Status einer Ordnungsmacht und um politischen Einfluss. Denn längst ist China nicht mehr nur die billige Werkbank für den Westen. Der erfolgreiche chinesische Aufstieg begann vor 40 Jahren und hat unterdessen zu Hause hunderte von Millionen Chinesen aus der Armut geholt. Im Kampf um die Weltherrschaft haben die USA China den Handelskrieg erklärt und Milliarden Dollar an Strafzöllen gegen den neuen Wirtschaftsriesen verhängt. Präsident Trump setzt auch Deutschland und Europa unter Druck, China zu boykottieren. Peking hat die USA als wichtigsten Handelspartner Deutschlands abgelöst. Allein 2017 kauften chinesische Investoren deutsche Firmen im Wert von 17 Milliarden Euro. Trumps Kreuzzug gegen China bringt das Exportland Deutschland in massive Schwierigkeiten. Denn in China werden mehr Autos verkauft als im Rest der Welt. Allein VW macht 40 Prozent seines Gewinnes dort. Die Drohung Washingtons, notfalls deutsche Autos als „Risiko für die nationale Sicherheit“ Amerikas einzustufen, falls Berlin nicht kooperiert, ist nur ein Druckmittel, Deutschland auf Linie zu bringen. Trumps ultimative Forderung an Deutschland, keine digitale Technologie vom chinesischen Weltmarktführer Huawei zu kaufen, weil der chinesische Konzern angeblich der verlängerte Arm der chinesischen Machthaber ist, verstärkt die politische Entfremdung zwischen Berlin und Washington weiter. Konfrontation oder Kooperation lautet nun die zentrale Frage in Berlin. Gleich, ob Zukunftsmärkte wie künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 oder Autos betroffen sind – ohne China geht nichts mehr. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann China mit seinen 1,3 Milliarden Menschen die USA auch als größten Export-Markt ablöst. Autor Hubert Seipel untersucht die Gründe für den rasanten Aufstieg Chinas und die Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Der mehrfache Fernseh – und Grimmepreisträger begleitete Wirtschaftsminister Peter Altmaier bei seinen Verhandlungen nach China, drehte sowohl bei ehemals deutschen Firmen wie KraussMaffei, die von chinesischen Investoren übernommen wurden, als auch bei deutschen Unternehmen, die in China produzieren. Seipel drehte auch in der chinesischen Metropole Shenzhen beim chinesischen Internet-Giganten Huawei. In einem exklusiven Interview erklärt Huaweis legendärer Gründer Ren Zhengfei, warum er auf Europa und Deutschland setzt. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 16.09.2019 Das Erste 271. Messerland Deutschland?
Staffel 8, Folge 51„Messer machen Mörder“, so deutlich bringt es die Berliner Polizei auf den Punkt. Messerangriffe polarisieren wie kaum ein anderes Thema seit Jahren die Öffentlichkeit. Notärzte, Polizisten, Gewaltforscher und Lehrer sind sich schon lange sicher: In Deutschland gibt es eine gefährliche Bewaffnung mit Messern. Die zunehmende Bewaffnung von jungen Männern wirkt für sie nachweislich ansteckend. Denn wer Angriffe erlebt hat, Opfer oder Täter kennt, wer kein Vertrauen in die regelnde Kraft von demokratischer Öffentlichkeit und Polizei hat, wer einfach nur aggressiv ist, wem es an menschlicher Empathie fehlt, der bewaffnet sich.Erik war 14, als ein deutscher Mitschüler mehrfach in der Schule auf ihn einstach. Der Arbeiter Mohammad dagegen war zur falschen Zeit am falschen Ort, als ein junger Asylbewerber vor einem Kiosk mit einem 13-cm-Messer auf ihn einstach. Notärzte und Unfallchirurgen konnten beide retten. Für die Notfallmedizin sind Messerangriffe ein Kampf gegen die Uhr. In Großstädten sind die Kliniken bereits darauf eingestellt. Mit neuen technischen Möglichkeiten werden Blutungen der Messeropfer am Tatort oder in den Notaufnahmen der Kliniken gestoppt. Viele überlebende Opfer leiden aber ihr weiteres Leben an den Folgen: an chronischen Schmerzen verletzter Organe und wiederkehrenden Entzündungen. Psychologen warnen zudem vor den psychischen Folgen für die Opfer, die Messerangriffe als Eingriffe in die Würde, in die Unverletzlichkeit ihres Körpers erleben. Für Johannes (17) endete ein Messerangriff tödlich. In der Faschingszeit stach ihm ein 16-Jähriger mit einem Messer in den Bauch. Innerhalb von Minuten verblutete er und starb. Für seine Familie, Freunde und seine Mitspieler im Reinstetter Fußballverein ein Tag, den sie auch zwei Jahre nach der Tat nicht vergessen können. Hätte das Leben von Johannes gerettet werden können, wenn das Mitführen von Messern bei Veranstaltungen in Schulen und in der Bahn grundsätzlich verboten wäre und dieses Verbot auch konsequent kontrolliert würde? Könnten weitere Messeropfer durch die Einrichtung von Waffenverbotszonen verhindert werden? Der Film begleitet die politische Auseinandersetzung um dieses Vorhaben. Erst seit Mitte 2018 werden Fälle mit dem „Tatmittel Messer/Stichwaffe“ von den Innenministerien der Länder gesondert registriert. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 23.09.2019 Das Erste 273. Der Mordfall Lübcke und rechter Terror in Deutschland
Staffel 8, Folge 53Der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke gilt als Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik: Zum ersten Mal tötet ein Rechtsextremer wohl gezielt einen Politiker. Die Dokumentation beleuchtet die engen Verbindungen, die der mutmaßliche Haupttäter in die rechtsextreme Szene hatte. Jahrelang beging er Gewalttaten gemeinsam mit anderen militanten Neonazis – bis er sich scheinbar zurückzog. Diese rechtsextremistische Grundierung des Attentats auf den Kasseler Regierungspräsidenten rückt die These vom Einzeltäter in ein neues Licht.Parallelen zur Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds – kurz NSU – scheinen offensichtlich: Auch das NSU-Trio tötete seine Opfer aus nächster Nähe, per Kopfschuss, und agierte nach der Strategie des „führerlosen Widerstandes“ – ein Konzept, das in gewaltbereiten Neonazi-Kreisen propagiert wird. Auch der Mord an Walter Lübcke passt in dieses Muster. Das Prinzip rechtsextremer Einzeltäter und Kleingruppen stellt unseren Rechtsstaat vor eine grundsätzliche Frage: Ab wann ist rechte Gewalt Terrorismus? Und wie umgehen mit Gruppen-Chats in denen Mord- und Umsturzfantasien gesponnen werden? Auch im Gerichtsprozess gegen die Gruppe „Revolution Chemnitz“, der in diesen Tagen beginnt, wird es genau um solche Fragen gehen. Dabei erzählt die Dokumentation auch: Terrorismus von rechts ist kein neues Phänomen in Deutschland. Das Gegenteil ist der Fall: In der Bundesrepublik haben Rechtsextreme seit den 1970er Jahren mehr als 200 Menschen getötet. Dazu kommen mehr als 2000 Sprengstoff- und Brandanschläge. Damit wurden mehr Menschen Opfer von rechter Gewalt als von jeder anderen Form von Terrorismus. Doch meist waren Migranten die Opfer und keine „deutschen“ CDU-Politiker. Der Aufschrei blieb daher aus. „Die Story im Ersten: Der Mordfall Lübcke und rechter Terror in Deutschland“ taucht tief ein in die seit Jahrzehnten existierende rechtsextreme Szene in Deutschland und zeigt, wie heute Hass und Hetze im Netz und auf der Straße für eine politische Stimmung sorgen, in der sich Rechtsextreme in ihren Gewaltfantasien bestärkt fühlen. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 30.09.2019 Das Erste 274. Bluthandel – Dollar gegen Gesundheit
Staffel 8, Folge 54Die amerikanisch-mexikanische Grenze ist in Zeiten von Präsident Trump zum Symbol des Streits um Migrationspolitik geworden. Völlig unbemerkt von der öffentlichen Diskussion spielt sich hier ein Grenzverkehr ab, von dem globale und europäische Pharmafirmen profitieren. Denn die Grenze ist Umschlagplatz eines wichtigen Rohmaterials: menschliches Blutplasma. Der Film blickt hinter die Kulissen eines undurchsichtigen Milliardenmarkts – und erzählt die Geschichte von einem Vater und seiner Tochter, die inmitten dieses Geschehens versuchen, auf ihre Weise zu überleben. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo. 07.10.2019 Das Erste 279. Der Bayern-Boss: Schlusspfiff für Uli Hoeneß
Staffel 8, Folge 59Am 15. November 2019 endet eine Ära in Fußball-Deutschland. Bei der jährlichen Jahreshauptversammlung des FC Bayern München wird sich Uli Hoeneß, langjähriger Vereinsboss und amtierender Präsident des erfolgreichsten Clubs des Landes, nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Aus Anlass seines Rückzugs blickt diese „Story im Ersten“ auf die Karriere von Uli Hoeneß zurück – auf die Höhen und Tiefen eines Fußballer- und Managerlebens. (Text: ARD)Deutsche TV-Premiere Mo. 04.11.2019 Das Erste 280. Kein Geld für kranke Kinder
Staffel 8, Folge 60Lange geplante Herzoperationen von Kindern werden kurzfristig verschoben. Rettungssanitäter mit jungen Notfallpatienten an Bord wissen nicht, welche Klinik sie anfahren können. Eltern müssen in weit entfernte Krankenhäuser pendeln. Der Mangel an Pflegepersonal sorgt für unterbesetzte Stationen. Dazu kommt: Das Fallpauschalen-System berücksichtigt die zeit- und kostenintensive Behandlung kranker Kinder nicht ausreichend. Die Folge: Kliniken geben Teile ihrer Kinderstationen ganz auf. Warum vernachlässigt unser Gesundheitssystem die Schwächsten, unsere Kinder? An der Haunerschen Kinderklinik in München können in der Intensivstation nur acht von 16 Betten belegt werden.Auch in der Kinder-Intensivstation an der Medizinischen Hochschule Hannover stehen 20 Prozent der Betten leer. Der Grund: Pflegekräftemangel. Kranke Kinder müssen abgewiesen werden. Ein weiteres Problem ist das Bezahlsystem im Gesundheitswesen. Die Krankenkassen rechnen nach sogenannten „Fallpauschalen“ ab. Bezahlt wird ein Durchschnittswert, in dem sowohl Diagnostik, Behandlung und Pflege enthalten ist. Doch Gespräche mit Kindern und Eltern dauern länger, brauchen mehr Einfühlungsvermögen, und die viel niedrigeren Fallzahlen machen es schwerer, Routinen zu entwickeln. „Kinder widersetzen sich der Durchtaktung im System, weil sie Kinder sind“, sagt Professor Christoph Klein, Direktor der Haunerschen Kinderklinik München. Wenn den 18 Monate alten Viktor bei einer einfachen Blutabnahme zwei Pflegerinnen und seine Mutter halten müssen, ist dieser Personaleinsatz in keiner Pauschale eingepreist. Und die Situation spitzt sich zu, stellt Autor Stefan Eberlein bei den Recherchen für seinen Film fest. In den Krankenhäusern werden Budgets für die zeitintensive Behandlung von Kindern mit komplexen Krankheiten gekürzt, oft nur, um die Vorhaltekosten zu reduzieren. Wenn 2020 zudem die „generalisierte Pflegeausbildung“ kommt, befürchten Ärzte, dass es noch schwerer wird, hochqualifizierte Pfleger für die Kinderstationen zu bekommen. „Diejenigen die keine spezialisierte Ausbildung haben, müssen wir dann über ein oder zwei Jahre qualifizieren“, so Jochen Scheel, Geschäftsführer von G-Kind, der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V.. Warum stehen in der Diskussion um unser Gesundheitssystem die Bedürfnisse von Kindern nie im Fokus? Der Film zeigt, wie Ärzte und Pfleger vergeblich bessere Bedingungen einfordern und wie wenig sie dabei bei der Politik Gehör finden. Professor Christiane Woopen, Medizinethikerin in Köln, hat gerade eine Studie zur Situation herausgebracht und konstatiert: „Es erschreckt, mich, dass wir in einem so reichen Land tatsächlich mit der Gesundheit unserer Kinder in der klinischen Versorgung nicht gut umgehen.“ (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 04.11.2019 Das Erste 282. Ungenügend! Wie der Lehrermangel unsere Grundschüler abhängt
Staffel 8, Folge 62Der Lehrermangel wird in den nächsten Jahren dramatisch ansteigen. 2025 fehlen mindestens 26.000 Grundschullehrer. Ausgerechnet die Jüngsten leiden massiv unter dem Personalmangel, wenn es um die ersten Schritte in die Welt des Wissens geht.Krisenmanagement statt BildungsoffensiveAns Lehrerpult werden nun immer mehr Pensionäre, Studierende oder vermehrt Akademiker ohne jegliche pädagogische Ausbildung geschickt, sogenannte Quer-und Seiteneinsteiger. Der Lehrerverband schätzt, dass schon jetzt etwa 40.000 Stellen mit ihnen besetzt sind. Lesen, Schreiben, Rechnen – erklärt von Leuten, die von Didaktik wenig oder keine Ahnung haben.Was bedeutet das für die Kinder, die Schulen und die Bildung in Deutschland? Hat die Politik versagt?Selbstversuch hr-Journalistin Petra Boberg startet einen Selbstversuch und unterrichtet mehrere Wochen an einer Grundschule in Wiesbaden: eine 1. Klasse und eine 4. Klasse, in Deutsch, Sachkunde und Musik. Sie selbst hat zwar Germanistik studiert, aber keine Ahnung, wie man Kindern Lesen und Schreiben beibringt. Eine Vorbereitung auf den neuen Job gibt es bisher in Hessen nicht. Wie geht das Kollegium mit der ungelernten Lehrerin um? Wie besteht sie den Alltag an einer Schule mit Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen? Wie reagieren die Kinder? Brigitte Kleine erlebt den täglichen Klassenkampf der ungelernten Lehrerin zwischen fliegenden Papierkügelchen, kippelnden Stühlen und verzweifeltem Kampf gegen den Lärmpegel.Von wegen BildungsgerechtigkeitVoll ausgebildete Grundschullehrer können sich ihren Arbeitsort aussuchen. Das ist in den seltensten Fällen eine sogenannte Brennpunktschule. Genau dort, wo die besten Lehrer gebraucht würden, unterrichten die meisten Quer- und Seiteneinsteiger. Bildungsforscher sprechen von einer gefährlichen Entprofessionalisierung. Was bedeutet das für die Bildungsgerechtigkeit?Grundschullehrer? – ‚Kann doch jeder!‘Doch ungelerntes Personal spart auch Geld: Besonders die Seiteneinsteiger haben meist befristete Arbeitsverträge. Aber auch voll ausgebildete Grundschullehrer verdienen in manchen Bundesländern immer noch weniger als Gymnasiallehrer, und das, obwohl sie pädagogisch vor den größten Herausforderungen stehen: Inklusion, Integration, wachsende soziale Aufgaben. Vor dem Hintergrund dieser Diskussionen stellt der Film die Frage: Was ist uns in Deutschland überhaupt ein Grundschulkind wert? (Text: Tagesschau24) Deutsche TV-Premiere Mo. 11.11.2019 Das Erste 284. Abnehmen um zu überleben
Staffel 8, Folge 64Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen ist noch viel schwerer und damit adipös. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Doch eines haben alle Betroffenen gemeinsam: Ihr Lebenswandel hat die Erkrankung begünstigt. Zu wenig Bewegung, zu viele Kalorien. Die 47-jährige Sonja Bauer wiegt 220 Kilo. Sie kann sich selbst nicht mehr versorgen und nur noch mit fremder Hilfe das Bett verlassen. In der Vergangenheit hat sie immer wieder versucht, abzunehmen, doch Diäten und Kuren haben nicht geholfen. Im Gegenteil, sie haben das Problem verschlimmert. Sonja Bauer hat inzwischen große Angst, dass sie ohne ärztliche Hilfe nicht mehr lange leben wird.Doch wie ist das deutsche Gesundheitssystem auf adipöse Patienten vorbereitet? Viele Krankenhäuser können zum Beispiel Spezialbetten für stark übergewichtige Menschen nicht anbieten und sind mit den zusätzlichen Kosten überfordert. Die Krankenkassen entscheiden im Einzelfall, es gibt in Deutschland kein umfassendes Behandlungskonzept. Die Politik setzt vor allem auf Prävention. Doch reicht das bei schwer adipösen Patienten? Sonja Bauer muss abnehmen, um zu überleben. Wird sie es schaffen? Ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunks hat sie und ihre Ärzte bei dem Kampf gegen Adipositas über einen längeren Zeitraum hautnah begleitet. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 18.11.2019 Das Erste 286. Verliebt, verlobt, verprügelt – Gewalt gegen Frauen
Staffel 8, Folge 66Eine Doppelhaushälfte irgendwo in deutscher Kleinstadtidylle. Daniela und Eduard machen Fenster und Türen einbruchsicher – aus Angst vor Danielas Ex-Partner, der sie geschlagen, gewürgt und beleidigt hat. Im Gegensatz zu vielen anderen Schlägern in Partnerschaften wurde er verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung – auf Bewährung. Partnerschaftsgewalt ist eine der häufigsten Straftaten in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt ein Mann seine Frau oder Ex-Frau sogar um – in der Hälfte der Fälle, weil sie ihn verlassen möchte oder bereits verlassen hat.Insgesamt wurden 113.965 weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt in der polizeilichen Kriminalstatistik 2017 erfasst. Die Dunkelziffer aber, so Experten, ist um ein vielfaches höher. Ein Großteil der Gewaltübergriffe in Partnerschaften kommt nie ans Tageslicht: aus Scham, aus Angst, wegen der Kinder – und auch weil die Unterstützung von außen fehlt. Petra hielt es 14 Jahre bei ihrem prügelnden Ehemann aus, aus Angst um die Kinder, bis sie es endlich schafft, ins Frauenhaus zu fliehen. „Das Frauenhaus war meine letzte Rettung.“ In Deutschland gibt es 350 Frauenhäuser mit 6.700 Plätzen für Frauen und ihre Kinder, tatsächlich bräuchte es aber mindestens doppelt so viele, sagen Wissenschaftler und Frauenhilfsorganisationen. Daniela hat es große Überwindung gekostet, sich Hilfe zu holen und ihren Ex-Partner anzuzeigen. „Der Gang zur Polizei und dann zum Gericht waren die schwierigsten Hürden, denn wird man mir glauben?“ Ihre Aussagen wurden zusätzlich durch Fotos unterstützt, die sie von ihren Verletzungen gemacht hat. Häufig aber steht Aussage gegen Aussage und die Chancen, mit einer Strafanzeige Erfolg zu haben, sind gering. Gewaltopferambulanzen, in der Verletzungen gerichtssicher dokumentiert werden, sind in Deutschland rar und unterfinanziert. Auch Therapieprogramme für gewalttätige Männer in Partnerschaften gibt es wenige. Zwei Betroffene klagen an: die Täter, den Staat, aber auch die Gesellschaft. Was muss sich in unser aller Köpfen ändern, um Gewalt gegen Frauen in Partnerschaften effektiver zu bekämpfen? (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 25.11.2019 Das Erste 288. GSG9 – Terror im Visier
Staffel 8, Folge 68Sie gelten als Deutschlands beste Spezialeinheit: die Männer der GSG9. Ihr Job ist gefährlich: Sie werden gerufen, um Terroristen oder schwer bewaffnete Kriminelle unschädlich zu machen. Im Einsatz verbergen sie ihre Gesichter hinter Masken. Niemand soll wissen, wer sie sind. Was sie tun, ist meist geheim. Die Autoren Patricia Corniciuc und Michael Götschenberg haben die Männer hinter den Masken kennengelernt. Sie haben erlebt, was es bedeutet, bei der GSG9 zu sein. Wie es zugeht in dieser Männerbastion, die geprägt ist von hoher Professionalität, Kameradschaft und Testosteron.Entstanden ist ein Film, der einen exklusiven Einblick in das Innenleben der Spezialeinheit bietet, wie es ihn bisher nicht gegeben hat. Im Fokus steht dabei nicht die Geschichte, geprägt durch die legendäre Befreiung der Geiseln in der „Landshut“ auf dem Flughafen von Mogadischu, sondern die GSG9 von heute. Was sie macht und wofür sie gebraucht wird, wie es sich anfühlt, diesen Job auszuführen. Zwischen 30 und 50 Mal pro Jahr ist die Einheit im Einsatz, in den meisten Fällen erfährt die Öffentlichkeit nichts davon. Permanent wird trainiert, denn im Einsatz müssen sich die Männer blind vertrauen können. Als einzige Spezialeinheit der Polizei darf die GSG9 auch im Ausland eingesetzt werden. Das Kamerateam konnte die GSG9 nach Israel zu einem Training mit der israelischen Antiterroreinheit Yamam begleiten. Was verbindet diese beiden Einheiten, die es mit völlig unterschiedlichen Bedingungen zu tun haben? Was können sie voneinander lernen? Der „Trainings-Weltmeister“, wie die Männer der GSG9 sich selbst bezeichnen, bereitet sich auch auf diese Weise auf immer neue Einsatzszenarien vor. In den vergangenen Jahren ist die Sicherheitslage immer komplexer geworden. Vor allem der islamistische Terrorismus, gewaltbereite Rechtsextremisten, aber auch schwer bewaffnete kriminelle Clans und Banden bedrohen unsere offene Gesellschaft. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem die Gefahr islamistisch motivierter Anschläge im Vordergrund stand, ist seit der Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke die Bedrohung durch Rechtsterroristen zunehmend in den Fokus gerückt. Dabei wird auch die Frage gestellt, in welchem Umfang Bundeswehr, Polizei und Spezialkräfte selbst ein Problem mit Rechtsextremisten in den eigenen Reihen haben. Hinweise auf Rechtsextremisten in der GSG9 gibt es aktuell nicht – aber wie geht man hier mit dieser Gefahr um? Die Spezialeinheit selbst steht aufgrund der zunehmend komplexen Sicherheitslage vor großen Veränderungen. Neben ihrem Hauptsitz im beschaulichen St. Augustin bei Bonn hat sie inzwischen auch einen weiteren Standort in Berlin. Seit dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und anderen islamistischen Anschlägen in Europa gilt die Hauptstadt als besonders gefährdet. Mit dem zusätzlichen Standort soll die GSG9 deutlich aufgestockt werden. Die Einheit in Berlin soll sich dabei vor allem auf Anschläge mit ABC-Waffen spezialisieren. Dabei gab es bisher in Deutschland nur einen einzigen Fall, wo ein Anschlag mit einer biologischen Waffe vorbereitet wurde: 2018 in Köln, mit hochgiftigem Rizin. Experten halten derartige Anschlagsszenarien jedoch für eine reale Bedrohung. Niemand weiß, ob es jemals dazu kommt. Wie sinnvoll ist es, sich auf dieses und andere immer neue Bedrohungsszenarien vorzubereiten? Gleichzeitig wird mit immer rigideren Sicherheitsgesetzen auf die Bedrohung durch den Terrorismus reagiert und damit Freiheitsrechte eingeschränkt. Findet die Politik die richtigen Antworten auf die Gefahren für unsere Sicherheit? Der Film bietet mehr als einen exklusiven Einblick in die sonst verschlossene Welt der GSG9: Er stellt die Frage, wie bedroht unsere Sicherheit tatsächlich ist und ob wir mit dieser Gefahr richtig umgehen. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 02.12.2019 Das Erste 289. Sterbehilfe – Politiker blockieren, Patienten verzweifeln
Staffel 8, Folge 69„Die ganze Menschheit überlegt: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich frage mich aber: Gibt es ein Leben vor dem Tod? Das Leben, das ich habe, das ist kein Leben mehr!“, sagt Harald Mayer. Das Leben des 48-jährigen ehemaligen Feuerwehrmannes vollzieht sich in totaler Abhängigkeit. Denn seine Krankheit, Multiple Sklerose, hat ihn vollkommen bewegungsunfähig gemacht. Für jeden Handschlag braucht er einen Pfleger: nachts, wenn er sich umdrehen will, zum Naseputzen, zum Tränentrocknen. „Ist das noch ein erträgliches Leben?“, fragt er und schiebt die Antwort hinterher: „Ich will gehen: selbstbestimmt!“ Deshalb hat er, wie mehr als hundert andere Menschen auch, einen Antrag auf die Herausgabe des Medikaments Natrium-Pentobarbital gestellt.Das Mittel verspricht ein schnelles Sterben – es schläfert ein und führt dann zum Tod. Harald Mayer ist überzeugt, dass seine Chancen gut stehen, das Medikament zu bekommen. Im März 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geurteilt, dass dieses Betäubungsmittel unter bestimmten Voraussetzungen herausgeben werden muss. Harald Mayer meint, er erfülle diese Voraussetzungen. Die zuständige Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte forderte von ihm zahlreiche Unterlagen und Gutachten. Für Harald Meyer eine teure, zeit- und kräfteraubende Angelegenheit. Die Anstrengungen nimmt er trotzt seiner schweren Krankheit auf sich in der Hoffnung, seinem Wunsch nach selbstbestimmten Sterben näher zu kommen. Lange hören er und die anderen Antragsteller nichts von der Behörde. Dann, mehr als ein Jahr nach dem Urteil, werden auf Weisung des Bundesgesundheitsministers plötzlich alle Anträge abgelehnt. Damit ignoriert Jens Spahn ein höchstrichterliches Urteil. Ein einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik. Stellt der Minister seine eigene politische Ansicht über die Rechtsprechung? Die Frage, wer über den eigenen Tod entscheidet, ist nicht nur eine ethisch schwierige Frage. Sie ist auch eine Probe für den Rechtsstaat. Wie Harald Mayer ist auch Elke J. an MS erkrankt. Sie hingegen fürchtet, dass eine Liberalisierung der Sterbehilfe die gesellschaftliche Solidarität mit schwerstkranken Menschen untergräbt. „Aber was ist, wenn ich nicht mehr selbst das Mittel zu mir nehmen kann? Warum muss ich dann am Ende auch noch qualvoll sterben?“, fragt Harald Mayer. „Die Story im Ersten: Sterbehilfe – Politiker blockieren, Patienten verzweifeln“ begleitet drei todkranke Antragssteller nahezu zwei Jahre lang auf dem in Deutschland inzwischen weitgehend versperrten Weg in einen selbstbestimmten Tod. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mo. 09.12.2019 Das Erste 290. Der Milliarden-Maurer vom Rhein
Staffel 8, Folge 70„Der König von Köln“ ist eine Satire, eine fiktionale Filmerzählung, die sich aber von realen Ereignissen in der Stadt am Rhein inspirieren ließ. Die anschließende Dokumentation erzählt die Hintergründe des tatsächlichen Geschehens – eines der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Angefangen hat Josef Esch aus dem rheinischen Troisdorf als Maurerpolier. Ein Mann aus kleinen Verhältnissen, bald ein kleiner Baulöwe an der Kölner Peripherie. Josef Esch schaffte den Aufstieg zu einem der größten und mächtigsten Immobilien-Entwickler und Vermögensverwalter des Landes.In den 90er Jahren stieg der Mann vom Bau in die ersten Kreise der Kölner Gesellschaft auf. Dabei behilflich waren die vornehmen Inhaber der größten europäischen Privatbank Salomon Oppenheim & Cie. In ihrem Umfeld lernte er das who-is-who des deutschen Geldadels kennen – vom Schuh-Milliardär Deichmann über den Bofrost-Gründer Boquoi bis zur Quelle-Erbin Schickedanz. Der Mann vom Bau kümmerte sich nicht nur um Geldanlagen, sondern nahm den Wohlhabenden und Einflussreichen auch allerlei andere Sorgen ab, besorgte auf Wunsch den passenden Handwerker ebenso wie die gewünschte Traumvilla oder Jacht und machte sich auf diese Weise unentbehrlich. Gemeinsam mit den Grafen und Baronen aus dem Hause Oppenheim legte Josef Esch milliardenschwere Immobilien-Fonds auf, die sogenannten Oppenheim-Esch-Fonds. Kernstück waren große Bauprojekte zusammen mit der öffentlichen Hand wie zum Beispiel der Neubau der Kölner Messe. Die Oppenheim-Esch-Fonds entwickelten sich zum Geheimtipp für Geldanlagen von Multimillionären und Milliardären. Die Renditen waren erstklassig – allerdings zu Lasten des Steuerzahlers, wie sich später zeigen sollte. Die große Esch-Sause endete für den Bau-Mogul und die Banker vor Gericht. Esch wurde wegen Steuerhinterziehung und unerlaubten Betreibens von Bankgeschäften, seine adeligen Geschäftspartner wegen schwerer Untreue verurteilt. Für die vornehme Privatbank Sal. Oppenheim endete das Abenteuer im Desaster. Ebenfalls mit von der Partie: Thomas Middelhoff, einst gefeierter Bertelsmann-Star und später vermeintlicher Karstadt-Retter. Er wurde am Ende wegen Untreue verurteilt, im Gerichtssaal verhaftet und ist inzwischen insolvent. Der Film seziert, wie trickreich Josef Esch an die Milliarden-Aufträge kam und welche Rolle die adligen Inhaber des Bankhauses Oppenheim dabei spielten; und wie schließlich die Warenhaus-Kette Karstadt in den Sog der Esch-Projekte und später ebenfalls in die Pleite geriet. Ein Skandal mit Star-Besetzung: in den Hauptrollen, der schillernde Investment-Star Thomas Middelhoff und die milliardenschwere Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz, die am Ende einen Großteil Ihres Vermögens verlor. Autoren sind Ingolf Gritschneder und Georg Wellmann, die auf eine zehnjährige Recherche zum Fall Josef Esch zurückgreifen können und zwischen 2005 und 2015 für den WDR zahlreiche preisgekrönte Dokumentationen dazu realisierten, die immer wieder bundesweit für Schlagzeilen sorgten. (Text: ARD) Deutsche TV-Premiere Mi. 11.12.2019 Das Erste
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Die Story im Ersten direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Die Story im Ersten und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail