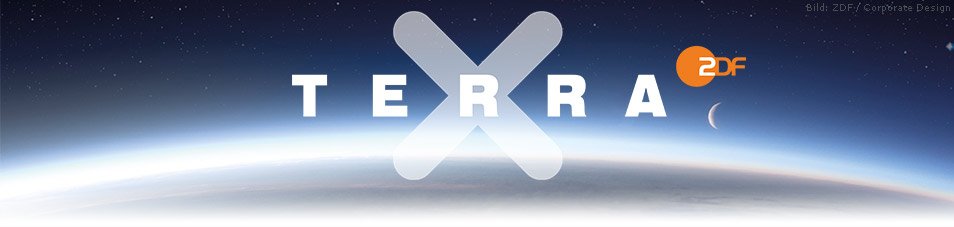1524 Folgen erfasst (Seite 7)
Die Deutsche Hanse – Eine heimliche Supermacht (2)
45 Min.Die zweiteilige „Terra X“-Dokumentation „Die Deutsche Hanse – Eine heimliche Supermacht“ erzählt vom Aufstieg eines weitgehend unbekannten und unterschätzten Wirtschaftsimperiums, das Europa prägte und in der europäischen Geschichte einzigartig ist: die Hanse. Ende des 14. Jahrhunderts haben die Koggen des mittelalterlichen Handelsbundes ein Weltreich erobert. Das Bündnis von freien Kaufleuten und Städten wird zu einer ökonomischen Supermacht mit Handelsverbindungen von Russland bis Spanien, von Venedig bis nach Island. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 08.05.2011 ZDF Die Deutschen: 01. Otto und das Reich
45 Min.Als Otto I. in der Pfalzkapelle von Aachen zum König gekrönt wurde, ließ er sich nach altem Brauch von den deutschen Fürsten huldigen. Um solche Ehrerbietung musste er künftig allerdings ringen, denn immer wieder lehnten sich die Territorialherrscher gegen den Monarchen auf. Würde es dem späteren Kaiser gelingen, dem aus den Stämmen der Sachsen, Bayern, Schwaben und Franken erwachsenden Volk ein eigenes Selbstbewusstsein zu geben, als Deutsche?Die vier Ur-Stämme auf deutschem Boden empfanden sich wohl erstmals im Jahre 955 als eine Schicksalsgemeinschaft: hervorgerufen durch einen aggressiven Feind von außen. Die Ungarn waren immer wieder zu räuberischen Streifzügen in das ostfränkische Reich Ottos I. eingedrungen. In der Schlacht auf dem Lechfeld bei Augsburg stellten sich Aufgebote der „deutschen“ Stämme den Angreifern entgegen und besiegten sie. Dieses Erlebnis einte, stärkte den Monarchen, schuf so etwas wie gemeinsame Identität. Otto I. ließ sich 962 in Rom vom Papst zum Kaiser krönen und blieb mit seinem Gefolge mehr als zehn Jahre in Italien. Dort wurden die Männer aus dem Norden, ob Franken oder Sachsen, von den Einheimischen pauschal „tedesci“ – „Deutsche“ – genannt – in Anlehnung an das germanische Wort „thiudisc“ – „die Sprache des Volkes redend“. Und erst allmählich nannten sich die Angehörigen der Stämme selbst so. Otto der Große galt nicht nur als Einiger, sondern auch Förderer des geistigen und kulturellen Lebens. Sein Reichskirchensystem stärkte den Klerus. Die Klöster erlebten ihre erste Blüte. Als Papst Johannes XII. Otto in Rom zum Kaiser krönte, verschmolz deutsches Königtum mit der Tradition christlich-römischen Kaisertums. Dies war nicht nur eine Zier, sondern auch eine Bürde, denn damit hatte er die Pflicht, außer deutschen Landen auch Papst und Kirche mitsamt Ländereien zu beschützen. Zum Kaisertum gehörten Territorien, die weit über die Mitte Europas hinausreichen, von Lothringen bis Mähren, von Friesland bis zur Mitte des italienischen Stiefels. Dieser Spagat deutscher Herrscher sollte die deutsche Geschichte über Jahrhunderte prägen. Die Historiker Stefan Weinfurter und Gerd Althoff nehmen zu der Frage Stellung, wie weit deutsche Identität seinerzeit ausgeprägt war. „Man sollte betonen, dass die Zeit Ottos des Großen mehrere Meilensteine auf dem Weg in Richtung auf eine deutsche Geschichte gesetzt hat“, sagt Althoff, „und die Meilensteine sind eben die Lechfeldschlacht und das Kaisertum. Und damit hat Otto der Große eigentlich genug für die deutsche Geschichte getan.“ Aufwändige szenische Darstellungen zur Lechfeld-Schlacht und zum „Reisekönigtum“ – mit David C. Bunners in der Rolle Ottos I. – die computergraphische Visualisierung des mittelalterlichen Magdeburg und anderer historischer Schauplätze vermitteln weitere Einblicke in die Zeit vor über tausend Jahren. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 26.10.2008 ZDF Die Deutschen: 02. Heinrich und der Papst
45 Min.Es ist der Moment der tiefsten Erniedrigung! Barfuß im Büßergewand kniet der deutsche König Heinrich IV. im Schnee vor der Burg Canossa und fleht um die Aufhebung des Kirchenbanns, den der Papst über ihn verhängt hat. Vergibt der Papst ihm nicht, verliert Heinrich seine Krone. Der „Gang nach Canossa“ steht seit Jahrhunderten sprichwörtlich für die schlimmste Selbsterniedrigung eines Kontrahenten in einer Auseinandersetzung. Doch was geschah wirklich im bitterkalten Winter des Jahres 1077? Hier fand eine Auseinandersetzung ihren Höhepunkt, die die mittelalterliche Welt erschüttert hatte. Im so genannten „Investiturstreit“ stritten Papst Gregor und der deutsche König Heinrich um nichts Geringeres als die beherrschende Machtposition in der christlichen Welt.Im Kern ging es um die Frage, ob der Papst über dem Kaiser steht oder der Kaiser über dem Papst. Als Heinrich ihm trotzig den Gehorsam verweigerte, belegte ihn der Pontifex mit dem Bann, was einer faktischen Absetzung gleichkam. Heinrich zahlte mit gleicher Münze heim und erkannte dem „falschen Mönch“, wie er den Papst nannte, die Amtsgewalt ab. Als sich die deutschen Fürsten auf die Seite des Papstes schlugen und gegen ihn stellten, musste der Salier-König einlenken. Durch Schnee und Eis begab er sich über die Alpen und fiel vor dem Papst in Canossa auf die Knie. Hatte so viel Demut das deutsche Königtum nicht beschädigt? Vielleicht war es auch eine historische Tat, mit der Heinrich IV. sein „regnum teutonicum“ zusammenhielt. Womöglich hätte der deutsche Hochadel das einende Band gelöst, falls der Monarch sich nicht unterworfen hätte. Heinrichs Rechnung jedenfalls ging auf. Indem er sich selbst erniedrigt hatte, rettete er seine Macht als deutscher König. Seinen Kontrahenten unter den Fürsten, den „Gegenkönig“ Rudolf von Rheinfelden, bezwang er auf dem Schlachtfeld. Welche Folgen der Konflikt von weltlicher und geistlicher Gewalt für die deutsche Geschichte hatte, dazu nehmen prominente Historiker Stellung. Computergrafisch wird das mittelalterliche Speyer rekonstruiert. Frühere Ausgrabungen im Speyerer Dom, bei denen Fotos vom Skelett Heinrichs IV. entstanden, ermöglichen Wissenschaftlern heute Aufschlüsse über das Leben und Aussehen des Herrschers. So sind die Spuren des „Reisekönigtums“, der Regentschaft aus dem Sattel, deutlich erkennbar. Die mumifizierte Hand seines Gegenspielers Rudolf von Rheinfelden ist ebenfalls erhalten. Sie ist das Relikt dramatischer Ereignisse aus dem Jahr 1080. Denn die Quellen überliefern, dass ihm die Schwurhand in der Schlacht gegen Heinrich abgeschlagen worden sei, was den Salier auch als moralischen Sieger dastehen ließ. Die Hand und ihre Geschichte wurde nun „durchleuchtet“. Im Auftrag des ZDF führte das Anthropologische Institut der Universität Mainz eine computertomografische Untersuchung durch. Das Ergebnis überrascht: Schnittspuren am Handgelenk belegen, dass die Abtrennung offenbar erst nach dem Tod Rudolfs erfolgte. Alles spricht für einen „Propaganda“-Coup im Konflikt vor mehr als neunhundert Jahren. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Di. 28.10.2008 ZDF Die Deutschen: 03. Barbarossa und der Löwe
45 Min.Für Höhepunkt und Niedergang des mittelalterlichen deutschen Kaisertums steht die Dynastie der Staufer. Friedrich I. (1152 bis 1190), „Barbarossa“ (Rotbart) genannt, galt schon zu Lebzeiten als glanzvoller, tatkräftiger, tugendhafter Herrscher, der für „die Ehre des Reiches“ kämpfte – als König von Deutschland, von Burgund und Italien sowie als Kaiser des Römischen Reiches. Hinzu kam, dass er seine Aufgabe als Schutzherr der Römischen Kirche besonders ernst nahm. So war er hin und her getrieben zwischen deutschen und internationalen Belangen. Wieder eskalierte der Konflikt mit dem Papst in Rom. Und auch die selbstbewussten Städte Oberitaliens setzten sich gegen den Herrschaftsanspruch der Deutschen zur Wehr.Der Machtkampf in Italien band Kräfte, ließ wiederum auf deutschem Boden die Territorialherrscher erstarken. Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Bayern, war Vetter, Gefolgsmann aber auch Gegner Friedrich Barbarossas. Er galt als skrupelloser Mehrer seiner Besitztümer, erschloss aber auch neue Ostgebiete für das Reich, betrieb eine planmäßige Siedlungspolitik und Christianisierung. Als Städtegründer machten sich „der Löwe“ wie auch Barbarossa einen Namen. Als der Herzog dem Kaiser die Gefolgschaft verweigerte, wurde er in die Verbannung geschickt. Vor dem Hintergrund der Kreuzzüge erlebte das Rittertum seine Blüte. Die Städte erhielten mehr Rechte. Das Bürgertum gewann an Bedeutung, ebenso Handwerk und Fernhandel, die deutsche Sprache entwickelte sich und ihre Lyrik (Walther von der Vogelweide oder wenig später Hartmann von Aue, der den ersten höfischen Roman in deutscher Sprache schrieb). Die Fürsten hüteten weiter ihre Eigenständigkeit. Sie wählten den König und regierten praktisch mit. Das sollte bis zum Ende des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ 1806 so bleiben. Höhepunkt des Filmes ist die szenische und computergrafische Rekonstruktion des legendären Mainzer Hoftages im Jahr 1184: „Dat was de groteste hochtit en, de ie em Dudischeme Land ward“, berichtet davon die Sächsische Weltchronik. Gemeint war das größte Fest des Mittelalters: 70 000 Besucher aus ganz Europa, eine riesige Zeltstadt mit Kathedrale und Stadion, Ritterspielen und Minnesang. Damit legte Kaiser Friedrich Barbarossa den Grundstein für die Verklärung seiner Person. Die Nachwelt sollte ihn als „größten Ritter“ unter den Kaisern verehren. Aber der Hoftag entpuppte sich als brüchige Fassade, ein Orkan machte dem spektakulären Schauspiel ein Ende. Der Sturm, der die Kulissen regelrecht hinwegfegte, markierte den Anfang vom Ende. Bald nach seinem Aufbruch zu einem Kreuzzug nach Jerusalem ertrank der Kaiser. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 02.11.2008 ZDF Die Deutschen: 04. Luther und die Nation
45 Min.Zunächst war er nur ein einfacher Mönch, ein zweifelnder und mit sich hadernder Theologe. Aus ihm wurde eine epochale Figur, die wie kein anderer zuvor die Deutschen einte und spaltete – ohne dies zu wollen. „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ lautete der Name, den das Staatengebilde in der Mitte Europas seit dem späten 15. Jahrhundert trug. Es war die Epoche des Habsburger Kaisers Karl V., der sich nach alter Tradition als Herrscher von Gottes Gnaden und Verteidiger der christlichen Einheit verstand. In seinem Reich gehe die Sonne nicht unter, sagte er im Jahr 1521 selbst – es reichte von Lateinamerika über Mitteleuropa bis zu den Philippinen. Die deutschen Territorien bildeten nur eines von vielen Königtümern, hier verfochten mächtige Kurfürsten ihre Eigeninteressen.Weltliche und geistliche Macht standen damals nach wie vor auf den Fundamenten des römischen Christentums. Doch ob Fürsten oder Stände, Bauern oder Bürger der Städte: Viele witterten im Laufe der Reformation die Chance, auf Distanz zu Rom und dem Kaiser zu gehen und ihre Stellung im Machtgefüge der Zeit zu verbessern. Anders als der Habsburger Karl V., der nicht einmal der deutschen Sprache mächtig war, entwickelte sich Luther zur Identifikationsfigur, wurde ungemein populär. Der Reformator war einer der ersten wirkungsmächtigen Zeitgenossen überhaupt, der explizit die deutsche Karte ausspielte und an nationale Gefühle appellierte: „Wie kämen die Deutschen dazu, sich die Räuberei und Schinderei durch Fremde gefallen zu lassen“, hieß es in einer Schrift. Luther übersetzte die Bibel ins Deutsche, verbreitete damit Sprache und Wissen, legte auch dadurch ein Fundament wachsender deutscher Identität. Die Menschen sollten in den Genuss kommen, „dass man deutsch mit ihnen redet“. Der religiöse mündete in den militärischen Konflikt. Um Frieden herzustellen, wurde entschieden, dass sich jeder Landesherr selbst für oder gegen die Reformation entscheiden konnte: „Cuius regio, eius religio“ lautete die spätere Formel. Nach dem Augsburger Religionsfrieden 1555 war die Unabhängigkeit der Fürsten gestärkt. Die Deutschen blieben im Glauben gespalten. Der Film richtet den Fokus auf die politische Figur Luther. Szenische Rekonstruktionen wie der Einzug Luthers in Worms, sein historischer Auftritt vor dem Reichstag, zum Machtkampf zwischen dem katholischen Kaiser und den protestantischen Fürsten vermitteln Einblicke in diese entscheidende Phase deutscher Geschichte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Di. 04.11.2008 ZDF Die Deutschen: 05. Wallenstein und der Krieg
45 Min.Der Friede zwischen den Konfessionen blieb brüchig. Weiterhin stritten Protestanten und Katholiken um die politische und religiöse Vorherrschaft im Reich und in Europa. Durch den Prager Fenstersturz 1618 eskalierte der Konflikt. Er mündete in den schrecklichsten aller Kriege auf deutschem Boden: den Dreißigjährigen Krieg, der die Bevölkerung dezimierte, das Land verwüstete und Deutschland zum europäischen Schlachtfeld machte.Ferdinand II., machtbewusster Vertreter der Gegenreformation und habsburgischer Herrschaftsansprüche auf den Kaiserthron, wollte in letzter Minute das Rad der Geschichte zurückdrehen, das hieß, die Macht des Kaisers gegenüber den Fürsten stärken und den Protestantismus gewaltsam eindämmen. Das dazu notwendige Heer beschaffte ihm der böhmische Landedelmann und Kriegs-organisator Albrecht von Wallenstein. Unter seinem Kommando wurde die kaiserlich-katholische Herrschaft wieder bis an die norddeutschen Meere vor-geschoben, bis Schweden auf der Seite der Protestanten eingriff – ein entscheidender Wendepunkt. Die Truppen Gustavs II. Adolf drangen bis in den Süden Deutschlands vor. Der Generalissimus gelangte in Anbetracht der Eskalation zu der Einsicht, dass sich der Krieg als Geschäft nicht mehr lohnt und dass nur ein Ausgleich zwischen den Mächten und den Konfessionen dem Gemetzel ein Ende setzen konnte. Man warf ihm Verrat vor. 1634 wurde er ermordet. Bereits ein Jahr später kam es in Prag zu einem vom Kaiser und von den Fürsten ausgehandelten Frieden „für das geliebte Vaterland der hochedlen Teutschen Nation“. In einer nationalen Aufwallung beschlossen die deutschen Fürsten, Protestanten und Katholiken, nie wieder gegeneinander zu kämpfen. Doch einmal mehr zeigte sich, dass ein deutscher Alleingang von den Mächten in Europa nicht hingenommen wurde. Die Franzosen sahen das Gleichgewicht in Gefahr, wollten die mächtigen Habsburger, von denen sie sich umklammert fühlten, schwächen und ihren eigenen Einfluss auf die Mitte Europas sichern. Das Gemetzel dauerte noch weitere 13 Jahre, bis ein europäischer Kongress endlich Frieden stiften sollte. Im Westfälischen Frieden 1648 strebten die Unterzeichner eine Balance in der Mitte Europas an, um die machtpolitischen und religiösen Gegensätze auszugleichen. Die konfessionelle und vielfältige territoriale Teilung Deutschlands wurde festgeschrieben. Am Ende war das deutsche Kaisertum geschwächt, die Stellung der Fürsten gestärkt, der Einfluss der Nachbarn gesichert. All das war der Preis für den ersehnten europäischen Frieden, der zwar nicht künftige Kriege, aber ein „fundamentalistisches“ Inferno wie in den Jahren zuvor verhindern konnte. Es war ein Schritt hin zum modernen Völkerrecht. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 09.11.2008 ZDF Die Deutschen: 06. Preußens Friedrich und die Kaiserin
45 Min.Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation glich nach dem Dreißigjährigen Krieg einem territorialen Puzzle. All das wirkte einer nationalen Entwicklung nach westeuropäischem Muster entgegen. Weil eine zentrale Gewalt fehlte, bildeten sich neue Mächte an der Peripherie heraus. Mit dem Erstarken Brandenburg-Preußens änderte sich das Gleichgewicht im Reich. Außerhalb seiner Grenzen entstanden weitere deutsche Gebiete. Während das Herzogtum Preußen, das der aufstrebenden Macht den Namen gab, nicht zum römischdeutschen Imperium gehörte, zählte Brandenburg dazu. Auch Österreich-Ungarn ragte weit über alte Reichsgrenzen hinaus, weitete sich nach Südosten aus. Die Habsburger verfügten über Territorien in ganz Europa und darüber hinaus.Österreich war schon eine Großmacht, Preußen wollte es noch werden. Es kam zu einer dramatischen Rivalität zweier Monarchen, die unterschiedlicher kaum sein konnten: die lebensfrohe Habsburgerin Maria Theresia aus dem katholischen Wien und der verschlossene Hohenzollern-König Friedrich II. aus dem protestantischen Potsdam. Die eine baute das gigantische Schloss Schönbrunn nach dem Vorbild von Versailles, der andere ließ sich das kleine Rokokoschloss Sanssouci errichten. Zwei Regenten, die sich nie persönlich begegneten. Beide wollten uneingeschränkte Alleinherrscher sein, aber keine Despoten. Ihrem eigenen Staat zu dienen hielten sie für ihre oberste Pflicht. Die Interessen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation aber waren zweitrangig. Der Konflikt der beiden Mächte gipfelte im Siebenjährigen Krieg, der Tod und Verwüstung nach Deutschland trug: Erst der Hubertusburger Frieden von 1763 beendete das zähe Ringen um die Vorherrschaft im Reich, die letztlich keine Seite erlangen konnte. Unter beiden Regentschaften herrschten kulturelle Blüte und Vielfalt. Johann Sebastian Bach komponierte Musik für Friedrich den Großen, in den vielen kleinen Territorien gab es viele kleine Mäzene, die ihre Architekten, Poeten, Maler und Musiker beschäftigten. Es war die Zeit des aufkommenden Sturm und Drang, Lessing, Goethe und Schiller verfassten zeitlose Werke. Hier liegen die Anfänge der deutschen Kulturnation. Der „Dualismus“ der beiden Mächte – verkörpert durch die Herrscher Friedrich II. „der Große“ und Maria Theresia – läutete schließlich das Ende des alten Reiches ein und bestimmte die deutsche Geschichte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Di. 11.11.2008 ZDF Die Deutschen: 07. Napoleon und die Deutschen
45 Min.Ausgerechnet ein fremder Kaiser, Frankreichs Jahrhundertherrscher Napoleon, katapultierte die Deutschen durch Eroberungen und Reformen in ihr nationales Zeitalter. Kein anderer zuvor hatte mehr dazu beigetragen, dass die Deutschen zueinander fanden – auch wenn dies geschah, um Napoleon selbst los zu werden. Was ihm gelang, hatte niemand zuvor erreicht – ein historisches Paradoxon: die politische Erweckung der „deutschen Nation“.Am Anfang stand der Untergang. Das alte römisch-deutsche Reich war nach dem Siebenjährigen Krieg durch die Machterweiterung der Einzelstaaten weithin ausgehöhlt. Deutschland war ein kultureller, ein geografischer, aber kaum mehr ein politischer Begriff. Dann kam die Zeitenwende: die Revolution in Frankreich 1789 und schließlich Napoleon. Der Eroberer wühlte ganz Europa auf, veränderte die Landkarte, erzwang die Abdankung des Habsburgers Franz II. als römisch-deutschen Kaiser und gab dem alten Reich den Todesstoß. Bonaparte sorgte – im Verbund mit deutschen Fürsten, die er für sich gewinnen konnte – für eine gründliche Flurbereinigung auf deutschem Boden. Unter seinem Druck wurden aus vielen Teilstaaten wenige. Er schaffte sich 1806 mit dem so genannten „Rheinbund“ ein deutsches Protektorat – unter Ausschluss Preußens und Österreichs. In den deutschen Staaten fanden grundlegende Reformen statt – mit und gegen Napoleon: Nur wenn das Volk sich mit dem Staat identifiziere, sei dieser in der Lage, sich – auch militärisch – zu behaupten, so dachten Männer wie der Freiherr vom Stein, einer der prominentesten „preußischen Reformer“ und der Antagonist Napoleons auf deutschem Boden. Stein und andere wollten durch mehr Freiheit und Mitbestimmung Kräfte wecken, aus Untertanen patriotische Bürger machen, aus Berufssoldaten eine Volksarmee, die Bonaparte die Stirn bieten sollte. Der Korse selbst hatte den Deutschen vor Augen geführt, was ein Staat bewirken kann, wenn das Volk hinter ihm steht. Der Freiherr vom Stein war ein entscheidender Gegenspieler Napoleons und wird als solcher erstmals in einem Film dargestellt. Seine große Stunde schlug, als sich Bonaparte im Juni 1812 in sein größtes militärisches Abenteuer stürzte. Der französische Kaiser marschierte mit 600 000 Soldaten in Russland ein. Mehr als ein Drittel seiner Truppen waren Deutsche. Doch führte der Drang zur Weltmacht in die militärische Katastrophe. In den Befreiungskriegen gegen Napoleon entstand auf deutschem Boden ein neues Wir-Gefühl. Immer mehr Deutsche entdeckten sich als eine durch Kultur, Sprache und Geschichte verbundene Nation, die künftig unter ein Dach gehöre. Demütigungen durch Napoleon hatten eine nationale Stimmung provoziert, die mancherorts auch in derbe nationalistische Agitation umschlug. Die „Völkerschlacht“ bei Leipzig 1813 war der Anfang vom Ende. Mit „Waterloo“ war Napoleons Schicksal besiegelt. Auf dem Wiener Kongress wurde über die Zukunft Deutschlands und Europas entschieden. Träumten manche deutsche Bürger seit den Befreiungskriegen von der nationalen Einheit, kam es nun lediglich zu einem lockeren Zusammenschluss von 35 souveränen Fürsten und vier freien Städten. Die Monarchen hatten das Sagen im so genannten „Deutschen Bund“ von 1815. Doch war es möglich, das Rad der Geschichte anzuhalten? Dafür hatte sich zu viel in den vergangenen zwei Jahrzehnten verändert. Besonders das deutsche Staatensystem ging aus der Napoleonzeit verjüngt und modernisiert hervor. Deutschland hatte nun einen festeren Zusammenhalt in den vergrößerten Einzelstaaten. Die Grundlagen des modernen Staates als Rechtsstaat waren – vor allem unter französischem Einfluss – vielfältig geschaffen worden. Alle Kräfte, die die weitere Entwicklung in Deutschland beeinflussen sollten, nationale und liberale, waren in Bewegung geraten. Ihr Ziel hieß: Freiheit und Einheit. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 16.11.2008 ZDF Die Deutschen: 08. Robert Blum und die Revolution
45 Min.Eine Revolution – in Deutschland? Und zwar keineswegs, wie Lenin den Deutschen später süffisant nachsagte, mit einer ordnungsgemäßen Bahnsteigkarte in der Tasche. Im März 1848 wurden aus braven Untertanen entschiedene Barrikadenkämpfer – ob in Wien, Berlin oder anderen Städten. Es war ein Volksaufstand, wie es ihn nie zuvor in der deutschen Geschichte gegeben hatte. Bürgerdelegationen drängten die Obrigkeit zu weit reichenden Zugeständnissen; Bauern verbrannten die Grundbücher ihrer Gutsherren; Tagelöhner, Handwerker und Studenten lieferten sich blutige Straßenschlachten mit fürstlichen Soldaten.Freiheit und Einheit, das waren die Ziele vieler Deutscher, die genug hatten von polizeistaatlicher Bevormundung und Fremdbestimmung – unter ihnen auch der liberale Leipziger Stadtverordnete Robert Blum. Der Funke eines Volksaufstandes in Paris hatte im März 1848 auch in den deutschen Staaten die revolutionäre Begeisterung entzündet. Mit Gewalt ließ sich der Flächenbrand bald nicht mehr eindämmen. Die Fürsten sahen sich gezwungen, ihre Regierungen auszutauschen und Mitsprache zu gewähren. Zum ersten Mal trat am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche eine frei gewählte Nationalversammlung zusammen, um über Grundrechte und die nationale Einheit zu beraten. Unbeschadet nachträglicher Abwertungen war damit eine politische Sensation geschehen: Das bis dahin zersplitterte und monarchisch regierte Deutschland hatte aus der Mitte des Volkes ein gemeinsames Parlament geschaffen, in dem Volksvertreter aus allen Landesteilen freimütig über die Schicksalsfragen der Nation berieten. Dies war die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland – bei allem nachfolgenden Ringen um die Ausgestaltung der Verfassung und der Grenzen. Einer der maßgeblichen Wortführer der Paulskirche war Robert Blum. Geradezu prototypisch stehen sein Werdegang und sein Wirken für das revolutionäre Ringen um mehr Demokratie. Mit Leidenschaft und Charisma kämpfte er für eine echte Teilhabe des Volkes an der Macht und glaubte dabei fest an einen friedlichen Wandel auf dem Boden von Recht und Verfassung. Doch als die Ideen des Fortschritts von den Bajonetten der wieder erstarkten Militärmacht wieder zurückgedrängt wurden, fasste Robert Blum einen folgenschweren Entschluss. In Wien, wohin er den Bundesbrüdern zu Hilfe geeilt war, rang er sich schließlich dazu durch, für seine Vision mit der Waffe in der Hand zu kämpfen – und bezahlte dafür mit seinem Leben. Stellvertretend für die demokratische Bewegung wurde der Freiheitskämpfer von kaiserlichen Soldaten erschossen. Damals wurde er wie ein Märtyrer verehrt. Heute ist Robert Blum weithin vergessen – zu Unrecht. Schließlich hatten Vordenker wie er das Feld bereitet, auf dem später Einheit und Freiheit gedeihen konnten. Auf der Grundlage des bewegenden Briefwechsels zwischen Blum und seiner Frau, mit authentischen Dokumenten, Zeichnungen und Zeugnissen, in eindringlichen szenischen Darstellungen und illustriert mit detailgetreuen Computeranimationen, beschreibt der Film den tragischen Werdegang einer historischen Lichtgestalt in Umbruchzeiten, die den Verlauf der deutschen Geschichte nachhaltig prägten. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Di. 18.11.2008 ZDF Die Deutschen: 09. Bismarck und das Deutsche Reich
45 Min.Nach der Revolution von 1848, dem vergeblichen Versuch einer „Einheit von unten“, kam es nun zur „Einheit von oben“. Preußens Ministerpräsident Otto von Bismarck ebnete den Weg zum ersten deutschen Nationalstaat. „Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse würden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Blut und Eisen“, hatte der eigensinnige Politiker einst formuliert, doch einen konkreten Plan zur deutschen Einigung hatte Bismarck nicht: „Erreicht Deutschland sein nationales Ziel noch im 19. Jahrhundert, so erscheint mir das als etwas Großes, und wäre es in zehn oder gar fünfzehn Jahren, so wäre das etwas Außerordentliches, ein unverhofftes Gnadengeschenk von Gott“, sagte er drei Jahre vor der Staatsgründung 1871. Die deutsche Einigung war somit alles andere als vorherbestimmt, wie preußische Historiker später glauben machen wollten.Zudem hatte die „Nation“ für Bismarck keinen Selbstwert, sie diente ihm vor allem als Vehikel zur Mehrung der Macht Preußens und auch der eigenen. Im Jahr 1866 wurde ein Pistolen-Attentat auf ihn verübt, der Student Ferdinand Cohen-Blind traf Bismarck mit zwei Kugeln. Wäre Bismarck damals gestorben, so Historiker, hätte dies den weiteren Verlauf der Geschichte entscheidend verändern können. Mehr als ein Jahrhundert lang hatte der Dualismus Preußen-Österreich die Politik bestimmt. 1866 kam es zum Bruderkrieg. In der Schlacht von Königgrätz siegte überraschend Preußen dank der Eisenbahn und eines besseren Gewehrs, Österreich wurde damit förmlich aus der deutschen Geschichte gedrängt. Der Norddeutsche Bund von 1866, unter preußischer Führung, war die Vorstufe zum geeinten Deutschland wenige Jahre später – die südlichen Länder wie Bayern, Baden und Württemberg blieben zunächst außen vor. Das änderte sich mit dem Krieg gegen Frankreich 1870. Der gemeinsame Gegner schmiedete die Deutschen zusammen. Im Januar 1871 hob Bismarck – im Schloss von Versailles – den preußisch-deutschen Nationalstaat aus der Taufe. Die nationale Hochstimmung der Bevölkerung mag sogar den Staatsgründer selbst überrascht haben. Gerade die öffentliche Meinung hat einen derartigen Druck auf die Kabinette der süddeutschen Staaten ausgeübt, dass der Zusammenschluss mit dem Norddeutschen Bund geradezu alternativlos erschien. Das von Bismarck geschaffene Reich war das erste geeinte Deutschland, aber es war ein Fürstenbund. Nicht das Volk war der Souverän, die Reichs-Regierung wurde nicht vom Parlament gewählt. Würde auf die äußere auch die innere Einheit folgen? Der Kulturkampf und die Sozialistengesetze Bismarcks spalteten die Gesellschaft. National gestimmte Publizisten und Verbände sowie Vertreter der boomenden Wirtschaft forderten koloniale Expansion, stießen damit auf Vorbehalte des Kanzlers. Aus der Sicht des erfahrenen Staatsmanns und Diplomaten sollte das Reich sich selbst genügen. Er dachte in den Dimensionen des europäischen Gleichgewichts. Für ihn war Deutschland „saturiert“, gerade groß genug, um – neben Frankreich – nicht noch andere Gegner auf den Plan zu rufen. Seine Bündnispolitik ist ein Paradebeispiel für den Umgang mit der sensiblen deutschen Mittellage. Doch sollte es bald allzu viele Stimmen geben, die meinten, Deutschland müsse unbedingt Weltmacht sein. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 23.11.2008 ZDF Die Deutschen: 10. Wilhelm und die Welt
45 Min.„Zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe ich Euch entgegen“, verkündete der junge Hohenzollern-Kaiser Wilhelm II. 1892 – zu Beginn der Epoche, die später nach ihm benannt wurde. Er entpuppte sich als prunksüchtiger Monarch, selbstverliebt und betont forsch. Für die Mehrheit des deutschen Bürgertums aber wurde er zum Sinnbild eigenen Strebens nach Glanz und Größe. Der Liberale Friedrich Naumann meinte gar: „Dieser Kaiser, über den ihr euch aufregt, ist euer Spiegelbild!“ Die Fassade von Pickelhauben und Paraden war symptomatisch für die „verspätete Nation“.Der Pomp überspielte vieles. Die „innere“ Einigung Deutschlands war ins Stocken geraten, der junge Staat blieb in sich gespalten. Alte territoriale wie konfessionelle Gegensätze boten Konfliktstoff, im industriellen Aufschwung taten sich tiefe soziale Gräben auf. Der Reichstag, allen voran die stark anwachsende Sozialdemokratie, forderte mit der Zeit ein Ende des „persönlichen Regiments“ Wilhelms II. Der Kaiser beschimpfte die Partei der Linken als „Vaterlandslose Gesellen“. Allerdings reklamierten auch SPD-Abgeordnete wie Philipp Scheidemann das deutsche Vaterland für sich: Durch die Politik des Monarchen sei der Bestand, die Einheit und der Frieden des Reiches gefährdet, sagte er. In dem Werdegang des prominenten Sozialdemokraten und des letzten deutschen Kaisers spiegelte sich vieles, was die Deutschen damals einte und trennte. Erstmals werden die gegensätzlichen Rollen und Charaktere, die Wilhelms II. und Scheidemanns, in einem Film dargestellt. Wilhelm II. verfolgt andere Visionen als der Gründungskanzler Bismarck. Dieser hatte der Welt vor Augen führen wollen, dass sich der neu gegründete Staat friedlich in das Konzert der Mächte einfügen konnte. Der junge Hohenzoller aber wollte Kaiser einer Weltmacht sein, die mit den anderen Großmächten mithalten konnte. Am deutschen Wesen, hieß es in nationalistischen Kreisen, solle die Welt genesen, notfalls unter militärischem Druck. So bildete sich ein internationales Bündnis gegen Wilhelms Reich. Deutschland fühlte sich von seinen Nachbarn eingekreist. Tatsächlich kreiste es sich allmählich aus. Die Mächte in Europa rechneten mit dem großen Schlagabtausch, und sie verhinderten ihn nicht, als der Kontinent der Katastrophe entgegen taumelte. Der Kaiser und die Opposition schlossen im Angesicht des Krieges „Burgfrieden“ – vorläufig. Der Erste Weltkrieg wurde zum ersten industriellen Vernichtungskrieg, zur Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Der mörderische Grabenkampf, vor allem an der Westfront, übertraf an Grausamkeit, an menschlicher Verrohung selbst die schlimmsten Ahnungen. Hier wuchs die Saat für eine Zeit, in der der Mensch nur noch als Material galt. 1918 war das deutsche Heer am Ende, und selbst die Generäle hatten das begriffen. Eingestehen wollten sie es freilich nicht – zumindest nicht vor der Nation. Wilhelm II. weigerte sich abzudanken. Erst der Druck der Straße vermochte das Kaisertum zu beseitigen. „Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die deutsche Republik!“, rief am 9. November 1918 der SPD-Fraktionsvorsitzende Philipp Scheidemann aus. Die erste Demokratie auf deutschem Boden entstand – doch die Bürden der Vergangenheit wogen schwer. Nach dem Krieg drängten einige Nachbarn auf eine Niederhaltung Deutschlands, es wurde mit seinen Verbündeten zum Kriegsschuldigen erklärt. Nicht der deutsche Kaiser und seine Militärs, die den Krieg geführt hatten, sondern Vertreter der jungen Weimarer Demokratie waren gezwungen, den Versailler Vertrag zu unterschreiben. Das diskreditierte die gerade erst gegründete deutsche Republik in den Augen vieler. Deutschland sollte nach dem Krieg für 70 Jahre nicht zur Ruhe kommen. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Di. 25.11.2008 ZDF Die Deutschen: 11. Karl der Große und die Sachsen
45 Min.Er galt schon bei seinen Zeitgenossen als ‚Vater Europas‘: Karl der Große (vermutlich 748–814). Er schuf ein Fundament, das den Kontinent prägte. Deutsche und Franzosen betrachten den legendären Karolinger gleichermaßen als Stammvater. Karls Imperium reichte von der Nordsee bis nach Mittelitalien, von Ungarn bis nach Spanien. Der Umriss erinnert an die Ausdehnung der europäischen ‚Sechsergemeinschaft‘ 1200 Jahre später. Der Frankenherrscher schuf nicht nur ein Imperium, er gab ihm auch eine Ordnung, setzte Ankerpunkte für eine gemeinsame religiöse und kulturelle Identität.Er wollte nicht nur Herrscher der Franken sein, sondern der gesamten römischen Christenheit. Wo er regierte, sollte auch ein Glaube die Teile seines europäischen Reiches miteinander verbinden. Am Weihnachtstag im Jahr 800 wurde er in Rom zum Kaiser gekrönt. Die römische Kaiserwürde und Reichsidee gingen damit auf das fränkische Herrscher- haus über. Daran konnten später die ostfränkischen und dann die deutschen Könige anknüpfen. Die Grundlage für ein späteres Reich der Deutschen schuf Karl auch durch seine Eroberungen in der Mitte Europas. Dreißig Jahre lang hatte er Krieg gegen die Sachsen geführt, bis er sie schließlich blutig unterwarf und zwang, Christen zu werden. Mit ihrer Eingliederung verschob sich der Schwerpunkt des Frankenreichs nach Osten. Nachdem sich das Imperium Karls ein Jahrhundert später endgültig in ein West- und in ein Ostreich geteilt hatte, waren es ausgerechnet die Nachfahren der einst heidnischen Sachsen, die genug Macht, Willen und Einfluss besaßen, um in die Fußstapfen des großen Karolingers zu treten. So erwarb Otto der Große als von den deutschen Stämmen gewählter ‚ostfränkischer‘ König die Kaiserkrone und legte damit den Grundstock zur Entwicklung der römisch-deutschen Tradition. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 13.11.2010 ZDFneo Die Deutschen: 12. Friedrich II. und der Kreuzzug
45 Min.‚Das Staunen der Welt‘ nannten manche Zeitgenossen den Staufer Friedrich II. (1194 bis 1250), dessen Reich von Sizilien bis zur Nordseeküste reichte. Neben Deutsch sprach er Italienisch, Französisch, Griechisch und Arabisch, dichtete, philosophierte und schrieb ein Buch über die Falkenjagd. Als Kleinkind besaß er schon die deutsche Königswürde, seine Mutter Konstanze von Sizilien ließ ihn dort zum Monarchen krönen. Auf deutschem Boden tobte ein erbitterter Thronstreit zwischen Staufern und Welfen. Wieder einmal war das Fürstenlager gespalten, und der Papst mischte mit.Später eroberte Friedrich die Herrschaft im Norden zurück. Seine Heimat aber blieb Italien. Er lebte die meiste Zeit außerhalb deutscher Lande und machte auch keinen Hehl aus seiner Vorliebe für den Süden. Herkunft, Wesen und Auftreten ließen ihn in Deutschland zu einem Fremden werden, und doch fühlten sich dort viele zu diesem exotisch anmutenden Monarchen auf seltsame Weise hingezogen. Friedrich regierte das Land vor allem durch die Verteilung von Privilegien, was die Fragmentierung des Reiches und die Selbstständigkeit der Landesherren förderte. Nach langem Zögern unternahm Friedrich II. einen Kreuzzug ins Heilige Land. Großes Interesse zeigte der Staufer an der arabischen Kultur und Wissenschaft. Als einzigem Herrscher dieser Zeit gelang es Friedrich II., das Heilige Grab in Jerusalem ohne einen einzigen Schwertstreich zu erobern. Allein durch sein Verhandlungsgeschick und seine Kompromissfähigkeit brachte er Sultan al-Kamil dazu, ihm Jerusalem, Bethlehem und Nazareth in einem Waffenstillstand zuzubilligen. Doch andere Kreuzfahrer wollten den ‚Heiligen Krieg‘ im Namen der Christenheit fortsetzen. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 13.11.2010 ZDFneo Die Deutschen: 13. Hildegard von Bingen und die Macht der Frauen
45 Min.Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) ist die populärste Deutsche des Mittelalters – auf Augenhöhe mit den Mächtigen ihrer Zeit. Sie war Visionärin, Naturwissenschaftlerin, Politikerin, Komponistin, Theologin und sogar Managerin zweier von ihr gegründeter Klöster. Viele ihrer Schriften, vor allem ihre Kenntnisse der Naturheilkunde, haben bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. Andere werfen noch immer Fragen auf. Während die einen in Hildegards Visionen eine Art Drogenrausch der Kräuterkundigen vermuten, sehen andere darin eine prophetische Gabe, sogar einen Beweis ihrer Heiligkeit.Besondere Nähe zu Gott für sich zu beanspruchen, war nicht ungefährlich. Ihren Mut schöpfte sie aus religiösem Sendungsbewusstsein. Hildegards Visionen waren ein mächtiges Instrument für eine Frau in einer Zeit, in der das weibliche Geschlecht komplett unter männlicher Verfügungsgewalt stand. Sie schaffte es, dass der Papst selbst ihre Visionen anerkannte, und enthob sich damit des Verdachtes, eine Ketzerin zu sein. Aus heutiger Sicht besonders bahnbrechend war ihre Wahrnehmung der Natur, in der sie ein Spiegelbild der göttlichen Weltordnung sah. Die „erste Grüne“ der Geschichte könnte man sie nennen. Auch den menschlichen Körper und die Sexualität beschrieb sie eingehend und mit großer Unbefangenheit. Von Hildegard von Bingen stammt die vermutlich erste und für eine Nonne bemerkenswert detaillierte Beschreibung des weiblichen Orgasmus. Der Film über das Leben Hildegards von Bingen zeichnet das Bild einer Frau, die viele Grenzen sprengte. Und er zeigt ein Jahrhundert, dessen technische und soziale Umwälzungen den Grundstein für die Moderne legten. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 21.11.2010 ZDF Die Deutschen: 14. Karl IV. und der Schwarze Tod
45 Min.Die Regierungszeit Karls IV. (1316 bis 1378) zählt zu den dramatischsten Epochen der deutschen Geschichte. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts rafft die Pest ein Drittel der Deutschen dahin. Der König, der in dieser Schreckenszeit regierte, entstammte der Dynastie der Luxemburger. Karl IV. wurde 1316 in Prag geboren. Sein Vater Johann hatte eine böhmische Prinzessin geheiratet und war dadurch einer der mächtigsten Männer im Reich geworden. 1346 gelang es dem ehrgeizigen Luxemburger durch die Zahlung horrender Bestechungsgelder, seinen Sohn Karl als Gegenkönig zum amtierenden Ludwig dem Bayern wählen zu lassen.Karls Position im Reich war zunächst schwach, aber durch den plötzlichen Tod Ludwigs wenige Monate nach der Wahl änderte sich die Lage. Durch geschicktes politisches Taktieren, strategische Eheschließungen und nicht zuletzt durch die Veräußerung königlicher Privilegien sorgte Karl IV. für Frieden und konsolidierte seine Herrschaft. Als das Reich im Innern gefestigt war, brach er 1354 zu einem Italienzug auf und errang die Kaiserkrone. Kurz danach hielt er einen Reichstag in Nürnberg ab, bei dem die Modalitäten der Königswahl ein für alle Mal festgeschrieben werden sollten. Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Kaiser und Fürsten ging als „Goldene Bulle“ in die Geschichte ein und wurde am 10. Januar 1356 öffentlich in Nürnberg verkündet. Die Goldene Bulle legte fest, dass zukünftig drei Erzbischöfe und vier weltliche Fürsten den König mit einfacher Mehrheit wählen sollten. Eine Art „Grundgesetz“ des Heiligen Römischen Reiches entstand, das bis zu seinem Untergang 1806 gültig blieb. Unter Karl IV. erlebte Mitteleuropa eine kulturelle Blüte. Aber seine Regierungszeit stand gleichzeitig im Schatten der schlimmsten Katastrophe des Mittelalters, der Pest. „Schuldige“ waren rasch gefunden: die Juden. Als Geldverleiher waren sie zwar unverzichtbar für die mittelalterliche Wirtschaft, aber gleichzeitig verhasst und sozial ausgegrenzt. Als angebliche „Brunnenvergifter“ wurden sie für die verheerende Seuche verantwortlich gemacht und zu Tausenden verbrannt. Dass mit den Juden oft auch ihre Schuldscheine verbrannt wurden, wirft ein bezeichnendes Licht auf die wahren Motive der Täter. Kaiser Karl IV. versagte in der königlichen Pflicht, seine Untertanen vor den Übergriffen zu schützen, und profitierte sogar von der Ermordung der Juden. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Di. 23.11.2010 ZDF Die Deutschen: 15. Thomas Müntzer und der Krieg der Bauern
45 Min.Es war die Zeit der Umwälzung, die Reformation rüttelte an der bestehenden Ordnung. 1521 herrschte Aufruhr im sächsischen Zwickau: Der junge Priester Thomas Müntzer (1489 bis 1525), der an der Marienkirche predigte, wandte sich gegen die kirchliche und weltliche Obrigkeit und forderte für alle Menschen das gottgegebene Recht auf Freiheit und Gleichheit. Müntzer war kein Mann der Kompromisse. Die Kirchenkritik Luthers, den er einst bewundert hatte, ging ihm nicht weit genug. Nicht nur das Papsttum, auch die ständisch geprägte weltliche Ordnung war ihm ein Dorn im Auge.Christus sei in einem Viehstall geboren, schrieb er, er sei auf der Seite der Armen und Entrechteten. Die Fürsten, die in Pelzmäntel gekleidet auf Seidenkissen säßen, seien „Christo ain greuel“. In einer Schrift „wider das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg“ nahm er 1524 gegen Luther Stellung und bekräftigte seine Absicht, eine gerechtere Ordnung durchzusetzen – notfalls mit Gewalt. Nach Müntzers theologischer Überzeugung fordert die Heilige Schrift die Freiheit des Menschen. Er wurde von den Fürsten misstrauisch beäugt und geriet immer wieder in Konflikt mit der Obrigkeit. Als 1524 der Deutsche Bauernkrieg ausbrach, schlug Müntzer sich auf die Seite der Landleute. Bald wurde er zu einer Leitfigur des Aufstands. Seinen blutigen Höhepunkt erreichte der Konflikt mit den Landesherren in der Schlacht von Frankenhausen. Der Kampf mit ungleichen Waffen, Musketen gegen Mistgabeln, geriet zum Massaker. Die Niederlage der Bauern besiegelte auch Müntzers Schicksal. Als Bauernfüher und Ketzer gefoltert, wurde er 1525 vor den Toren der Stadt Mühlhausen hingerichtet. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.11.2010 ZDFneo Die Deutschen: 16. August der Starke und die Liebe
45 Min.Er gilt als einer der schillernden Monarchen der Neuzeit: Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, genannt ‚August der Starke‘ (1670 bis 1733). Seine fürstliche Selbstdarstellung war nur mit der eines anderen europäischen Monarchen vergleichbar: Ludwigs XIV. Der Hof Augusts sollte dem des französischen Sonnenkönigs in nichts nachstehen. Hunderte Feste, Bälle, Maskeraden und Tierhatzen veranstaltete der König jedes Jahr. Dem 1,76 Meter großen und 121 Kilogramm schweren August eilte sein Ruf als ‚der Starke‘ weit voraus. Der ‚sächsische Herkules‘ soll Hufeisen mit bloßen Händen zerbrochen haben.Bekannt wurde er als Mann, der schöne Frauen liebte. Mehr als ein Dutzend Mätressen des lebensfrohen Monarchen sind bekannt, zahlreiche uneheliche Nachkommen hat er mit ihnen gezeugt. Nur ein Sohn entstammte seiner Ehe mit Christiane Eberhardine von Brandenburg-Bayreuth. Keine seiner Mätressen übertrifft die Gräfin Cosel an Ruhm. Mit ihr teilte er mehr als zehn Jahre sein Bett, bevor sie ein tragisches Schicksal ereilte: Weil sie sich zu sehr in die Politik einmischte, wurde sie auf eine Festung verbannt und dort bis zu ihrem Tod – 49 Jahre später – gefangen gehalten. Als August den sächsischen Thron bestieg, drängte er den Einfluss des Adels zurück und etablierte sich selbst als Prototyp des absolutistischen Herrschers in Deutschland. Seine prachtvolle Hofhaltung, die rege Bautätigkeit und seine Sammelwut verwandelten Dresden in eine prunkvolle barocke Metropole und brachten dem Kurfürstentum eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Außenpolitisch hatte er eine weniger glückliche Hand: Als im Jahr 1696 der polnische König Jan III. Sobieski starb, versuchte August, den Thron der polnischen Wahlmonarchie zu erringen. Dafür zahlte er einen hohen Preis: Der protestantische Kurfürst trat dafür zum Katholizismus über entsetzte damit viele seiner Untertanen. Außerdem stürzte er sein Land in hohe Schulden, um die benötigten Bestechungsgelder für den polnischen Adel aufbringen zu können. Weiterhin hatte es August im Norden mit einer aufstrebenden Militärmacht zu tun: Preußen. Im Wettstreit zwischen den beiden Mächten in Deutschland konnte es am Ende nur einen Sieger geben. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 27.11.2010 ZDFneo Die Deutschen: 17. Karl Marx und der Klassenkampf
45 Min.Er ist einer der wirkungsvollsten Bestsellerautoren der Weltgeschichte, und doch haben die Wenigsten sein Werk vollständig gelesen. Seine Lehre wurde zu einer Ersatzreligion, auch wenn der Urheber sich nie als Glaubensstifter verstand, sondern als wissenschaftlicher Analytiker. „Ich bin kein Marxist“, kokettierte Karl Marx (1818 bis 1883), der mit seinem Werk wie kein Deutscher seit Luther den Lauf der Weltgeschichte beeinflusste. Ab Mitte des 20. Jahrhundert wurde etwa die Hälfte der Menschheit von Regierungen geführt, die sich auf den deutschen Denker beriefen. In seinem Hauptwerk „Das Kapital“ sezierte Karl Marx, geprägt von dialektischen und materialistischen Modellen seiner Zeit, mit brillanter Tiefenschärfe die komplexen Zusammenhänge von Geld und Warenwelt.Seine Sicht auf das soziale Elend der frühen Industriezeit schärfte der Fabrikantensohn Friedrich Engels. Von seinem Gesinnungsfreund inspiriert, schuf Marx 1848 im „Kommunistischen Manifest“ das theoretische Rüstzeug für eine internationale Arbeiterbewegung, die später in sozialdemokratisch orientierten Parteien ihren Siegeszug antrat. Sein Gedankengut diente aber auch als Legitimation für kommunistische Diktaturen, die dazu beitrugen, dem 20. Jahrhundert einen totalitären Stempel aufzudrücken. Dabei hatte der scharfsinnige, bisweilen sarkastische Theoretiker es vermieden, sich allzu sehr in die Belange der praktischen Politik einzumischen. Gleichwohl zogen deren Folgen ihn mit seiner Familie zeitlebens in Mitleidenschaft. Seit die preußische Regierung die von ihm geleitete, regierungskritische Rheinische Zeitung in Köln 1843 verboten hatte, verbrachte Karl Marx die Hälfte seines Lebens als politisch Verfolgter im Exil. In Paris, Brüssel und London wurde er zum klarsichtigen Zeugen der Revolutionen und Umwälzungen des 19. Jahrhunderts, die er in einem ebenso umfangreichen wie fragmentarisch gebliebenen Gesamtwerk kommentierte. Der Film zeigt Karl Marx, der Weltgeschichte schrieb, auch in seiner Herkunft, als Privatmann und Familienvater. 1883 starb der zu Lebzeiten kaum bekannte Autor, von Krankheiten und Schicksalsschlägen heimgesucht, im Londoner Exil. Erst nach seinem Tod entfaltete die Sprengkraft seiner – oft umgedeuteten oder falsch verstandenen – Ideen ihre durchschlagende Wirkung. Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Beatrix Bouvier (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 04.12.2010 ZDFneo Die Deutschen: 18. Ludwig II. und die Bayern
45 Min.Mythen und Legenden ranken sich um die Gestalt Ludwigs II. von Bayern (1845 bis 1886), der als „Märchenkönig“ in die Geschichte eingegangen ist. Er habe die Politik gescheut und sich vor allem seinen schwärmerischen Leidenschaften hingegeben: den Opern Richard Wagners und dem Bau prunkvoller Schlösser wie Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee. Doch Ludwig war keineswegs nur ein versponnener Träumer, sondern verfolgte klare politische Ziele. Er glaubte an das „Dritte Deutschland“, an eine eigenständige Kraft neben Preußen und Österreich.Der föderale Staatenbund der kleinen und mittleren deutschen Länder ist Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gegenmodell zu einem Bundesstaat unter preußischer Führung. Scheitern wird die Vision am politischen Genie Otto von Bismarcks und der militärischen Stärke des Hohenzollern-Staates. Im „Deutschen Krieg“ von 1866 setzte sich Preußen nicht nur gegen Österreich, sondern auch gegen die mit Habsburg verbündeten „dritten“ deutschen Staaten durch. Bayern verlor nach dem Friedensvertrag mit Preußen die Kontrolle über die eigene Armee. Ein Souveränitätsverlust, der sich mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870 fortsetzte. Bismarck nutzt den militärischen Triumph zur Schaffung des Deutschen Kaiserreichs. In diesem geeinten Reich wurde der Bayerische König mehr und mehr zur exotischen Randfigur. Er verlegte sich fortan auf das Bauen, um wenigstens auf dem Gebiet der Architektur seiner Herrschaft einen Rest von Glanz und Würde zu verleihen. Fernab der Residenzstadt München errichtete er Schlösser, die als weithin sichtbare Monumente an die Epoche des Absolutismus erinnern sollten. Bald konnte der König seine kostspieligen Bauvorhaben nicht mehr aus eigener Tasche finanzieren. Hoch verschuldet drohte Ludwig auch seiner Regierung mit der Absetzung. Ihr wollten die Minister mit einem Staatsstreich zuvor kommen. Der Machtkampf wird den letzten „wahren“ König Bayerns das Leben kosten. Wie der Monarch ums Leben kam, ist bis heute ungeklärt. Die Umstände seines Todes werden in diesem Film untersucht. Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Hans-Michael Körner (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 04.12.2010 ZDFneo Die Deutschen: 19. Rosa Luxemburg und die Freiheit
45 Min.Sie stammte aus dem von Russland annektierten Teil Polens. Rosa Luxemburg (1871 bis 1919) wurde politische Aktivistin in einer Zeit, in der Frauen in Deutschland noch nicht wählen durften. Die Arbeiterbewegung in Europa befand sich im Aufbruch, Sozialisten wurden überall verfolgt. Schon in jungen Jahren kämpfte Rosa Luxemburg für die Rechte der Arbeiterschaft; ab 1898, nachdem sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte, auch in der SPD des wilhelminischen Deutschland. Rosa Luxemburg war Jüdin, sehr gebildet, besaß einen scharfen Verstand und ein mitreißendes Temperament. Sie war eine großartige Rednerin und brillante Schriftstellerin.Konflikte scheute sie nicht. Bei Streitfragen innerhalb der SPD nahm sie eine radikale Position ein. Ihr Engagement brachte sie wiederholte Male ins Gefängnis – verurteilt wegen Majestätsbeleidigung, Aufforderung zu Ungehorsam, Gefährdung des öffentlichen Friedens. Unermüdlich sprach sich Rosa Luxemburg gegen preußischen Militarismus und gegen die Aufrüstung aus. Als die SPD im August 1914 die Kredite für den Krieg bewilligte, brach sie aus Enttäuschung über den ‚Verrat‘ an der internationalen Arbeiterbewegung fast zusammen, dachte sogar an Selbstmord. Rosa Luxemburg, die auch dazu aufgerufen hatte, den Dienst an der Waffe zu verweigern, verbrachte fast die gesamte Zeit des Ersten Weltkriegs hinter Gittern. Doch auch dort blieb sie politisch aktiv. Als am 9. November 1918 die Revolution in Deutschland ausbrach und die Monarchie gestürzt wurde, war sie zur Stelle. Im Gegensatz zu den nun herrschenden Sozialdemokraten, die eine parlamentarische Republik errichten wollten, traten Rosa Luxemburg und ihre Mitstreiter für eine sozialistische Revolution ein, nach dem russischen Vorbild von 1917. Rosa Luxemburg ging jedoch auf Distanz zur Leninistischen Diktatur. Enttäuscht über die Politik der SPD, gründete sie zusammen mit Karl Liebknecht die Kommunistische Partei Deutschlands. Als ihr engster Mitstreiter im Januar 1919 zum bewaffneten Kampf für die Revolution aufrief, ließ die Regierung den Aufstand, der sich gegen die junge Republik richtete, blutig niederschlagen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Köpfe der revolutionären Bewegung, wurden von Freikorps-Soldaten ermordet. Die sozialistische Revolution blieb aus. Die große Mehrheit der Deutschen stimmte für eine bürgerliche Demokratie – zunächst. Wissenschaftliche Beratung: Prof. Dr. Reinhard Rürup (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 11.12.2010 ZDFneo Die Deutschen: 20. Gustav Stresemann und die Republik
45 Min.Gustav Stresemann (1878 bis 1929) wurde Reichskanzler, als die junge Weimarer Republik einmal mehr ins Chaos stürzte: im Krisenjahr 1923. Deutschland litt noch immer an den Folgen des verlorenen Krieges und des Versailler Vertrags. Frankreich und Belgien besetzten das Ruhrgebiet, um milliardenschwere Reparationen zu erzwingen und die Kontrolle über die wichtige Industrieregion zu gewinnen. Die Inflation erreichte ihren Höhepunkt. Kommunistische Aufstände drohten von links, die radikale Rechte forderte eine nationale Diktatur. Kanzler werden in solcher Zeit, das sei ‚eigentlich politischer Selbstmord‘, schrieb Stresemann an seine Frau.‚Vernunftrepublikaner‘ nannte man Köpfe wie ihn. 1918 hatte er den Sturz der Monarchie entschieden abgelehnt. Jetzt aber stellte er sich in den Dienst der Republik – nur sie konnte in seinen Augen die politischen und sozialen Zerwürfnisse im Deutschen Reich friedlich ausgleichen. In etwas mehr als 100 Tagen fällte Stresemann als Kanzler einer Großen Koalition wichtige Entscheidungen zur Rettung der Demokratie. Die Ruhrkrise wurde entschärft, die Inflation beendet, den Aufständen von links und rechts der Boden entzogen. Hitlers Putschversuch vom 9. November 1923 endete im Kugelhagel der Polizei. Als Außenminister für weitere sechs Jahre setzte Stresemann auf Verständigung mit Frankreich und ermöglichte Deutschland die Rückkehr in die Völkergemeinschaft. Er wusste, dass die Deutschen nur mit und nicht gegen Europa bestehen konnten. Doch sein Tod und der Schwarze Freitag, der 1929 die Weltwirtschaftskrise einläutete, markierten den Anfang vom Ende der Republik. Dass er so früh starb, sei ‚mehr als ein Verlust‘, es sei ein ‚Unglück‘, lautete ein Zitat jener Tage. Und so stellt sich noch heute die Frage, ob Stresemann den Untergang der Demokratie, die Machtübernahme Hitlers, hätte verhindern können, wenn er länger gelebt hätte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere Sa. 11.12.2010 ZDFneo Deutschland bei Nacht: 1. Land
45 Min.Leuchtende Sternenhimmel, schimmernde Meere und untote Bäume – nachts ist das ländliche Deutschland besonders faszinierend. Eine geheimnisvolle Welt, mächtig und wunderschön zugleich. In dieser Folge, „Deutschland bei Nacht – Land“, zeigt „Terra X“ in außergewöhnlichen Bildern die Magie der Finsternis in all ihren Facetten. Sie erzählt von Mythen, Ängsten und von dem Einfluss der Gestirne auf unser Leben. Nachts allein in der Dunkelheit – in den Gruselmärchen unserer Kindheit lauert das Böse oft im düsteren Wald. Dabei beginnt dort mit Einbruch der Dämmerung ein reges Treiben.Ob Wildkatzen, Wildschweine oder Waldeulen, nachtaktive Jäger schätzen den Schutz der Finsternis und machen die Nacht zu ihrer Bühne. In den Mooren rund um den bayerischen Chiemsee erwachen allerdings tatsächlich Untote. Aufwendige Zeitraffer-Aufnahmen beweisen, dass längst abgestorbene Bäume zu Zombie-Bäumen werden können. Warum aber erwachen die Äste der toten Bäume zum Leben? Ob Bäume noch weitere Geheimnisse haben, wollen Wissenschaftler aus Ungarn und Österreich ergründen. Das Forscherteam untersucht, wie ähnlich Bäume uns Menschen sind. In einem aufwendigen Verfahren soll der Schlafrhythmus von Birken herausgefunden werden – mit verblüffendem Ergebnis. Manche Wunder der Natur lassen sich in der Nacht einfach am besten bestaunen. Unheimlich schön sind nicht nur Glühwürmchen mit ihren körpereigenen Leuchtstoffen, sondern auch Polarlichter und das sogenannte Meeresleuchten. In schwülwarmen Sommernächten fangen das Meer und der Strand in der Brandungszone an, bläulich-grün zu schimmern. Seit dem Altertum sind die Menschen von diesem mysteriösen Schauspiel fasziniert. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 01.01.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 05.01.2020 ZDF Deutschland bei Nacht: 2. Stadt
45 Min.Funkelnde Metropolen, strahlende Industriekulissen und atemberaubende Illuminationen – Nacht für Nacht verwandelt die Finsternis Deutschland in ein faszinierendes Meer aus Lichtern. Diese Folge „Deutschland bei Nacht“ zeigt Städte, die niemals schlafen, und Regionen, die lange, dunkle Winternächte zum Leuchten bringen. Außerdem erzählt sie, wie elektrisches Licht unser Leben im Lauf der Zeit verändert hat. Über Jahrhunderte sind Kerzenlicht, Gas- oder Petroleumlampen die einzigen Lichtquellen in Deutschland. Der Alltag der Menschen ist von einem natürlichen Tag- Nacht-Rhythmus geprägt.Damals sind die Nächte noch pechschwarz. Erst mit der Erfindung des elektrischen Lichts ändern sich im 19. Jahrhundert die Lebensgewohnheiten. Ende der 1920er-Jahre verfügt etwa die Hälfte aller Haushalte in Berlin über elektrischen Strom. Tausende von Glühbirnen lassen das Gesicht der Metropole in neuem Glanz erstrahlen. In jener Zeit wird aus der Hauptstadt Elektropolis. Künstliches Licht ist seit der Industrialisierung Symbol von Macht und Wohlstand. Aus dem Weltall ist heute deutlich zu erkennen, wie Wirtschaftszentren ganze Regionen überstrahlen. Die sogenannte Blaue Banane markiert die dicht besiedelten und finanzstarken Teile unseres Kontinents – von London, den Rhein entlang bis hin nach Norditalien. Nachtschichten an Flughäfen, Containerhäfen oder Kliniken gehören hier selbstverständlich dazu. Nicht immer zum Wohl der Menschen. Die „Terra X“-Dokumentation bringt noch andere schaurig-schöne Geschichten zutage. Sie erzählt von nächtlichen Ängsten und erklärt, was es mit der Stunde des Wolfes auf sich hat. Ebenso kommen Nachtschwärmer zu Wort, die die Freiheit der Finsternis genießen und die Regeln des Tages über Bord werfen. Im Schutz der Dunkelheit scheint viel mehr möglich. „Deutschland bei Nacht – Stadt“ taucht ein in eine geheimnisvolle Tageszeit und zeigt das Land aus ungewöhnlicher Perspektive. Faszinierende Nachtaufnahmen lassen Städte in unbekanntem Licht erscheinen. Aufwendige CGIs, Reenactments und Experten erzählen vom Siegeszug des Lichts, das aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 01.01.2020 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 12.01.2020 ZDF Deutschland in … (1): Der Frühen Bronzezeit
45 Min.Die Fr¸he Bronzezeit legt den Grundstein f¸r die moderne Welt. In dem ÑTerra Xì-Dreiteiler begleitet Mirko Drotschmann Forschende durch drei spannende Epochen der Geschichte.Bild: Joachim C. Seck / ZDFMirko Drotschmann beleuchtet eine Epoche, die erst seit rund 20 Jahren im Fokus der Archäologie in Deutschland steht: die Frühe Bronzezeit. Auslöser für diesen Forschungsboom war der Fund der Himmelsscheibe von Nebra. Sie wurde 1999 von Raubgräbern entdeckt und gestohlen, konnte aber in einer krimiähnlichen Aktion sichergestellt werden. Seitdem ist sie im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle ausgestellt. Die Himmelsscheibe gilt als der bedeutendste archäologische Fund auf dem Gebiet des heutigen Deutschland und ist eines der bestuntersuchten archäologischen Objekte unserer Geschichte.Die älteste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheit diente wahrscheinlich als Kalender. Doch welche Kultur hatte vor rund 4000 Jahren das Wissen und die Technik, ein solches Hightech-Objekt herzustellen? Bisher wurde angenommen, dass damals auf dem Gebiet Mitteldeutschlands Stammesfürsten über einfach strukturierte Gemeinschaften von Jägern und Viehzüchtern herrschten. Doch die Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra hat den Blick auf die Frühe Bronzezeit verändert. Der Fund wurde der Schlüssel zum Verständnis einer Gesellschaft, die weiter entwickelt war als bisher vermutet, obwohl sie weder die Schrift kannte noch gewaltige Steinmonumente hinterlassen hat. Mirko Drotschmann trifft Forschende, die gerade dabei sind, diese untergegangene Welt der Himmelsscheibe wieder ans Licht zu bringen – mit vielen spektakulären Entdeckungen. Dazu gehört der gigantische Grabhügel bei Dieskau. Das Monument war ursprünglich 15 Meter hoch und hatte einen Durchmesser von 65 Metern – Symbol für die Macht und den Reichtum des Bestatteten. Oder die aus Baumstämmen errichtete Ringanlage bei Pömmelte, die Sonnenobservatorium und Ritualort zugleich war. Knochen- und Schädelfunde lassen vermuten, dass hier an der Schwelle von der Steinzeit zur Bronzezeit Menschen geopfert wurden. Ganz in der Nähe der Anlage legen Archäologen zurzeit die größte frühbronzezeitliche Siedlung Mitteleuropas frei. Grundlage für den Aufstieg des Reiches der Himmelscheibe ist die Bronze, ein Werkstoff, der in der Natur nicht als Erz vorkommt, sondern aus einer Legierung von Kupfer und Zinn entsteht. Die Rohstoffe mussten aus verschiedenen Regionen Europas herbeigeschafft werden. Die Fürsten in Mitteldeutschland kontrollierten offenbar die Warenströme und wurden dadurch wohlhabend und mächtig. Ihr Reich hat vermutlich viele Jahrhunderte in der fruchtbaren Region zwischen Harz, Saale und Elbe existiert. Anhand von archäologischen Funden ist man heute in der Lage, das Alltagsleben der bronzezeitlichen Menschen zu rekonstruieren. Sie lebten in Langhäusern, die sich mehrere Familien teilten – im Winter sogar mit dem Vieh. Nicht nur Lebensumstände, Kleidung oder Ernährung lassen sich inzwischen nachvollziehen, Gräberfunde im Lechtal nahe Augsburg bringen auch erstaunliche Erkenntnisse über die Rolle der Frauen vor 4000 Jahren zutage. Sie waren deutlich mobiler als Männer und brachten vermutlich das Wissen der Bronzeherstellung aus dem Technologiezentrum bei Halle in den Süden Deutschlands. Grund dafür war ein neues Heiratssystem, das junge Frauen dazu zwang, an den Heimatort ihres zukünftigen Mannes zu ziehen. Jahrhundertelang war die Himmelsscheibe Ausdruck von Macht und Prestige der Herrscher von Nebra. Um das Jahr 1600 vor Christus wurde sie auf dem Mittelberg bei Nebra in der Erde deponiert. Warum, wissen wir nicht. Mit der Himmelsscheibe verschwand das Reich von Nebra im Dunkel der Geschichte – bis die Scheibe nach etwa 3600 Jahren wiederauftaucht. Und mit ihr die Geschichte Deutschlands in der Frühen Bronzezeit. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 07.07.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 11.07.2021 ZDF Deutschland in … (2): Der Industriellen Revolution
45 Min.Mirko Drotschmann erklärt die Bedeutung des Pumpwerks Alte Emscher in Duisburg.Bild: Timm Schwehm / ZDFDie Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert ist eine der größten Umwälzungen der Geschichte. Innerhalb weniger Jahrzehnte werden die Deutschen in die Moderne katapultiert. Mirko Drotschmann geht in dieser Folge der Frage nach, was es heißt, wenn ein Land in so atemberaubendem Tempo umgekrempelt wird, und was das mit den Menschen macht, deren Arbeitswelt sich durch neue Technologien radikal verändert – eine Parallele zu heute. Buchstäblich zum Motor dieser Entwicklung wurde eine Erfindung des Schotten James Watt: die Dampfmaschine.Sie sorgt im 19. Jahrhundert auch in Deutschland für ungekannten Schwung – vor allem in Gestalt der Eisenbahn. Am Anfang haben viele Menschen noch Angst vor dem „rauchspeienden Drachen“, wie die Dampflokomotive wegen ihres Schnaubens und Zischens genannt wird. Doch ihr Siegeszug ist nicht aufzuhalten. Mit der Eisenbahn wächst der Hunger auf Eisen und Stahl, Werkstoffe, die bald Alltag und Arbeitswelt erobern. Selbst was alt und vertraut erscheint, wie das Schloss Neuschwanstein aus dem späten 19. Jahrhundert, beruht hinter der mittelalterlichen Fassade auf modernen Eisen- und Stahlkonstruktionen. Um die immense Nachfrage bedienen zu können, werden auch für die Industrie gigantische Bauwerke errichtet – wie die Völklinger Hütte, das weltweit einzig erhaltene Eisenwerk aus der Blütezeit der Industrialisierung. Doch mit dem Vormarsch der Maschinen gehen auch schlechtere Lebens- und Arbeitsbedingungen einher. Das zeigt sich besonders drastisch im Ruhrgebiet, wo alte Bilderbuchlandschaften dem Fortschritt weichen müssen. Die industrielle Ausbeutung der Kohlereviere hat das Ruhrgebiet im Durchschnitt um zwölf Meter absacken lassen. Deshalb müssen heute über 200 Pumpwerke Tag und Nacht laufen, sonst würde den Menschen dort bald das Wasser im Wohnzimmer stehen. Zur größten Herausforderung des Industriezeitalters wird die soziale Frage. Arbeitnehmerrechte müssen sich die Arbeiter erst mühsam erkämpfen; unterstützt werden sie dabei von den ersten Sozialdemokraten im Parlament. In Sachsen, damals ein Zentrum der deutschen Textilindustrie, kommt es 1903 zum Massenstreik. Bemerkenswert: Frauen und Männer streiken gemeinsam, zum ersten Mal in der deutschen Geschichte. Landesweit führt der Arbeitskampf der rund 8000 Textilarbeitern in Crimmitschau zur Beschwörung einer solidarischen Arbeiterklasse. Während die Mehrheit der Deutschen in Mietskasernen in den wachsenden Großstädten lebt, lassen sich die Firmengründer, Stahlbarone und Eisenbahnkönige Villen und ganze Schlösser bauen, wie man sie nur von den Landsitzen des Adels kannte. Wie kein zweiter Bau symbolisiert Alfred Krupps Villa Hügel in Essen Macht und Pracht dieses neuen Unternehmertums, das auch dank enger Kontakte zum preußischen Herrscherhaus floriert. Mit der Reichseinigung 1871 startet Deutschland in eine zweite fulminante Phase der Industriellen Revolution. Nach Kohle und Stahl werden jetzt neue Industrien wie Maschinenbau, Elektrotechnik und Chemie zu Schrittmachern der Wirtschaft. Dank der engen Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft entstehen viele erfolgreiche Produkte. Ob synthetischer Farbstoff, Schmerztablette, Zündkerze oder Kaffeefilter – ohne die zahlreichen Erfindungen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wäre unser heutiger Lebensstil nicht denkbar. Vieles mutet erstaunlich fortschrittlich an: Bereits um die Jahrhundertwende entwickelt Ferdinand Porsche beispielsweise den ersten serienmäßigen Hybrid-Antrieb mit elektrischem Radnabenmotor. Heute steht Deutschland erneut vor einem epochalen Umbruch. Roboter, künstliche Intelligenz, all das wird kommen – oder ist in vielen Industrien sogar schon da. Und die historischen Erfahrungen zeigen: Technischer Fortschritt hat immer seinen Preis, aber auch seine Chancen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 07.07.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 18.07.2021 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail