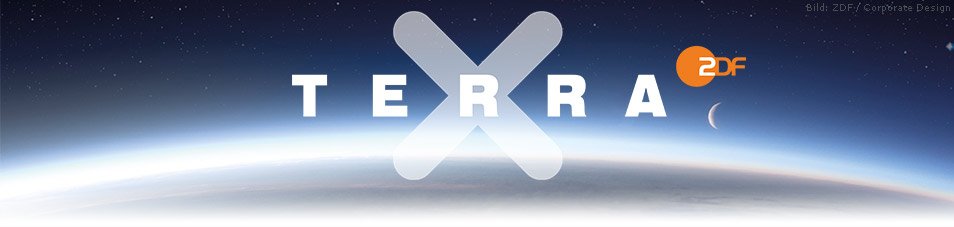1524 Folgen erfasst (Seite 11)
Eine Erde – viele Welten: Helden der Wildnis
45 Min. Ein Rotaugenfrosch legt eine Kletterpause im Regenwald von Costa Rica ein.Bild: ZDF und Emma Napper„Terra X“ zeigt die dramatischsten und bewegendsten Momente aus der gleichnamigen Reihe. Eine atemberaubende Weltreise zu den Helden der Wildnis in extremen Lebensräumen. Internationale Kamerateams hatten sich drei Jahre lang auf härteste Herausforderungen eingelassen, um die Überlebensstrategien der Tiere in Insel-, Dschungel-, Wüsten-, Berg- und Graslandwelten aus nächster Nähe zu erfassen. Mit Drohnen durchdrangen sie Wälder und Schluchten, mit Kamerafallen, superstarken Teleobjektiven und Hochgeschwindigkeitskameras dokumentierten sie bislang kaum wahrnehmbare und versteckte Abläufe.
Ein Rotaugenfrosch legt eine Kletterpause im Regenwald von Costa Rica ein.Bild: ZDF und Emma Napper„Terra X“ zeigt die dramatischsten und bewegendsten Momente aus der gleichnamigen Reihe. Eine atemberaubende Weltreise zu den Helden der Wildnis in extremen Lebensräumen. Internationale Kamerateams hatten sich drei Jahre lang auf härteste Herausforderungen eingelassen, um die Überlebensstrategien der Tiere in Insel-, Dschungel-, Wüsten-, Berg- und Graslandwelten aus nächster Nähe zu erfassen. Mit Drohnen durchdrangen sie Wälder und Schluchten, mit Kamerafallen, superstarken Teleobjektiven und Hochgeschwindigkeitskameras dokumentierten sie bislang kaum wahrnehmbare und versteckte Abläufe.Das Team wird unter anderem Zeuge eines unglaublichen Wettlaufs ums Überleben auf Fernandina. Kaum ist eine kleine Meerechse geschlüpft, jagen ganze Rudel von Galapagos-Nattern das Junge. Auf Zavodovski Island im Südpolarmeer beweisen Zügelpinguine Todesmut, um unter Einsatz ihres Lebens bei mörderischer Brandung auf Futtersuche für ihren Nachwuchs zu gehen. Auch im Herzen des Dschungels gelang es, überraschende, noch nie gesehene Ereignisse einzufangen. In Ninja-Manier verteidigt ein winziger Glasfrosch seinen Nachwuchs gegen räuberische Wespen. Und nachts entsteht plötzlich eine märchenhafte Welt. Leuchtpilze illuminieren den Waldboden in mystischer Atmosphäre. Zerklüftete Terrains, steile Hänge und Mangel an Futter und Wasser bilden die größten physischen Herausforderungen des Planeten. Nur extreme Anpassungskünstler wie der Nubische Steinbock können sich hier behaupten. Auch anderen höchst ungewöhnlichen Wald-, Wüsten- und Bergbewohnern setzt die große Naturdokumentation mit berührenden Geschichten und Bildern ein Denkmal. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 24.06.2018 ZDF Der erste Freund des Menschen
42 Min.Wölfe erlernen die Bedeutung von Mimik und Gestik beim Menschen ohne Probleme. Denn auch untereinander benutzen Wölfe zahlreiche Signale, zum Beispiel um sich bei der Jagd im Rudel zu verständigen.Bild: ZDF und Jean-Claude Rasle, GedeonDie Freundschaft zwischen Mensch und Hund ist legendär. In atemberaubenden Bildern zeigt „Terra X“, was Wissenschaftler über die Beziehung der ungleichen Partner herausgefunden haben. Wann wurde der erste Wolf gezähmt? Warum blieb das mächtige Raubtier beim Menschen? Wie beeinflusste der Hund die Entwicklung des Menschen? Neueste Ergebnisse der Paläogenetik, Verhaltensforschung und Zoologie geben erstaunliche Antworten auf diese Fragen. Dass der Hund das erste Haustier des Menschen war, hatten Wissenschaftler schon lange vermutet, aber das Team von Prof. Burger (Universität Mainz) war dann doch sehr erstaunt, dass Menschen und Wölfe offenbar viel früher zusammenlebten als bisher angenommen.„Unsere Daten haben ergeben, dass der Zeitraum, der am wahrscheinlichsten für die Domestikation ist, zwischen 20 000 und 40 000 Jahren lag“, fasst Burger die Ergebnisse seines Teams zusammen. „Das ist geradezu ein unwahrscheinliches Ergebnis! Es ist ja relativ einfach, ein Tier zu domestizieren, wenn man es an das Haus binden kann. Aber diesen Vorteil hatten die Jäger und Sammler nicht. Sie lebten in hochmobilen Gruppen, die ihren Beutetieren hinterherziehen mussten. Unter diesen Umständen die Konstanz für eine Domestizierung aufzubringen und Züchtung zu betreiben, das ist eine besonders große Leistung.“ Eine Leistung, die offenbar nicht nur zu gravierenden Veränderungen im Leben des Hundes führte, sondern auch den Menschen veränderte. Prof. Kurt Kotrschall vom Wolfsforschungszentrum (WSC) Ernstbrunn in Österreich ist sich sicher: „Man kann durchaus sagen, dass Hunde während des Sesshaftwerdens des Menschen eine große Rolle gespielt haben. Zu dieser Zeit wurden auch Schaf, Rind und Ziege domestiziert. Die Leute begannen, halbnomadisch mit diesen Tieren zu leben, was ja wirtschaftlich sehr erfolgreich war, und das wäre ohne den Hund nicht gegangen. Damals gab es überall, wo Vieh gehalten wurde – also im fruchtbaren Halbmond, im Nahen Osten, bis in die zentralasiatischen Steppen – viele Wölfe. Das heißt, es wäre völlig undenkbar gewesen, dass Menschen ohne die Hilfe des Hundes Schaf und Rind domestiziert hätten. So gesehen, haben Hunde einen riesigen Beitrag für die folgenden Kulturentwicklungen geleistet. Heute unterstützt der Hund den Menschen noch immer als Hütehund, übernimmt aber auch immer höher spezialisierte Aufgaben als Spür-, Jagd-, Minen-, Schlitten- und sogar als Therapiehund. Die meisten der freundlichen Vierbeiner werden allerdings gezüchtet, um Teil einer menschlichen Familie zu werden. Längst haben sie ihre Kommunikation auf den Menschen umgestellt. Kein anderes Tier versteht die Mimik und Gestik des Menschen so gut wie der Hund. Sogar das Bellen sehen die Forscher als Antwort auf den „redseligen“ Partner Mensch an. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 26.05.2019 ZDF Die ersten Menschen (1): Vom Wald in die Savanne
Wie wurden wir, was wir sind? In aufwändigen Inszenierungen entführt der Zweiteiler „Die ersten Menschen“ auf eine Zeitreise zu unseren ältesten Wurzeln vor 25 Millionen Jahren. Damals war die Erde ein Planet der Affen. Neueste Forschung zeigt, dass sich die Ursprünge menschlicher Verhaltensweisen bereits viel früher entwickelt haben, als bisher gedacht. Die Frage „Wer war der erste Mensch?“ ist längst nicht beantwortet. Pierolapithecus heißt beispielsweise ein früher Waldbewohner, der zwar noch kein Mensch, aber trotzdem ein entfernter Vorfahr gewesen sein könnte.Das Wesen lebte als Schwinghangler in den tropischen Regenwäldern auf dem Gebiet des heutigen Spanien. Einige Wissenschaftler trauen dem Pierolapithecus zu, schon ähnlich versiert im Werkzeuggebrauch gewesen zu sein wie heute lebende Menschenaffen. Als erstes Werkzeug überhaupt gilt der Stock. Mit ihm konnten die frühen Affen bereits Insekten wie Ameisen und Termiten aus ihren Bauten angeln. Sogar für die Entstehung des aufrechten Gangs waren vermutlich Wesen wie Pierolapithecus ausschlaggebend. Er war ein vergleichsweise schwerer Primat ohne Greifschwanz, der schon auf zwei Beinen auf dickeren Ästen balanciert sein soll. Noch einen Schritt weiter auf dem Weg zur Menschenähnlichkeit war ein aufrecht gehender Menschenaffe, den man heute als Sahelanthropus oder Toumai bezeichnet. Er lebte vor sechs bis sieben Millionen Jahren in der Region des heutigen Tschad und hatte sich offenbar bereits auf ein Leben auf dem Waldboden eingestellt. Sein aufrechter Gang war noch etwas ungelenk, könnte aber trotzdem ein Evolutionsvorteil gewesen sein, weil Toumai als Zweibeiner die Hände frei hatte. Sein Werkzeuggebrauch soll im Vergleich zu anderen Affen seiner Zeit schon gut entwickelt gewesen sein. Nüsse knacken mit Steinen könnte er wie die Schimpansen der Gegenwart von Generation zu Generation weitergegeben haben. Ein weiterer Wendepunkt wird für eine Zeit vor zwei Millionen Jahren angenommen. Die große Gruppe der Australopithecinen besiedelte schon seit Längerem große Teile Afrikas. Der wohl berühmteste Australopithecus-Fund, Lucy, galt bis vor wenigen Jahren als Urmutter der Menschheit. Mittlerweile halten viele Forscher ihre Linie jedoch für ausgestorben und trauen stattdessen dem Australopithecus sediba zu, ein direkter Vorfahr des Menschen zu sein. Sein Körperbau zeigt so viele moderne Anteile, dass einzelne Wissenschaftler ihn sogar als frühen Vertreter der Gattung „Homo“ sehen. Immer neue Wesen mit teilweise menschlichen, teilweise tierischen Merkmalen wurden in den vergangenen Jahren entdeckt. Der wissenschaftliche Diskurs über die Frage, welches von ihnen noch Affe oder schon Mensch gewesen ist, erscheint symptomatisch für die Tatsache, dass die Grenzen immer stärker verwischen. Für die Pariser Primatologin Sabrina Krief steht heute schon fest, dass die strikte Trennung zwischen Mensch und Menschenaffe wissenschaftlich nicht zu begründen ist: „Heute existieren offiziell sechs Affenarten. Menschen sind einfach die siebte Art unter den anderen. Die alte Hierarchie mit dem Menschen auf der Spitze der Pyramide über all den anderen Primaten stehend, ist längst überholt.“ (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 20.08.2017 ZDF Die ersten Menschen (2): Aus Afrika in die ganze Welt
Wie und warum entwickelten sich vor zweieinhalb Millionen Jahren die ersten Vertreter der Gattung Homo? Und wie schafften sie die erstaunliche Metamorphose zum modernen Menschen? In der aktuellen Folge von „Terra X“ geben Wissenschaftler eine verblüffende Antwort: Vor allem unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit unterscheidet uns Menschen von unseren haarigen Vettern. Nur durch Teamgeist gelang es, in einer feindlichen Umwelt zu überleben. Als eines der frühesten Anzeichen für ein friedlicheres Miteinander wird nach dem aktuellen Forschungsstand der langsame Verlust der riesigen Eckzähne unserer Primatenvorfahren gedeutet.Diese Entwicklung soll bereits vor sieben Millionen Jahren begonnen haben, also ungefähr zu der Zeit, als sich die Wege des Menschen und des Schimpansen trennten. Eckzähne dienen in Affengesellschaften vor allem dazu, Konkurrenten der eigenen Art zu bekämpfen oder abzuschrecken. Wissenschaftler schließen aus dem Verlust der Riesenzähne auf eine Verhaltensänderung bei unseren frühen Ahnen. Innerhalb der eigenen Art gingen sie offenbar schon lange vor dem Auftauchen des ersten Menschen immer freundlicher miteinander um. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Da der Einzelne nicht besonders wehrhaft war oder schnell flüchten konnte, brauchte er das Team, um sich gegen überlegene Feinde, wie zum Beispiel große Raubkatzen, verteidigen zu können. Zunehmend nicht nur für sich selbst, sondern für die Gruppe zu denken, könnte die Gehirnaktivität überhaupt beflügelt haben, und Kommunikation wurde im Laufe der Zeit immer wichtiger. „Was den Menschen heute ausmacht, ist eine symbolhafte Sprache. Das können Menschenaffen nicht“, erläutert der Paläoanthropologe Friedemann Schrenk. „Menschen haben eine symbolhafte Sprache, die mit Kunst und Kultur verknüpft ist. Sprache dient zur Weitergabe von kultureller Information und ist abhängig vom vorausschauenden Bewusstsein.“ Im zweiten Teil der Produktion „Die ersten Menschen“ sucht „Terra X“ nach den Ursprüngen dieses vorausschauenden Bewusstseins und nach seinen Folgen. Wer stellte die ersten Werkzeuge her? Wie kam jemand auf die Idee, das Feuer zu zähmen? Wieso wurden aus unseren vegetarisch lebenden Vorfahren Fleischesser? Und warum wurden die Auseinandersetzungen unter Menschen im Laufe der Zeit immer blutiger, obwohl doch gerade Zusammenarbeit und das Denken an andere als typisch für unsere Art gilt? (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 27.08.2017 ZDF Europa in …: 1. Der letzten Eiszeit
45 Min.Mirko Drotschmann mit Knochen und Rekonstruktion eines Waldelefanten im Landesmuseum Halle (Saale). Der Dickhäuter lebte vor rund 125.000 Jahren, als die Neandertaler Europa beherrschten.Bild: ZDF und Torbjörn Karvang / The History ChannelDie letzte Eiszeit ist sehr lange her. Sie hat nicht nur Europas Landschaft nachhaltig geprägt, sondern auch die Entwicklung der Menschheit. Neue Forschungsergebnisse zeigen die letzte Eiszeit nun in einem völlig anderen, neuen Licht. Mirko Drotschmann ist in Deutschland und Europa zu den Hotspots der Eiszeitforschung unterwegs. Die sogenannte letzte Eiszeit begann vor etwa 115.000 Jahren und endete etwa 11.600 vor heute. Weite Teile Europas waren von einer Tausende Meter dicken Eismasse bedeckt. Nur durch die Mitte Europas erstreckte sich eine sogenannte Mammutsteppe, die üppig und voller Leben war.Dazu gehörte auch das Gebiet zwischen Basel und Frankfurt, das seit geraumer Zeit im Forschungsprojekt „Eiszeitfenster Oberrheingraben“ genauer unter die Lupe genommen wird. In Kies- und Sandablagerungen haben Abertausende Tierknochen von Mammut, Nashorn, Riesenhirsch & Co.die Zeiten überdauert. Ihre Untersuchung mittels einer Radiokarbondatierung brachte eine Sensation zutage: Vor rund 30.000 Jahren tummelten sich im Rhein Flusspferde. Im Gegensatz zur eiszeitlichen Fauna mit ihren Megatieren sind die eiszeitlichen Landschaften noch heute sichtbar – ob an der Schärenküste Schwedens, den norwegischen Fjorden oder den Gletschern der Alpen. Als der Homo sapiens vor mehr als 40.000 Jahren in das eiszeitliche Europa einwanderte, lebte dort bereits seit mehr als 250.000 Jahren eine andere Menschenart: der Neandertaler. Dieser starb zwar kurze Zeit später aus, doch bis dahin hatten sich Homo sapiens und Neandertaler vermischt – die Folgen können in unseren Genen nachgewiesen werden: Alle nicht-afrikanischen Menschen besitzen heute noch zwischen ein und drei Prozent Neandertalergene. Kurz nach seiner Ankunft in Europa schuf der Homo sapiens in den Höhlen der Schwäbischen Alb Erstaunliches: plastische Kunstwerke aus Mammutelfenbein – die ältesten der Welt, soweit heute bekannt. Forscher sprechen von einem Urknall der Zivilisation. Mirko Drotschmann erfährt, mit welchem handwerklichen Geschick und künstlerischen Verständnis die Tierfiguren aus Mammutelfenbein geschnitzt wurden, und besucht auch die Höhle von Chauvet in Frankreich, die der Homo sapiens mit mehr als 1000 Wandbildern verziert hat. Mirko Drotschmann spürt dem Alltag der Ureuropäer nach: Wie haben sie sich ernährt, wie gekleidet, wie sahen sie aus? Viele Darstellungen, auch in Museen, zeigen die Eiszeitjäger mit heller Haut. Doch Untersuchungen der genetischen Marker, die bei modernen Menschen mit der Pigmentierung von Augen, Haut und Haaren in Zusammenhang stehen, zeigen ganz deutlich: Die Menschen der letzten Eiszeit waren dunkelhäutig. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.04.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 30.04.2023 ZDF Europa in …: 2. Der Zeit der Völkerwanderung
40 Min.An den Nordgrenzen des Imperiums siedeln „Germanen“. Ein römischer Sammelbegriff für höchst unterschiedliche Gruppen.Bild: ZDF und Torbjörn Karvang„Völkerwanderung“ – so nennt man in Deutschland die turbulente Epoche zwischen Antike und Mittelalter, in der germanische Kriegerverbände das Römische Weltreich zum Einsturz brachten. Die Völkerwanderung ist einer der epochalen Einschnitte in der europäischen Geschichte. Ein halbes Jahrtausend lang hatten die Römer weite Teile des Kontinents kontrolliert. Doch zwischen dem 5. und 6. Jahrhundert wurde die „Ewige Stadt“ Rom gleich zweimal geplündert. Erst von den Westgoten, dann von den Vandalen. Am Ende saß ein machtloser Kindkaiser auf dem Thron, der schließlich von einem germanischen Warlord abgesetzt wurde.Wie war es dazu gekommen? Auf einer Reise durch Europa begegnet Mirko Drotschmann Forscherinnen und Forschern, die einen neuen Blick auf die damaligen Ereignisse werfen. Das beginnt bereits mit dem Begriff „Völker“. Denn Westgoten oder Vandalen waren keineswegs homogene Volksgruppen, sondern bildeten sich erst im Zuge ihrer Wanderungen durch den Zusammenschluss aus unterschiedlichsten Ethnien. Außerdem zeigt sich, dass diese „Völker“ das Römische Reich gar nicht zerstören, sondern an seinem Wohlstand teilhaben wollten. Dafür plünderten sie nicht nur, sondern trieben Handel und kämpften sogar für die Römer – wie Alarich, der Anführer der Westgoten. Nach Vorbild der Römer errichteten die Westgoten im heutigen Spanien im 6. Jahrhundert die Königsstadt Reccopolis; eine Metropole, die damals sogar manch römische Siedlung in den Schatten stellte, wie modernste Vermessungsmethoden mit geomagnetischen Sonden und Laserdrohnen belegen. Eine Bauleistung, die man den „Barbaren“ lange nicht zugetraut hatte. Auch das Klima rückt die Forschung als wichtigen Push-Faktor für die „Völkerwanderung“ in den Vordergrund: Wahrscheinlich trieb ein Kälteeinbruch die Hunnen aus Asien nach Europa und ermöglichte den Vandalen in der Neujahrsnacht des Jahres 406 das Eindringen ins Römische Reich. Die Migrationen der Spätantike haben Spuren in unseren Sprachen und Genen hinterlassen: So zeugt der Name Englands von der Machtübernahme der Angelsachsen im Britannien des 5. Jahrhunderts. Und obwohl die Einwanderer vom Kontinent damals in der Minderheit waren, haben sie sich genetisch durchgesetzt: Genanalysen zeigen, dass mehr als die Hälfte der englischen Männer angelsächsische Vorfahren hat. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut – und ging auch nicht an einem Tag unter. Im Osten blieb das Imperium in Gestalt des Byzantinischen Reiches sogar bis ins 15. Jahrhundert bestehen. Im Westen traten Karl der Große und die Franken das Erbe der Römer an, gestützt auf die römisch-katholische Kirche. In neuer Gestalt lebte die römische Herrschaftsidee weiter, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation hatte sie bis 1806 Bestand. So steht heute die Zeit der „Völkerwanderung“ weniger für das Ende des Römischen Reiches als vielmehr für die Verbindung der Kulturen und Traditionen, die Europa bis heute prägen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.04.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 07.05.2023 ZDF Europa in …: 3. Der Zeit des Absolutismus
45 Min.Bild: ZDF und Tobias SundermannOb Frankreichs barocke Prachtentfaltung durch den Sonnenkönig, Sachsens Glanz oder Preußens Gloria: Mirko Drotschmanns Spurensuche geht quer durch Europa. Sie gibt Einblicke hinter die Kulissen einer aus heutiger Sicht oft skurrilen Welt und fragt, welches Kalkül hinter der Prunksucht steht. Im 17. Jahrhundert wollten die meisten Könige und Fürsten Europas losgelöst vom alten Adel und Klerus herrschen. Die Alleinherrschaft erschien nach dem Chaos des Dreißigjährigen Krieges ideal, um Stabilität und Ordnung zu sichern. Gestützt auf neueste Forschungen zeigt Mirko Drotschmann, dass die europäische Realität viel differenzierter war.In Versailles, dem Schloss Ludwigs XIV., erfährt Mirko Drotschmann, wie sich die politische Idee des Absolutismus in der Architektur widerspiegelt. „Der Staat bin ich“, soll Ludwig XIV. gesagt haben – und als Mensch gewordener „Staatskörper“ war sogar der königliche Besuch der Toilette ein öffentlicher Staatsakt. Alles ordnete sich dem Monarchen unter. In Wirklichkeit hatte aber auch die Macht des Sonnenkönigs Grenzen. Die Zurschaustellung von Reichtum und Prunk war keine reine Angeberei, sondern sollte den Herrschaftsanspruch der Fürsten und Könige in Europa untermauern. Deutschland hat mit seiner einzigartigen Mischung aus Kleinstaaterei und fürstlicher Konkurrenz ein einmaliges Erbe des Absolutismus – in Gestalt der unzähligen Schlösser, in der verschwenderischen Pracht des Grünen Gewölbes in Dresden und der Porzellansammlung Augusts des Starken. Einen Gegenentwurf lieferte Preußen: Friedrich Wilhelm I. brach radikal mit der barocken Verschwendungslust. Seine neue Leitkultur: Fleiß, Ordnung und Sparsamkeit – später als preußische Tugenden verklärt. In den Niederlanden entwickelte sich ein anderes Modell des Absolutismus: Ab dem 17. Jahrhundert standen dort auch Bürger an der Spitze des Staates und teilten sich als „Regenten“ die Macht mit adligen „Statthaltern“. Niederländische Kaufleute entwickelten den modernen Finanzkapitalismus – und mit ihren Gewinnen wuchs ihr Einfluss. Im Zeitalter des Absolutismus drehte sich also nicht alles um Könige und Fürsten. Der Absolutismus wurde auch zum Wegbereiter für Fortschritt – in der Wissenschaft und bei der Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten. Europäische Forscher legten den Grundstein für die modernen Wissenschaften und die Technisierung der Welt – allen voran Isaac Newton mit seinem Gravitationsgesetz oder Gottfried Wilhelm Leibniz, der als Vater der modernen Computertechnik gilt. Philosophen forderten Freiheit und Gleichheit für alle Menschen. Für sie war der Verstand die schärfste Waffe im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft. Ideen der Aufklärung inspirierten auch Monarchen – wie den Habsburger Joseph II. Mit bahnbrechenden Reformen wie der Abschaffung der Leibeigenschaft oder seinem Toleranzedikt machte er sein Reich zukunftsfähig. Anders Frankreich: Dort fand der Absolutismus mit der Hinrichtung Ludwigs XVI. ein blutiges Ende. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 26.04.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 14.05.2023 ZDF Die Europa-Saga: 1. Woher wir kommen – wer wir sind
45 Min.Was ist Europa, wie entstand der Kontinent? Diese Folge der „Europa-Saga“ schildert, wie sich auf unserem vielgestaltigen kleinen Erdteil erstmals ein europäischer Kulturraum entwickelte. In großen Bögen erzählt der Historiker Christopher Clark die Geschichte Europas: Die ersten Menschen wanderten aus Afrika ein. Später entstanden Volksgruppen wie die Kelten, Staatengebilde wie Griechenland, das Imperium der Römer, das weite Teile Europas umfasste. Ein einheitliches Recht, gemeinsame Währung, Wirtschaft und Kultur schufen den verbindenden Rahmen dieses ersten Reichs in Europa. Die Verbindung mit dem Christentum, das über die Jahrhunderte Staatsreligion in weiten Teilen wurde, verlieh dem Kontinent ein Fundament, das Macht und Glauben miteinander vereinte.Schon lange vorher war der viel zitierte Entstehungsmythos Europas entstanden: Dabei ging es um die Liebe des Göttervaters Zeus zu einer Prinzessin namens Europa. Der liebestolle Griechengott entführte sie aus Sidon in Phönizien auf jenen Erdteil, der später nach ihr benannt wurde: nach Europa. Dieser Mythos ist wohl auch Sinnbild für den Einfluss und die Impulse, die der Okzident aus dem Orient erhielt. Es ist ein Geben und Nehmen. Künftige Kulturen in Europa lösten einander nicht nur ab, sie nahmen die Errungenschaften der Vorgänger jeweils auf, bis die Karten durch die Völkerwanderung neu gemischt wurden. Am Ende sind Griechisches, Römisches, Keltisches, Germanisches, „Heidnisches“ und Christliches miteinander verschmolzen. Das ändert nichts daran, dass Europa bis heute ein Schauplatz vielfältiger Migration geblieben ist. In der sechsteiligen „Europa-Saga“ wirft Christopher Clark einen neugierig-unterhaltsamen Blick auf unseren Kontinent, besucht die schönsten und schicksalhaftesten Orte Europas und bringt etwas Ordnung in unsere so verwirrend vielfältige Geschichte. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 22.10.2017 ZDF Die Europa-Saga: 2. Woran wir glauben – was wir denken
45 Min.Europa, das christliche Abendland so eine gängige These. Welche Rolle spielt der christliche Glaube für die Identität Europas? Gibt es neben dem christlichen auch ein islamisches Abendland? Christopher Clark geht in dieser Folge der Frage nach, woran die Europäer glauben: Das Christentum war die erste offene Volksreligion, Gemeinden und Klöster wurden zur Keimzelle gemeinsamer Konfession, Pilgerwege zu einem verbindenden europäischen Netzwerk. Doch bald schon gingen die Christen im Osten und Westen Europas getrennte Wege.Was sie für kurze Zeit wieder zusammenbrachte, war eine neue, gemeinsam empfundene Bedrohung: der Islam, der auch in Europa auf dem Vormarsch war. Doch bedeutete dies für den Kontinent mehr als nur ein Feindbild: Auf der spanischen Halbinsel, in „Al-Andalus“, prägten Muslime über ein halbes Jahrtausend die Kultur im westlichen Europa mit, die Herrschaft der Osmanen hinterließ im Südosten Spuren. Die Juden Europas trugen in ihrer Rolle als religiöse Minderheit ebenfalls zur kulturellen Vielfalt bei, brachten die Wirtschaft in Gang und waren doch immer wieder Opfer grausamer Verfolgung. Die Kreuzzüge und Türkenkriege verstärkten den Antagonismus der Religionen. Wenn nicht Gegner von außen für den Zusammenhalt sorgten, brachen unter den Christen immer wieder Konflikte aus. Zur entscheidenden Spaltung führte die Reformation im frühen 16. Jahrhundert. Martin Luther prangerte nicht nur die Missstände in der Kirche an, er stellte auch die klerikal geprägte Herrschaftsordnung in Frage. So spalteten sich in Europa Macht und Glaube. 100 Jahre nach der Reformation verwüsteten verheerende Schlachten zwischen Katholiken und Protestanten den Kontinent. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges wuchs der Wille, das Verhältnis der Völker künftig auf Prinzipien der Vernunft zu begründen. Es galt, Religion und Politik in den Beziehungen der Mächte zu trennen. Die europäische Staatengemeinschaft schuf mit dem Westfälischen Frieden eine verbindliche Ordnung, die den Ausgangspunkt für das moderne Völkerrecht bildete. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 29.10.2017 ZDF Erstausstrahlung ursprünglich für den 22.10.2017 angekündigtDie Europa-Saga: 3. Was uns antreibt – was wir uns nehmen
43 Min.Diese Folge erzählt die Geschichte der europäischen Expansion von den Wikingern bis zum Britischen Empire: Warum zog es die Europäer in die Weite, wie bekamen sie Macht über Teile der Welt? Europa und die Welt, eine Historie von Entdeckergeist und Unternehmertum, aber auch von Imperialismus, Unterdrückung und Ausbeutung. Historiker Christopher Clark führt die Zuschauer an Ausgangspunkte des Aufbruchs wie Lissabon, Amsterdam und London. Und er begibt sich an Bord der „Endeavour“, jenes Schiffes, mit dem James Cook die Südsee erforschte und Australien für Großbritannien in Besitz nahm.Warum zog es die Europäer immer wieder in die Weite? „Weil wir ein Kontinent der engen Räume, aber auch der Küsten sind“, erklärt Professor Clark. Die Griechen, Römer und Wikinger machten es vor, nahmen Europas Küstenregionen in Besitz. Über die Seewege der Hanse kam Wohlstand in Hunderte nord- und mitteleuropäische Städte. Heute wird dieser Handelsbund gern als Vorläufer der Europäischen Union gepriesen. Im Süden geschah der globale Aufbruch vom Mittelmeer aus: Venedig begründete die Handelswege nach Asien, von Spanien aus erfolgte schließlich der Schritt in die Neue Welt. Nord- und Südamerika gaben Millionen von Europäern Hoffnung – aber die Bevölkerung der eroberten Länder fiel dem zum Opfer, wurde versklavt, ihre Kulturen zerstört. Noch vor 100 Jahren konnte man von einem europäischen Weltreich sprechen. Christopher Clark schildert auch, wie der Machtkampf der Rivalen in den Ersten Weltkrieg führte, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 05.11.2017 ZDF Die Europa-Saga: 4. Was wir erschaffen – was wir uns leisten
44 Min.Diese Folge der „Europa-Saga“ erzählt von Europas Beitrag zur Weltkultur. In Kunst, Unterhaltung, Philosophie und Wissenschaft wurde Unvergängliches geschaffen oft ohne Rücksicht. Christopher Clark reist in die Metropolen und erlebt Europas Meisterwerke. Ob das Kolosseum oder der Eiffelturm, die Mona Lisa, Beethovens Neunte oder die Songs der Beatles, Platons „Staat“ oder Shakespeares „Sturm“. Immer wieder gelang es den Europäern, mit klassischen Werken zeitlose Geltung zu erschaffen. Romanik, Gotik, Barock, Jugendstil, Klassizismus und Bauhaus sind Begriffe aus dem Vokabular europäischer Architekturgeschichte. Euripides’ „Medea“, Shakespeares „Hamlet“, Bizets „Carmen“ und Puccinis „La Bohème“ sind von den Weltbühnen nicht wegzudenken.Hinzu kommt eine große Zahl bahnbrechender Entdeckungen und technischer Erfindungen, ob die Dampfmaschine, die Batterie, das Automobil oder Flugzeug, das Penicillin oder die Kernspaltung. Auch bei der Entwicklung der Kommunikationstechnik, bei Telefon, Radio, Fernsehen und Computer, standen Köpfe aus Europa Pate. Physiker, Chemiker und andere Naturwissenschaftler waren stets führend in der Riege der Nobelpreisträger. Fast immer, wenn man von klassischen Epochen spricht, von Errungenschaften mit zeitloser universeller Geltung und Ausstrahlung, führen die Wege nach Europa. In der vierten Folge der „Europa-Saga“ geht es um herausragende Namen, bedeutende Werke und ihre Wirkung, um Europäisches, das zum Weltmaßstab wurde. Es geht aber auch um Anmaßung und darum, dass Europa vor allem seine technische Überlegenheit gegenüber anderen ausspielte, ohne Rücksicht und Toleranz. Nicht ohne Grund ist die Kritik am Fortschritt so alt wie viele Errungenschaften selbst. Kaum ein Kontinent hat die Erde so nachhaltig geprägt wie Europa – im Guten wie im Schlechten. Und so steht seine glanzvolle Geschichte und Kreativität auch für rücksichtslose Plünderung von Ressourcen und Ausbeutung der Welt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 12.11.2017 ZDF Die Europa-Saga: 5. Was uns eint – was uns teilt
44 Min.Im Lauf der Jahrhunderte reift die Idee der europäischen Einigung. Dieser Teil der „Europa-Saga“ zeigt Versuche, Europa zur Einheit zu formen: mal mit Gewalt, mal mit Vernunft. Sir Christopher Clark besucht Schauplätze großer Konflikte und Einigungsbemühungen. Erst spät setzt sich in Europa die Überzeugung durch, dass ein Miteinander den Völkern mehr dient als ein Gegeneinander. Es folgte der Aufbruch in die Europäische Union. Der Gedanke an ein Europa freier Völker entstand im Zeitalter der Aufklärung. Zum Schlüsselereignis aber wurde die Französische Revolution 1789. Viele Menschen in Europa ließen sich von den Verheißungen der revolutionären Dreifaltigkeit begeistern: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es war die Botschaft an das kommende Jahrhundert.Es ging um freiheitliche Verfassungen und politische Mitbestimmung, auch um die Vision eines einigen Europas der freien Völker. Ideen, die auch bei weiteren Revolten gegen die Monarchien oder internationalen Kundgebungen wie auf dem Hambacher Fest 1832 eine Rolle spielten. Doch erst nachdem Nationalismus, Imperialismus, Diktaturen und Weltkriege den Kontinent in den Abgrund gestürzt hatten, mehrten sich die Stimmen für ein freiheitliches und geeintes Europa. Mit der Gründung des Europarates und der ersten Europäischen Gemeinschaften in den 50er Jahren wurde der Grundstein gelegt, nahm der Zusammenschluss demokratischer Staaten Gestalt an – zunächst im Westen, nach dem Fall der Mauer auch in Osteuropa. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 19.11.2017 ZDF Die Europa-Saga: 6. Wo wir stehen – was uns bleibt
44 Min.Brexit, Finanzkrisen und Flüchtlingswellen haben in Europa Skepsis an die Stelle früherer Aufbruchstimmung rücken lassen. Doch es gibt auch Optimismus. Quo vadis, Europa? Professor Christopher Clark zeigt auf seiner Reise durch die europäischen Metropolen, wie wir Gemeinsames erzielt haben, von dem die Gründer nur zu träumen wagten: das Ende des Kalten Krieges, die Öffnung nach Osten, die große Zahl der Mitglieder, eine Währung. Der Fortschritt der Einigung zeigt in Zeiten der Krise auch seine Schattenseiten: mangelnde Übereinstimmung unter den vielen Partnern, Zweifel an gemeinsamen Werten, nationale Rückbesinnung, weil europäische Lösungen ausbleiben oder auf sich warten lassen.Es sind gleich mehrere Konfliktherde, die das Gemeinschaftswerk auf die Probe stellen. Was können die Leitlinien sein für die Zukunft Europas? Am derzeitigen „Staatenverbund“ festhalten oder die Bahn frei machen für eine Bundesrepublik Europa? Mehr Kompetenzen in zentralen Politikbereichen zulassen oder doch eher etwas zurückrudern? Es bleibt wohl auf absehbare Zeit erst einmal beim Krisenmanagement, beim Navigieren auf Sicht. Dennoch: Die Freude, der „schöne Götterfunke“, von dem Schillers „Ode“ und das Motiv aus Beethovens „Neunter“ als Europa-Hymne künden, ist nicht erloschen. Denn jeden Tag machen Menschen in Europa eine großartige Erfahrung: Es gibt das Europa der gemeinsamen Kultur, des selbstverständlichen Austauschs, der alltäglichen Begegnung, der Freizügigkeit, der Musik und des Sports – vom Eurovision Song Contest bis zur Champions League. Was sagen die Umfragen? Wie denken die Bürger über die Union, wie über ihre Nachbarn, was erwarten sie von der gemeinsamen Zukunft? Quo vadis, Europa? Darauf sucht Christopher Clark in der letzten Folge der „Europa-Saga“ Antworten. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 26.11.2017 ZDF Exodus? – Eine Geschichte der Juden in Europa (1)
45 Min.Der Historiker Christopher Clark begibt sich auf der Suche nach den Spuren jüdischer Geschichte auf eine Reise von Jerusalem zu den Zentren jüdischen Lebens in Europa. Nach der Zerstörung des jüdischen Tempels durch die Römer und dem Verlust der Heimat wird die Tora, die Heilige Schrift, zum Zentrum jüdischer Identität auf der Wanderschaft. Sie wird „zum portativen Vaterland“, wie Heinrich Heine sagte, eine Heimat zum Mitnehmen. Mit Christopher Clark unternimmt der Film eine Reise zu den Zentren jüdischen Lebens in Europa.Als das römische Reich im 4. Jahrhundert christlich wird, siedeln Juden schon überall auf dem Kontinent. Vor allem in Sepharad, der Iberischen Halbinsel, und in Aschkenas – hebräisch für die deutschsprachigen Länder. Viele Herrscher, auch Karl der Große, stellen jüdische Bewohner als gleichwertige Bürger unter ihren Schutz. Zwei Dinge tragen dazu bei, dass diese Haltung im Verlauf des Mittelalters in offene Feindseligkeit umschlägt. Zum einen das Entstehen von christlichen Handwerkszünften, zu denen Juden nicht zugelassen sind. Zum anderen das Zinsverbot für Christen, das es untersagt, anderen Christen gegen Zinsen Geld zu verleihen. Aus den meisten Berufen per Gesetz verdrängt, nutzen Juden häufig diese Nische und werden Geldverleiher. So kommt das Feindbild vom „geldgierigen Juden“ in die Welt. Zur großen Zäsur für die Juden Europas werden die Kreuzzüge. Beim Durchzug der Kreuzfahrerheere kommt es zu schweren Judenverfolgungen in Frankreich und Deutschland. Es sind die ersten organisierten Pogrome des Abendlandes. Trotz aller Schutzbemühungen der Kaiser verschlimmert sich die Lage der Juden in Zentraleuropa. Gründe, die Juden zu verfolgen, gibt es aus christlicher Perspektive genug: Die Juden gelten als Christus-Mörder. Sie assimilieren sich nicht und halten stattdessen an ihrer Religion fest. Immer häufiger müssen sie als Blitzableiter für Krisensituationen herhalten. Vor allem, als 1347 die Pest ausbricht, die innerhalb von knapp zehn Jahren ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahinrafft. Angeblich haben Juden die Brunnen vergiftet. Ein tödliches Gerücht. Es hat die größte Verfolgungs- und Vernichtungsaktion in der Geschichte der Juden vor der Schoah zur Folge. 1492 werden die sephardischen Juden aus Spanien vertrieben. Sie ziehen unter anderem in den Maghreb und das Osmanische Reich. Die meisten Aschkenasim suchen in Polen Schutz, wo bald mehr als zwei Drittel aller europäischen Juden leben. In Krakau, Lublin, Lemberg, Vilnius gründen sie ihre Schtetl, in denen sich die typisch osteuropäisch-jüdische Kultur herausbildet. Aber die Mehrheit der Juden ist im 18. Jahrhundert arm. Die Ghettos sind überfüllt. Hoffnung auf Besserung für die Lage der jüdischen Mehrheit bringt die Französische Revolution mit ihren Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die alte Feudalgesellschaft und ihre Zunftzwänge lösen sich auf. Der große Dichter der Aufklärung, Gotthold Ephraim Lessing, wagt es 1783 zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Theaters, die Figur eines „edlen Juden“ auf die Bühne zu stellen: Nathan der Weise. Auch das Judentum selbst wird von den Idealen der Aufklärung erfasst, wie das Beispiel des Philosophen Moses Mendelssohn zeigt. Den einen gilt er als Vorreiter einer jüdischen Emanzipation, den anderen als Verräter an der Religion und traditionellen Lebensweise. Damals kommt es zu einer Aufspaltung des Judentums. In Abgrenzung zu den „Reformjuden“ leben Orthodoxe weiter ein Leben, in dessen Zentrum die Tora steht. Bis heute leben in der ganzen Welt Nachkommen dieser auf Tradition und die Ursprünge hin orientierten orthodoxen Juden. Die Emanzipation der Juden, das heißt, die Abschaffung antijüdischer Gesetze, die sich nach den Napoleonischen Kriegen auch in Deutschland langsam durchsetzt, erzeugt neue Konflikte. Viele Bürger fürchten die Konkurrenz durch die Juden, die jetzt erstmals Zugang zu allen Berufen und Ämtern haben. Zudem fördert der aufkeimende Nationalismus antisemitische Tendenzen. Die Zugehörigkeit zur Nation wird weniger kulturell als völkisch interpretiert, als eine Sache des „Blutes“. Dadurch werden Juden aufs Neue ausgegrenzt. Das muss auch der junge Theodor Herzl, Sohn einer säkularisierten jüdischen Familie aus Ungarn, erfahren. Von 1894 bis 1895 berichtet er als Korrespondent einer Wiener Zeitung über den Prozess gegen den jüdischen Hauptmann Dreyfus, der unschuldig wegen Landesverrats zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Die antisemitische Hetze und Ausschreitungen gegen Juden, die den Prozess begleiten, lassen Herzl zu dem Schluss kommen, dass Vernunft und Assimilation gegen Judenhass wirkungslos sind. Nur in einer jüdischen Nation können sie unbehelligt leben. Der Zionismus ist geboren. Die Mehrzahl der deutschen Juden steht dem Zionismus skeptisch gegenüber. Sie wollen lieber in ihrem Deutschland bleiben. Sie sind der festen Überzeugung, dass es möglich ist, einfach Deutscher zu sein – und Jude. Ein Traum, der für sie im deutschen Kaiserreich nahezu in Erfüllung gehen wird. Teil zwei, „Exodus? – Antisemitismus in Europa“, wird am Dienstag, 6. November 2018, um 20:15 Uhr ausgestrahlt. (Text: ZDF) Deutsche TV-Premiere So. 04.11.2018 ZDF Expedition Anden: 1. Gebirge in Bewegung
45 Min.Nach Wasser ist Sand der meistverbrauchte Rohstoff der Welt. Die Atacama ist die trockenste Wüste der Erde. Teile der Atacama haben seit Jahrhunderten keinen Tropfen Wasser gesehen.Bild: ZDF and Ole GurrDie Anden – ein Gebirge voller Kraft: Vulkane steigen auf, die Erde bebt, Rohstoffe entstehen. Geologe Colin Devey begibt sich auf Expedition, um die Kräfte des Erdinneren zu erforschen. Seine Reise führt vom alten Inka-Erbe in Cusco bis ins raue chilenische Hochland. Überall spürt man die Kraft des Erdinneren. Tektonik, Vulkane und Rohstoffe verwandeln die Anden in ein Naturlabor – und stellen die Menschen immer wieder vor Herausforderungen. Die Anden sind das längste Gebirge der Welt – und geologisch so aktiv wie kaum ein anderes. Ihre vielfältigen Landschaften unterliegen einem ständigen Wandel. Die Anden wachsen und verändern sich Tag für Tag – doch welche Kräfte treiben sie an? Der Geologe Colin Devey begibt sich auf eine Reise entlang des Gebirges, um Erdbeben, Vulkanismus und die tektonischen Kräfte des Erdinneren zu erforschen.In Cusco, der alten Hauptstadt der Inka, erlebt er hautnah, wie Erdbeben das Leben seit Jahrhunderten prägen. Die Anden erzählen jedoch nicht nur von der Geschichte, sondern sind auch ein lebendiges Labor der Natur. Im Süden flacher, im Norden höher, treibt die Subduktion als tektonische Kraft das Wachstum des Gebirges voran – sichtbar auch durch die vielen Vulkane. Am Vulkan Cotopaxi erlebt Colin Devey die bedrohliche Schönheit aktiver Feuerberge. Der höchste Gipfel, der Aconcagua, wächst durch die Subduktion der Nazca-Platte, die als ozeanischer Gebirgszug unter Südamerika abtaucht. Und selbst die Tierwelt des Amazonas liefert Einblicke, wie Plattenbewegungen ganze Kontinente einem stetigen, wenn auch langsamen Wandel unterwerfen. Im Hochland von Chile zeigt sich: Mit der Entstehung der Vulkane und dem Aufstieg der Anden entstehen Rohstoffe – doch ihr Abbau wirft entscheidende Fragen für unseren Umgang mit der Natur auf. Eine bewegte Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart entlang des längsten Gebirges der Welt. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.11.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 16.11.2025 ZDF Expedition Anden: 2. Die Kraft von Wind und Wasser
45 Min.Der Grey-Gletscher legt täglich bis zu zwei Meter zurück. Er ist Teil des patagonischen Eisfelds.Bild: ZDF und Ole GurrVon Patagoniens Gletschern bis zur Atacama-Wüste erkundet Geologe Colin Devey, wie Wind, Eis und Wasser die Anden formen. Ein Naturlabor, in dem atmosphärische Kräfte Landschaften bilden. Vom Vulkan Chimborazo aus durchwandert er alle Klimazonen und folgt dem Wasser gen Osten bis zum Amazonas. Im Westen herrscht extreme Trockenheit. In der Atacama-Wüste, mit einer der größten Lithiumlagerstätten der Welt, trotzen Mensch und Natur extremen Bedingungen. Die Anden sind geprägt von Hochebenen, Canyons, schroffen Bergen, Wüsten und Gletschern. Doch nicht nur Kräfte aus dem Erdinneren formen diese Landschaften – auch die Atmosphäre spielt eine entscheidende Rolle.Auf seiner Reise beantwortet Geologe Colin Devey die Frage, wie Wind, Eis und Wasser die längste Gebirgskette der Erde gestalten. In Patagonien schleifen tosende Winde und gigantische Gletscher Täler ins Gebirge. Der ständige Wechsel von Frost und Tau lässt selbst massive Felsen langsam zerfallen. Auf dem Chimborazo folgt Colin Devey dem Weg des Naturforschers Alexander von Humboldt, durchwandert alle Klimazonen – von schneebedeckten Gipfeln bis ins Amazonasbecken. Er besucht das Ursprungsgebiet der Kartoffel und erfährt, wie Artenvielfalt die Nahrungsmittelsicherheit der Zukunft sichern kann. Er erkundet, warum der kalte Humboldtstrom vor der Westküste Südamerikas extreme Trockenheit im Hinterland und die höchste Sonneneinstrahlung der Erde verursacht. Die Atacama-Wüste ist daher der perfekte Ort, um ins Weltall zu blicken. Schon die indigenen Völker dachten dort über den Ursprung des Lebens nach. Und heute werden mit raffinierten Methoden selbst in der trockensten Wüste Weinberge kultiviert. Für Colin Devey sind die Anden ein geologisches Labor der Extreme, in dem die Kräfte der Atmosphäre ihre spektakulärsten Kunstwerke schaffen. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 12.11.2025 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 23.11.2025 ZDF Expedition Deutschland – Das Vermächtnis der Steine (1): Deutschlands Norden
45 Min.Die Feldberger Seen sind Spuren der letzten Eiszeit. Unter dem Eis der Gletscher abfließendes Schmelzwasser schuf rinnenartige Vertiefungen, die sich mit Wasser füllten. Einige der Seen sind bis zu 60 Meter tief.Bild: Ricardo Esteban Garzon Mesa / ZDFEiszeiten, urzeitliche Meere und ein gigantisches Gebirge formten die Landschaften des Nordens. Colin Devey enthüllt geologische Zusammenhänge, die uns alle bis heute beeinflussen. Die Ostseeküste, eine seenreiche Tiefebene, malerische Mittelgebirge oder die Schönheit norddeutscher Landschaften zeugen immer auch von einer bewegten Erdgeschichte. Und Colin Devey zeigt, wie unser aller Leben mit dem Vermächtnis der Steine verknüpft ist. Die Expeditionshalle des GEOMAR in Kiel ist Colin Deveys Ausgangspunkt für eine geologische Wanderung durch Norddeutschland.Das Hinterland der Küste mag beschaulich wirken, aber das ist nur die Oberfläche. Colin Devey blickt darunter, denn dort offenbart sich allzu oft eine turbulente Vergangenheit. Einen Steinwurf entfernt – an der Ostseeküste – steigt der Meeresspiegel. Und das ohne Einfluss des Klimawandels. Die Küstenbewohner sind bis heute den Nachwehen der letzten Eiszeit ausgesetzt, obwohl sie vor ungefähr 12 000 Jahren endete. Im Norddeutschen Tiefland hat sich die Fracht der Gletscher verteilt. Sand und riesige Findlinge sind steinerne Zeugen, die durch die Kraft der Eismassen von Skandinavien bis in den Norden Deutschlands transportiert wurden. Das Schmelzwasser der abtauenden Gletscher schuf rinnenartige Vertiefungen. Daraus entstanden ist die Feldberger Seenlandschaft. Dort liegt der älteste Buchenwald Deutschlands. Er zeugt davon, wie einst die Urwälder in unserem Land ausgesehen haben, und dient der Wissenschaft als wichtige Referenz in Zeiten des Klimawandels. Ein Blick in das unterirdische Norddeutschland zeigt einen verborgenen Schatz, der unser Leben prägt. Über 900 Meter dicke, mächtige Salzlager schlummern unter der Erde – es sind Ablagerungen aus der Zeit des Zechsteinmeeres von vor über 250 Millionen Jahren. Auch unsere Mittelgebirge erzählen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Sie sind die Überreste eines weltumspannenden Gebirges – der Varisziden, bis zu 400 Millionen Jahre alt. Im Harz am Brocken zeugen die Gesteine von einer feurigen Vergangenheit. Der höchste Gipfel Norddeutschlands ist nämlich eine erstarrte Magmakammer, die einst einen Vulkan speiste. Im Erzgebirge sucht Colin Devey das Element Uran. Es bildet die Grundlage für das Atomzeitalter und machte es zudem im 20. Jahrhundert erstmals überhaupt möglich, das Alter unseres Planeten sicher zu bestimmen. Im dicht besiedelten Ruhrgebiet liegt gut versteckt ein Schachtelhalmwald. Er erinnert im Miniaturformat an die hier ausgedehnten Sumpfwälder zur Zeit des Karbons vor circa 300 Millionen Jahren. Aus ihnen bildeten sich in langen biochemischen Prozessen die enormen Steinkohlevorkommen in der Region. In einem überfluteten Bergwerk taucht Colin Devey tief ein in die Geschichte dieser Region. Sein Ausflug in die überfluteten Stollen macht deutlich, dass das Ruhrgebiet ohne den Eingriff des Menschen unbewohnbar und auch heute noch eine Sumpflandschaft wäre. Die Eifel ist die wohl bekannteste Vulkan-Region Deutschlands. Ihre typischen Maarseen zeugen von einer explosiven Vergangenheit, die erst vor knapp 10 000 Jahren vorläufig zur Ruhe kam. Colin Devey erklärt, dass die Geschichte der Eifel eng mit dem Aufstieg von Gasen verknüpft ist. Als „Atem der Vulkane“ wird hier das CO2 bezeichnet, das sich auf dem Weg vom Erdinneren nach oben mit Wasser zu Kohlensäure verbindet und zahlreiche Mineralwasser-Quellen an der Oberfläche bildet. Diese Quellen erfreuen nicht nur die Menschen, sondern auch die Roten Waldameisen, die entlang von natürlichen Gasaustritten ihre Nester bauen. So dienen sie unbewusst auch Wissenschaftlern als Indiz für zunehmende geologische Aktivität in der Region. Schließlich erreicht Colin Devey den südlichen Rand der Mittelgebirge. Dort, im Herzen Deutschlands, liegt die Metropole Frankfurt am Main. Von deren höchstem Punkt – dem Europaturm – hat er einen perfekten Blick auf die geologische Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 15.09.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 19.09.2021 ZDF Expedition Deutschland – Das Vermächtnis der Steine (2): Deutschlands Süden
45 Min.Colin Devey auf dem Weg zur Zugspitze. Auf dem Zugspitzplateau trifft er weitere Wissenschaftler, um sie in ihre Forschungsstation im Steilhang unter dem Zugspitzgipfel zu begleiten.Bild: Ricardo Esteban Garzon MesaDie Entstehung der Alpen, wandernde Flüsse und tropische Meere formten Deutschlands Süden. Devey erklärt die geologischen Zusammenhänge und wie sie unser Leben heute noch beeinflussen. Vom Pfälzer Wald, entlang der Donau bis hin zu den majestätischen Gipfeln der Alpen – die Schönheit süddeutscher Landschaften zeugt immer von einer bewegten Erdgeschichte – und Colin Devey zeigt, wie unser aller Leben mit dem Vermächtnis der Steine verknüpft ist. Im zweiten Teil setzt der Geologe Colin Devey seine Wanderung durch Deutschland fort.Er beginnt im größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands – dem Pfälzer Wald. Farbenprächtige Buntsandsteinfelsen mit unzähligen Burgen und Ruinen überragen die Baumkronen. Auch in den Gebäuden der Pfalz ist der Buntsandstein allgegenwärtig. Über Millionen Jahre aus Wüstensand gepresst, ist er heute das prägende Baumaterial der Region, und in manchen Weinen der Pfalz kann man ihn sogar schmecken. An den Pfälzer Wald grenzt der tektonisch aktive Oberrheingraben, der als die wärmste Region Deutschlands gilt. Auf seinem Weg gen Süden überfliegt Colin Devey die fruchtbare Rheinebene, die vom Schwarzwald und den Vogesen eingerahmt wird. Östlich des Schwarzwaldes folgt er der noch jungen Donau, die sich schon bald einen Weg durch die steilen Kalkfelsen bei Beuron bahnt. Sie sind Ablagerungen eines urzeitlichen Meeres, einst bewohnt von den größten Meeresreptilien aller Zeiten. Flussabwärts im Nördlinger Ries zeigt sich, dass geologische Prozesse nicht immer Jahrmillionen brauchen, sondern auch in Sekundenschnelle vonstattengehen können. Am Donaudurchbruch beim Kloster Weltenburg deckt Colin Devey auf, dass diese Schlucht jedoch nicht das Werk der Donau ist. Der Bayerische Wald ist ein wahrer Flickenteppich der Gesteine. Kaum eine andere Region Deutschlands ist geologisch so vielfältig. Sie wird von einer rätselhaften Gesteinsformation durchzogen, die sich über 150 Kilometer durch die Landschaft erstreckt. Um herauszufinden, was sich an der Linie des bayerischen Pfahls abgespielt hat, begibt sich Colin Devey tief in den herbstlichen Bayerischen Wald und seine geologische Geschichte hinein. Er erklärt, woraus verschiedene Gesteine bestehen und welche Erkenntnisse für die Entstehung der Landschaft darin stecken. Im Alpenvorland folgt Colin Devey der Isar nach München. Der Fluss ist ein geologisches Förderband für Gesteinsschutt aus den Bergen. An den Kiesbänken des Flusses wird das besonders deutlich. Jeder einzelne Kiesel am Flaucher in München – einer Art Erholungsgebiet entlang der Isar – wurde über Jahrmillionen aus verschiedenen Teilen der Alpen hierher transportiert. Für Colin Devey sind sie ein Archiv des Gebirges, und wenn man tief genug darin bohrt, stößt man sogar auf heißes Thermalwasser, mit dem die Alpenmetropole bald ihre Häuser heizen will. Auf seiner letzten Etappe unternimmt Devey eine winterliche Expedition, um die Berge und ihren Wandel zu erforschen. Für uns Menschen scheinen Berge für die Ewigkeit gemacht, aber auch sie werden instabil. Bestes Beispiel: die Zugspitze. Der höchste Berg Deutschlands war einst mehr als 3000 Meter hoch. Doch vor rund 40 000 Jahren brach binnen weniger Minuten ein 900 Meter hoher Felskeil aus der Nordflanke und stürzte ins Tal. Die Inseln des darunterliegenden Eibsees zeugen von diesem dramatischen Ereignis. Tief im Herzen der Zugspitze will Colin Devey herausfinden, ob der Berg noch einmal auseinanderzubrechen droht – denn der menschengemachte Klimawandel zeigt selbst hier seine Spuren. Der Permafrost, der den Berg zusammenhält, beginnt zu schmelzen und macht die Felsstruktur instabil. Es verdeutlicht einmal mehr, dass die Landschaften, in denen wir leben, auch heute ständig in Bewegung sind. (Text: ZDF) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 15.09.2021 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere So. 03.10.2021 ZDF Expedition Deutschland – Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (1)
45 Min.Die verträumte Einsamkeit des Wattenmeeres, die Vielfalt deutscher Mittelgebirge, die majestätischen Alpen: Viele deutsche Landschaften sind in ihrer Schönheit einzigartig auf der Welt. Aber wie ist Deutschland zu dem Land geworden, das wir heute kennen und lieben? Auf einer Reise in die Vergangenheit erleben wir, wie sich in 500 Millionen Jahren die Erde und unser Land verändert haben. Die spannende Expedition führt zu den schönsten und erstaunlichsten Landschaften unserer Heimat. Zwischen Taunus und Westerwald finden wir uralte geheimnisvolle Riffe, 380 Millionen Jahre alt.Im Bayrischen Wald stoßen wir auf die Reste einer gigantischen Kollision von Erdplatten, eine der größten in der Geschichte der Erde. Wir zeigen, wie die Mangrovensümpfe an der Stelle des heutigen Ruhrgebietes vor 300 Millionen Jahren Kohle produzieren, beobachten die Entstehung der Alpen und besuchen die Eifelvulkane bei einem ihrer Ausbrüche vor 100 000 Jahren. Naturkatastrophen bringen immer Zerstörung mit sich, sind aber gleichzeitig auch Fundament für neue Entwicklungen. Über aufwändige Computeranimationen erleben wir in der zweiteiligen Dokumentation die Entstehung unserer Landschaften hautnah mit. Führende Wissenschaftler lassen die spannenden Vorgänge an den Hotspots begreifen, so dass wir am Ende die bekannten und unbekannten Naturschönheiten Deutschlands mit anderen Augen sehen. Wir reisen in die Zeit vor 500 Millionen Jahren. Die Erde hatte damals ein ganz anderes Gesicht. Die Landmassen der Kontinente befanden sich zum größten Teil auf der Südhalbkugel des Planeten, die einzelnen Teile Deutschlands waren weit verstreut. Wir entdecken den kambrischen Ozean – ein Urmeer, in dem sich die ersten Räuber tummelten. Zwischen Taunus und Westerwald finden wir Spuren aus dieser Zeit, als Süddeutschland auf dem Grund eines tropischen Ozeans mit riesigen Riffen lag, ganz ähnlich wie das Great Barrier Reef Australiens heute. In den urigen Gebieten des Bayrischen Waldes führt eine Superbohrung kilometertief in die Erde bis zu den Überresten einer Megakollision von Landmassen. Unsere Mittelgebirge sind Zeugen dieser Urkräfte, heute attraktive Ziele für Erholung und Freizeit. Im heutigen Ruhrgebiet erstreckten sich in der Karbonzeit Wald- und Sumpflandschaften. Vor 300 Millionen Jahren lebten hier riesige Insekten zwischen gigantischen Schachtelhalmen, sicher eine der skurrilsten Lebenswelten auf deutschem Boden. Diesen Karbonwäldern verdanken wir die enormen Kohlevorkommen, die das Ruhrgebiet in modernen Zeiten zum wirtschaftlichen Motor Deutschlands gemacht haben. Wer Chemnitz am Fuße des Erzgebirges besucht, ahnt nichts vom dem spannenden Untergrund, auf dem diese Stadt ruht: ein komplett versteinerter Urwald. Entstanden ist er durch einen gigantischen Vulkanausbruch vor 290 Millionen Jahren. Doch nicht nur Urmeere und Kräfte aus dem Erdinneren formten unsere Heimat, auch das Klima führte immer wieder zu großen Veränderungen. Die auffälligen, landschaftsprägenden Felsen im Pfälzer Wald zum Beispiel sind heute eine Herausforderung für Kletterer. Keiner denkt dabei an die ehemalige Wüstenlandschaft, aus der sie stammen. Bewohnt wurden die Wüsten in der Jura- und Kreidezeit von Dinosauriern, den größten Giganten, die jemals in unserer Heimat gelebt haben. Auch im Ozean dieser Zeit, dem Jura Meer, schwammen riesige Saurier und hinterließen in der Schwäbischen Alb ihre Spuren. Über die Jahrmillionen formten sich Landschaft und Tierwelt in Deutschland immer wieder neu und schufen erstaunliche Welten. Verschiedenste Lebewesen traten auf und verschwanden. Und doch hinterließen sie alle ihre Spuren. Zusammen mit den Urgewalten des Planeten schufen sie das Deutschland, das wir heute kennen. Teil 2 wird direkt um Anschluss, um 19:30 Uhr, ausgestrahlt. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 14.12.2013 ZDFneo Expedition Deutschland – Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre (2)
45 Min.Teil zwei der Reise startet vor 100 Millionen Jahren. Ein markantes Ereignis prägt Deutschland ganz besonders und verleiht ihm sein heutiges Aussehen: das Auftürmen der Alpen. Afrika drückt mit aller Gewalt gegen Europa und schiebt dabei das mächtige Gebirge auf. Wer heute durch die Alpen wandert, bewegt sich auf den Überbleibseln eines ehemaligen Meeresbodens. Vielerorts bestimmen die mächtigen und schroff emporragenden Kalkfelsen heute das Panorama des gewaltigen Gebirgsmassivs. Dort, wo Deutschlands bekanntester Fluss seinen Weg durch das Rheintal von den Alpen bis nach Norden findet, waren vor 35 Millionen Jahren Haie, Seekühe und Rochen zuhause.Sie bevölkerten einen warmen Meeresarm, der das Urmittelmeer mit der Nordsee verband. Die Finanzmetropole Frankfurt an einer Südseeküste, so manch einer träumt davon. Auch die Tierwelt an Land hat sich noch einmal grundlegend verändert. Längst sind die Dinosaurier ausgestorben und haben Säugetieren und Vögeln Platz gemacht. Immer noch brodelt es unter deutschem Boden, die Erde wird von Erdbeben erschüttert, Vulkane beherrschen überall das Land. Ein Krater ganz anderer Herkunft liegt heute im Herzen von Süddeutschland. Aus der Satellitenperspektive erkennt man ein riesiges, kreisrundes Loch, 25 Kilometer im Durchmesser, zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb: das Nördlinger Ries. Vor 15 Millionen Jahren schlug hier ein gewaltiger Meteorit ein. Kaum ein Land in Mitteleuropa ist so abwechslungsreich wie Deutschland: vom Hochgebirge, sanften Kuppen der Mittelgebirge, weiten Flusslandschaften, ausgedehnten Seenplatten bis hin zu vielgestaltigen Küsten. Viele dieser Landschaften verdanken wir den Eiszeiten. Mächtige Gletscher hatten Deutschland vom Süden und Norden fest im Griff. Viele Zeugen dieser Zeit gibt es zu entdecken, so einen mächtigen Felsblock am Rand des Hamburger Hafens. Bis dorthin wurde der „alte Schwede“ vom Eis geschoben. Erst vor 40 000 Jahren eroberte der Mensch Schritt für Schritt diese Welt. Und seitdem hinterlässt auch er deutliche Spuren. Die erdgeschichtlichen Vorgänge, die über Jahr Millionen unser Land geformt und verändert haben, können wir in ihrer zeitlichen Dimension kaum fassen. Alles Menschenwerk spielt sich dagegen vergleichsweise in einem Wimpernschlag der Geschichte ab. Auch in Zukunft wird es keinen Stillstand geben, unser Land ist und bleibt in Bewegung. Auf unserer Zeitreise durch 500 Millionen Jahre haben wir erfahren, wie winzig der Abschnitt ist, den wir als Menschen miterleben. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere Sa. 14.12.2013 ZDFneo Expedition Erde: 1. Vulkane
45 Min.Vulkane gelten allgemein als gefährlich und zerstörerisch. Sie bedrohen den Menschen und seine Habe durch Lavaströme, Ascheregen und giftige Gase. Der erste Teil der BBC/ZDF-Reihe beweist entgegen dieser Vorurteile, dass die Feuer spuckenden Berge während der langen Geschichte der Erde nicht nur für Negativschlagzeilen sorgten. Thomas Reiter besucht einige der vulkanisch aktivsten Zonen unseres Heimatplaneten und macht deutlich, welche wichtige Rolle Vulkane bei der Entstehung des Lebens spielten. Keine andere Kraft hatte in der Erdgeschichte so großen Anteil an der Gestaltung und Umgestaltung der Welt wie sie. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 21.09.2008 ZDF Expedition Erde: 2. Ozeane
45 Min.Bild: Peteri/ShutterstockDie Ozeane der Welt sind fast so alt wie die Erde selbst. Schaut man auf das Meer, kann man einen Blick genießen, der sich seit Milliarden Jahren nicht verändert hat. Aber die Ozeane sind viel mehr als ein uraltes Wasserreservoir. Sie formen und verändern den Planeten. An den Küstenlinien der Erde kann man sehen, wie ihre enormen Kräfte das Land abtragen und so die Form eines jeden Kontinents bestimmen. Die Weltmeere sind für das Klima verantwortlich, und in ihren Tiefen soll sogar das Leben entstanden sein. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 28.09.2008 ZDF Expedition Erde: 3. Atmosphäre
45 Min.Man kann sie weder sehen noch riechen oder schmecken, trotzdem wäre alles Leben auf der Erde ohne sie zum Untergang verurteilt. Die Atmosphäre ist der Schutzschild unseres Heimatplaneten. Sie hüllt den Globus in eine warme, feuchte Schicht, bewahrt uns vor gefährlichen Strahlen aus dem All und hält den Sauerstoff bereit, den wir zum Leben brauchen. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 05.10.2008 ZDF Expedition Erde: 4. Eis
45 Min.Für viele ist Eis nicht mehr als gefrorenes Wasser – eine fatale Fehleinschätzung. Seit Menschen auf der Erde leben, war Eis die dominante Kraft. Eiszeiten lösten Massensterben aus, und Gletscher gaben den Landschaften, die wir bewohnen, ihre Form. Vermutlich haben die Eismassen sogar mehrfach die Entwicklung unserer Art beeinflusst. (Text: ZDF)Deutsche TV-Premiere So. 12.10.2008 ZDF Expedition Erde: 5. Leben
45 Min.Im fünften und letzten Teil der BBC/ZDF-Reihe „Expedition Erde“ fragt Thomas Reiter nach der besonderen Rolle der Erde, die durch eine Vielzahl von außergewöhnlichen Bedingungen Heimat für das Leben werden konnte. Sie hat tatsächlich eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht: Innerhalb von viereinhalb Milliarden Jahren verwandelte sich der Planet von einem leblosen Gesteinsbrocken in die bunte, vielfältige Welt, wie wir sie heute kennen. Diese Entwicklung geschah keineswegs linear, die Biografie der Erde ist eine Auflistung von Zerstörung und Neuanfang. Thomas Reiter hat sich mit einem ZDF-Fernsehteam auf die Suche nach Hinweisen gemacht, die die wichtigsten Wendepunkte in der Erdgeschichte illustrieren.Im Dschungel Mexikos wurde er fündig. Dort taucht der Moderator in einer Höhle, die sich als Teil eines weitläufigen Tunnelsystems entpuppt. Erst kürzlich stellten Höhlentaucher fest, dass dieses System aus Durchgängen und überschwemmten Höhlen fast die gesamte Halbinsel Yucatan durchzieht. Aber erst moderne Geosatellitentechnologie ermöglichte den Wissenschaftlern herauszufinden, welchen Ursprung die geheimnisvollen Höhlen haben. Messungen aus dem All zeigen, dass sich die Höhlen am Rand einer gewaltigen trichterförmigen Struktur gebildet haben. Diesen Krater hatte vor 65 Millionen Jahren der Asteroid geschlagen, der den Untergang der Dinosaurier besiegelte. Am Ende seiner spannenden Reise durch die Geschichte der Erde stößt Thomas Reiter auch auf Spuren, die eine vergleichsweise neue Kraft auf dem Planeten hinterlässt: unsere Spuren. Der Mensch ist zum bedeutenden Faktor für die Erde geworden. Er ist dazu in der Lage, ihre Oberfläche und ihr Klima zu verändern. Aus dem All konnte Thomas Reiter vor allem auf der Nachtseite der Erde erkennen, wie dominant der Mensch tatsächlich ist. Die Lichtermassen der Städte und Siedlungen verdeutlichen die Ausbreitung des Menschen auf dem Globus. Er ist der nächste entscheidende Faktor in der langen Geschichte der Erde. (Text: ZDFneo) Deutsche TV-Premiere So. 19.10.2008 ZDF
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Terra X direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Terra X und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail