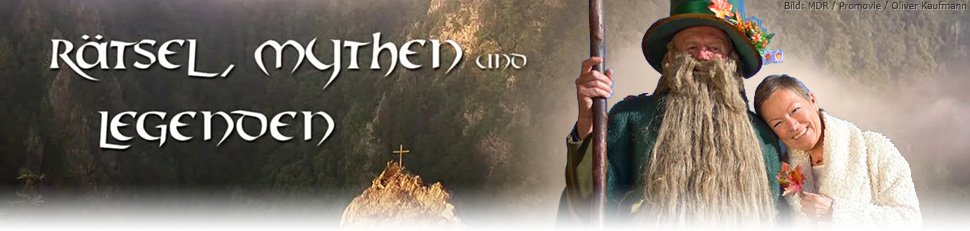bisher 28 Folgen (Folge 15–28)
Der Rabenfluch von Merseburg
Folge 15Ungeheuerliches ist einst in Merseburg geschehen: Ein Justizirrtum mit weitreichenden Folgen, in dem der Bischofsring des jähzornigen Landesherrn Thilo von Trotha, sein treuer Kammerdiener Hans und ein diebischer Rabe die Hauptrollen spielen. Der Widerhall dieses Fehlurteils ist in den altehrwürdigen Mauern der Domstadt bis heute zu spüren. Unsere Geschichte beginnt mit einem ehrlichen Handwerker, der bei Dacharbeiten auf den Zinnen der Domkirche eine furchtbare Entdeckung macht: Er findet den goldenen Siegelring des Bischofs in einem Rabennest. Dem Mann ist sofort klar, dass er jetzt einen der schlimmsten Justizirrtümer im frühen 16. Jahrhundert aufklären muss, denn mit diesem Fund wird offensichtlich: Nicht der Kammerdiener Hans hatte den wertvollen Ring gestohlen und musste dafür sterben, sondern ein diebischer Rabe war es, der den blinkenden Ring im Schnabel entführt hatte.Dieser Trugschluss hatte Folgen. Thilo von Trotha tat Buße: Zur Mahnung, niemals im Jähzorn zu richten, ließ er einen Raben in Gefangenschaft nehmen. Voller Reue ließ er sogar einen Raben mit goldenem Ring im Schnabel in das Familienwappen aufnehmen. So jedenfalls berichtet es die berühmte Merseburger Rabensage. Deren Wahrheitsgehalt will Janine Strahl-Oesterreich auf die Spur kommen. Ein Experiment mit einem Tiertrainer, einem goldenen Ring und einer Kameradrohne im Innenhof des Merseburger Schlosses soll dabei helfen. Wir wollen die Frage beantworten, ob Raben wirklich den diebischen Elstern an krimineller Energie ebenbürtig sind und ganze Schmuckstücke klauen, obwohl die weder schmackhaft noch zur Fütterung der Jungen geeignet sind. Von einem bekannten Ornithologen und Verhaltensforscher erfährt sie überraschende, noch unbekannte Eigenheiten der Rabenvögel. Bleibt die Frage, warum Raben bis heute so einen schlechten Leumund haben. Auch darauf findet sie verblüffende Antworten. Und einem weiteren Moment der Sage spürt die Moderatorin nach: Der Überlieferung zufolge soll der neidische Jäger Ulrich dem Raben des Kammerdieners die Worte „Hans – Dieb“ beigebracht haben, um ihn verdächtig zu machen, weil er beim Bischof in höherer Gunst stand. Den Wahrheitsgehalt auch dieser Intrige überprüft Janine Strahl-Oesterreich und versucht, mit Hilfe eines Tiertrainers mit den Rabenvögeln ins Gespräch zu kommen. Werden diese Sprechversuche gelingen? (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mo. 25.05.2015 MDR Wie Roßtrappe und Bode ihren Namen bekamen
Folge 16Vor langer Zeit – so erzählt man sich im Harz – wirbt der Riese Bodo um die schöne Königstochter Brunhilde. Sie aber weist ihn ab und entflieht heimlich auf ihrem weißen Ross. Das erzürnt Bodo und in rasender Wut verfolgt er sie auf seinem schwarzen Rappen. Voller Angst sucht Brunhilde einen Ausweg. Sie treibt ihr Pferd hoch auf die Felsen und steht plötzlich vor einem Abgrund. Als sie sich umsieht, ist der Verfolger ihr schon sehr nahe. In ihrer Verzweiflung gibt sie dem Pferd die Sporen und springt über den reißenden Fluss im Bergkessel.Tief gräbt sich der Hinterhuf des Pferdes in die Klippe ein. Riese Bodo setzt ihr nach. Während Brunhilde glücklich hinübergelangt, stürzt Bodo in die Tiefe. Seitdem heißt der Felsen Roßtrappe und der wilde Fluss Bode, so erzählt es die Sage. Was ist dran an dieser Sage? Gab es die Königstochter Brunhilde wirklich? Was hat ein Riese im Harz verloren? Stammt der Abdruck im Felsgestein wirklich von einem Ross? Auf dem Mythenweg in Thale beginnt Janine Strahl-Oesterreich ihre Spurensuche. Sie erfährt, dass das sagenumwobene hufähnliche Mal auf dem Roßtrappenfelsen schon seit Jahrhunderten die Phantasie der Menschen beschäftigt. Auch viele bedeutende Dichter wurden zu immer neuen Versionen inspiriert. Zu ihnen gehört auch Gottlieb Friedrich Klopstock, der zum Beispiel eine „Ode an die Rosstrappe“ schrieb. In seinem Geburtshaus in Quedlinburg forschen wir nach: Was erzählt er in seinem Gedicht über die Roßtrappe? Immerhin beschreibt er darin den „Fußtritt eines Riesenrosses“ im Felsen und äußert die Vermutung, dass Druiden diesen Ort für ihre Rituale genutzt haben. Janine Strahl-Oesterreich findet heraus, dass bis zum 3. Jahrhundert vor Christi keltische Stämme am Harz siedelten. Wie archäologische Funde belegen, liegt es nahe, dass die „Rosstrappe“ in heidnischer Zeit als eine Art Opferschale diente. Ist diese vielleicht natürlichen Ursprungs oder wurde sie von Menschen geschaffen? Und was haben dann die drei Vertiefungen innerhalb des „Hufabdruckes“ zu bedeuten? (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Sa. 31.10.2015 MDR Die Heinzelmännchen von Eilenburg
Folge 17„Wie war zu Köln es doch vordem, mit Heinzelmännchen so bequem“, so beginnt die bekannte Geschichte von den Heinzelmännchen, jenen winzigen Gesellen, die des Nachts in aller Stille fleißig gute Taten vollbrachten. Die treuen Helfer verschwanden aber wie vom Erdboden und kehrten nie wieder zurück, nachdem des Schneiders Weib in ihrer Neugier Erbsen ausstreute, über die die kleinen Wichte purzelten. Doch die Heinzelmännchen stammen gar nicht aus Köln, wie es die Geschichte suggeriert. Ihre Heimat liegt in dem beschaulichen Städtchen Eilenburg am Rande der Dübener Heide. Einst lebten sie dort in einem riesigen unterirdischen Labyrinth unter der Burg und der Stadt Eilenburg, so erzählt es die Sage.Dieses Labyrinth gibt es tatsächlich: ein großes Tunnel- und Kellersystem aus Ziegelsteinen. Neugierig macht sich Janine Strahl-Österreich auf den Weg, um die Geheimnisse der Eilenburger Heinzelmännchen zu ergründen. Sie will die ganze Wahrheit über Herkunft, Leben und Wirken der sagenhaften, scheuen Wesen erkunden und macht ganz erstaunliche Entdeckungen: Sie findet zum Beispiel heraus, dass die Sage „Des kleinen Volkes Hochzeitsfest auf der Eilenburg“, die sich auf der mittelalterlichen Burg in Eilenburg zugetragen haben soll, bereits 1818 von den Brüdern Grimm veröffentlicht wurde. Als Quelle gaben die Grimms eine mündliche Überlieferung aus Sachsen an, denn die Sage war bereits davor im deutschsprachigen Raum populär. Unsere Moderatorin erfährt, dass die Ballade „Hochzeitslied“ von Goethe, die später von Carl Loewe, dem berühmten Balladenkomponisten aus Löbejün vertont wurde, sich auf diese Geschichte bezieht. Im Volksmund wurde sie dann als Heinzelmännchensage bezeichnet. In der Gegenwart sind die possierlichen Sagengeschöpfe außerordentlich lebendig. Zum 1.050-jährigen Ortsjubiläum Eilenburgs im Jahre 2011 wurden sie offizielle Maskottchen der nordsächsischen Stadt an der Mulde. Wo aber liegt der Ursprung der Sage? Auch das wird unsere Moderatorin herausfinden. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Fr. 01.01.2016 MDR Die Hexen vom Hörselberg
Folge 18Im Thüringer Land, nicht fern von Eisenach, erhebt sich ein mystischer Höhenzug über die Landschaft, die Hörselberge. Von ihnen sollen ungeahnte Kräfte ausgehen. Viele Sagen und Legenden ranken sich um die besondere Felsengruppe mit ihren weit über Deutschland hinaus berühmt gewordenen Höhlen. Im Berginneren sollen sogar Teufel und Dämonen gehaust haben. Berüchtigte Hexen, heißt es, hätten sich am Berg versammelt und seien von hier zum Blocksberg geflogen. Und sogar Schreie armer Seelen der Hölle meinte man aus dem Berginnern zu hören.Die „Weiber der Ortschaften unter den Hörselbergen“ hingen Kränze aus Holunder oder Birke an die Häuser und Ställe, „um den Satan und die ihm ergebenen Hexen abzuwehren“, schrieb Johann Praetorius im 17. Jahrhundert. Auch von einer Teufelin Venus ist die Rede, die ehrbare christliche Ritter mit ihren Reizen verführte und sie somit in die tiefste Verdammnis stürzte. Selbst Richard Wagners Opernheld Tannhäuser verfiel der ungezügelten Sinnlichkeit in einer Höhle des Hörselbergs. Für den Sagendichter Ludwig Bechstein ist dieser Höhenzug „der hauptsächlichste Träger des Mythentums“ im Thüringer Land. Auch die Schriftstellerin Irmtraud Morgner ließ sich in ihrem Hexenroman „Amanda“ vom Mythos der Hörselberge inspirieren. Bis heute sind die Hörselberge mit einer Aura des Geheimnisvollen umgeben. Janine Strahl-Oesterreich besucht die legendenumwobene Anhöhe und will herausfinden, was ihren Zauber ausmacht. Sie fragt nach den Hexen, nach Frau Venus und Ritter Tannhäuser. Sie erfährt von dem alten Hexenkräuterwissen, das die weisen Frauen trotz drohender Todesstrafen über Generationen weitergegeben haben. Sie findet heraus, dass noch heute die Hörselberge eine botanische Schatztruhe, eine regelrechte Arzneiausgabestelle sind. Und eine moderne „Kräuterhexe“ gewährt ihr nicht nur einen Einblick in ihre wohlriechende geheimnisvolle Brauküche, sondern hält manchen Tipp zur Linderung von kleineren und größeren Wehwehchen bereit. Aber auch wahre Geschichten einer unrühmlichen Zeit findet man in den Thüringer Archiven. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert fanden mörderische Hexenjagden statt. Thüringen war eine der Hochburgen während der Hexenverfolgung. 800 Scheiterhaufen haben hier nachweislich gebrannt. Der Hexenwahn hat viele Spuren hinterlassen. Doch mit dem Wandel der Zeiten änderte sich auch das Bild der Hexe. Die Zeit der Hexenvertreibung ist lange vorbei. Wer heute am Hörselberg ums Feuer tanzt, feiert den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens. Das lodernde Feuer verheißt Licht und Wärme nach der kalten Jahreszeit. Spätestens dann versteht man den Zauber, der von diesem Berg ausgeht. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mo. 28.03.2016 MDR Wie der Teufel den Buchdruck erfand
Folge 19Wir schreiben das Jahr 1452. Mitten im lärmigen Markttreiben fällt ein Mönch auf. Voller Abscheu schleudert der Gottesmann eine teure Bibel in den Straßenstaub und streckt beschwörend sein Kruzifix dem Teufelswerk entgegen. Was war geschehen? Es war der weltweit erste Band der Bibel, der nicht von Klostermönchen mit der Hand geschrieben war, wie damals üblich, sondern auf einer handbetriebenen Maschine gedruckt wurde. Kurz darauf nehmen Gendarmen den Buchdrucker unter dem Verdacht der Hexerei fest. Denn jede seiner Bibeln glich aufs Haar der anderen – das konnte nur das Werk des Teufels sein. Um dem Feuertod zu entgehen, entdeckte der Buchdrucker seine Erfindung den Ratsherren der Stadt. Aber nicht Gutenberg war sein Name, sondern Johannes Faustus. Was hat der sagenumwobene Hexenmeister mit der Erfindung des Buchdrucks zu tun? Janine Strahl-Oesterreich geht in der Buchstadt Leipzig dieser alten Sage auf den Grund. (Text: mdr)Deutsche TV-Premiere Mo. 31.10.2016 MDR Schneeweißchen und der Bärenhäuter aus Thüringen
Folge 20Das Städtchen Eisenberg im Holzlandkreis in Thüringen pflegt bis heute einen mittelalterlichen Weihnachtsbrauch. Zur Adventszeit wandeln die Kinder, sobald es dunkelt, mit bunten, von Lichtstümpfchen erhellten Papierlaternen über den Markt. Der Brauch geht zurück auf eine alte Sage, die zu den geheimnisvollsten in ganz Thüringen zählt. Ein stadtbekannter Landstreicher mit dem Namen Bastian, der Bärenhäuter, habe vor vielen Generationen die ersten Laternchen gebastelt. Die Eisenberger erzählen sich bis heute Unheimliches über den Sonderling. Denn Bastian hauste nur mit einem Bärenfell bekleidet im Schweinestall eines armen Vetters und wusch sich nie, dabei besaß er viel Gold.Er habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, sich drei Jahre nicht zu kämmen und zu waschen, seine Kleider nicht zu wechseln, nie zu beten und nie die Kirche zu besuchen. Janine Strahl-Oesterreich nimmt die Zuschauer mit auf eine amüsante Zeitreise ins sagenhafte Thüringen des Mittelalters. Sie trifft eine Hökerin und taucht ins Alltagsleben der armen Wander-Händler ein. Wie war das damals mit der Körperhygiene? Galt es vielleicht als teuflisch, sich Jahre lang nicht zu waschen? (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere So. 01.01.2017 MDR Milo Barus – der Herkules aus Thüringen
Folge 21In der Gegend um Suhl erzählt man bis heute Legenden vom stärksten Mann der Welt – Milo Barus – ein Zirkusartist mit legendären Kräften und einem Leben wie eine Achterbahnfahrt. Er rang Stiere zu Boden, verbog Schienen, stemmte Elefanten oder Straßenbahnen. Er zog mit den Zähnen vollbesetzte Busse, jonglierte Zwei-Zentner-Torpedos oder hielt startende Armee-Flugzeuge fest. Dass die Flugzeuge dabei zu Bruch gingen, gehört allerdings, wie vieles, ins Reich der Legende. Dabei war Milo Barus kein eitler Kraftprotz, sondern ein bescheidener und liebenswerter Zeitgenosse, der sein Publikum gern zum Lachen und Staunen brachte und häufig mit der Obrigkeit aneckte, weil er sich nichts gefallen ließ.Mit seiner Frau Martha betrieb der Artist erst in Stadtroda und später in Weißenborn eine Gaststube, die „Meuschkensmühle“ und sorgte auch dort für Gesprächsstoff. Janine Strahl wandelt auf den Spuren des liebenswürdigen Herkules. Was fasziniert die Zuschauer bis heute an der Muskelkraft? Wie trainierte man vor hundert Jahren? Wie wurde der schmächtige kleine Emil eigentlich zum Muskelmann? Spielte die deftige böhmische Küche eine Rolle? Sie besucht Milos Haus und die jungen Ringer der Grundschule „Milo Barus“ Stadtroda. Janine stößt auch auf andere Zirkusattraktionen unserer Großeltern, wie die berühmte Löwen-Dompteuse Claire Heliot aus Leipzig. Und natürlich fehlen auch nicht Alfons Zitterbackes Rummel-Abenteuer und die Fernsehserie „Spuk unterm Riesenrad“. Was machte die Attraktion der legendären Zirkusnummern aus und wie überleben Zirkusartisten heute in den Zeiten von Internet und Fernsehen? (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Fr. 14.04.2017 MDR Wer war Krabat? – Mensch und Mythos
Folge 22Noch vor Hoyerswerda – in Schwarzkollm – soll sie gestanden haben: die schwarze Mühle, in der ein satanischer Müller-Meister mit seinem Zauberbuch hauste und arme Wanderburschen in seine Dienste nahm. Ein Todesurteil für die jungen Männer: Um nicht selbst vom Teufel geholt zu werden, opfert der schwarze Müller jedes Jahr einen der Müllergesellen. Der clevere Krabat heuert in der schwarzen Mühle an, lernt selber zaubern und besiegt schließlich den bösen Müller. Der faktisch belastbare Hintergrund aller Sagen und Legenden um Krabat ist die Tatsache, dass der Kurfürst bei seiner Rückkehr von einem Feldzug gegen die Türken im Jahr 1691 einen Reiterobristen namens Johannes Schadowitz in seinem Gefolge mitbrachte und diesem wegen seiner Verdienste – er soll den Kurfürsten vor der Gefangennahme durch die Türken bewahrt haben – das Gut Groß Särchen vor den Toren der Stadt Hoyerswerda schenkte.Der aus dem fernen Kroatien stammende Oberst, wurde, vermutlich wegen seiner fremden Herkunft, seines Aussehens und seiner Eigenarten als Zauberer gesehen und im Volksmund als „Krabat“ bezeichnet. Aber wie passt das zusammen mit der Krabat-Sage? „Rätsel, Mythen und Legenden“ gibt die Antwort. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mo. 01.01.2018 MDR Der Freischütz vom Thüringer Wald
Folge 23Die Oper „Der Freischütz“ sei die schönste und märchenhafteste aller Opern, jubelten die Kritiker, als Carl-Maria von Weber im Jahr 1841 sein Meisterstück in Weimar uraufführte. Neben der wunderbaren volksliedhaften Musik brillierte das Werk mit seiner gruseligen und packenden Geschichte, die tief im Böhmerwald spielte, in der Wolfsschlucht, wo der verzweifelte junge Jäger im Pakt mit dem Teufel die verruchten Freikugeln gießt, um nach dem gelungenen Probeschuss endlich die geliebte Förstertochter heiraten zu dürfen.Doch in Wirklichkeit lag die legendäre Wolfsschlucht in Thüringen, genauer gesagt im Hainichwald, wo die Sage vom Freischütz („Elbel“) schon seit dem Dreißigjährigen Krieg kursiert. Das will Janine Strahl-Oesterreich auf ihren Streifzügen durch Wälder und Flure, durch Rüstkammern und Archive in Mitteldeutschland beweisen. Am Ende ist klar: Nicht nur der Hainichwald stand für die „Freischütz“-Oper Pate, sondern auch die Jagdwaffen aus Suhl, die Dübener Heide in Sachsen und ein junger Leipziger Ratsherr, der heimlich Spukgeschichten schrieb. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mo. 02.04.2018 MDR Der edle Räuber Karasek
Folge 24In der Oberlausitz trieb Ende des 18. Jahrhunderts eine Bande unter Führung des legendären Räuberhauptmanns Karasek jahrelang ihr Unwesen. Romane und Theaterstücke gibt es von dem historisch interessanten Geschehen. Doch wer war eigentlich dieser Johannes Karasek? Belegt ist, dass er 1764 in Prag geboren wurde und den Beinamen „Prager Hansel“ trug. Nachdem der gelernte Tischler und Fleischer aus dem österreichischen Heer desertiert war, verschlug es ihn in die Oberlausitz nach Neuleutersdorf. Karasek schloss sich einer Räuberbande an und wurde bald zu deren Hauptmann. Gut betuchte Menschen, wie Mühlenbesitzer, Garnhändler oder Geldwechsler, schwebten von diesem Zeitpunkt an ständig in Gefahr, überfallen zu werden.Da Karasek auch so manchem armen Schlucker, oft Leineweber oder Häusler, hier und da einen Taler abgab, entwickelte sich daraus im Volk die Legende vom „edlen Räuber“, der den Reichen nahm und den Armen gab. Johannes Karasek war ein redegewandter und stets adrett gekleideter Mann, der vor allem auf Frauen mit seiner schmucken Jägertracht und seinem sicheren Auftreten einen besonderen Eindruck machte. Und doch wurde er schließlich enttarnt, verhaftet und eingesperrt. Der Räuberhauptmann starb 1809 in Dresden im Gefängnis. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mi. 31.10.2018 MDR Rübezahl – der Geist des Riesengebirges
Folge 25Im wilden Riesengebirge – so überliefern es die Sagen und Legenden der Region – lebt seit uralten Zeiten ein Berggeist. Er beschützt Höhlen und Felsen, Sümpfe, Wälder und Tiere. Er herrscht über Wind und Sturm. Manchen Menschen hilft er in der Not, anderen spielt er derbe Streiche. Darum galt und gilt auch heute noch die Warnung: Wanderer kommst Du in jene Berge, so denke daran, der Berggeist kann überall sein. Mündlich überlieferte Geschichten um Rübezahl gehören zur regionalen Folklore des Riesengebirges wie das Seeungeheuer Loch Ness zu Schottland. Der beeindruckende böhmisch-schlesische Gebirgszug hat naturgemäß die Fantasie seiner Bewohner angeregt.Daraus ist der launische Riese Rübezahl entsprungen. Aber wer oder was ist dieser sagenumwobene Rübezahl nun genau? Ein Riese, ein Bergbau- und Bergwerksgeist oder doch eher ein Berggnom, ein Homunkulus? War er ein Geächteter, ein Mönch, ein Schatzhüter, Herr des Wetters oder sogar ein Zauberer? Bis in die heutige Zeit scheint diese vielschichtige Gestalt die Menschen zu faszinieren. Dichter, Schriftsteller, Maler, Bildhauer, sogar Komponisten widmeten ihm Werke. Carl Maria von Weber, Friedrich von Flotow und Louis Spohr komponierten Rübezahl-Opern. Wolfgang Menzel verfasste das Drama „Rübezahl“, das 1829 in Stuttgart uraufgeführt wurde. Carl Hauptmanns Rübezahl-Buch von 1915 und nicht zuletzt Otfried Preußlers „Mein Rübezahl Buch“ zeigen, dass die Geschichten über den Geist aus dem Riesengebirge von Groß und Klein immer wieder gern gelesen werden. Und sogar Hitqualität weist der Berggeist auf: In der Hymne auf das Riesengebirge taucht er im Refrain als Behüter des Riesengebirges auf und die von Ralph Siegel produzierte deutsche Musikgruppe „Dschinghis Khan“ widmete ihm einen Song. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Di. 01.01.2019 MDR 1100 Jahre Deutschland? – Die Königssage vom Finkenherd
Folge 26In Quedlinburg zeigt man noch heute jene Stelle, wo 919 die ostfränkischen Großen dem überraschten Sachsenherzog Heinrich, als er am Vogelherd saß, die Königskrone gebracht haben sollen. Laut Sage ging Heinrich gerade seiner Lieblingsbeschäftigung nach: dem Singvogelfang. Postanschrift dieser historisch bedeutsamen Begebenheit heute: Finkenherd 1, Altstadt von Quedlinburg. Die Stadt im Norden des Harzes steht 1.100 Jahre später ganz im Bann von König Heinrich I. „Plötzlich König!“ heißt eine aufwendige Sonderausstellung auf dem Schlossberg, der auch den Dom mit der Grablege Heinrichs und seiner Frau Mathilde beherbergt.Das Multi-Media-Spektakel „Mensch, Heinrich!“ wird im Theater gezeigt, ein Heinrichslauf unter der Schirmherrschaft von Doppel-Marathon-Olympiasieger Waldemar Cierpinski abgehalten. Und auf der Straße, Am Finkenherd 1, stellen Bürger aller zwei Wochen die Kronen-Übergabe an ihren Stadtgründer Heinrich nach. Janine Strahl-Oesterreich nimmt die Sage und den historischen Heinrich genau unter die Lupe: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein schwertgewaltiger König, der Ungarnbezwinger und Burgenbauer Heinrich, Finken und Sperlingen mit Netzen nachstellte? Und warum hatten die Nazis, hatte ausgerechnet SS-Chef Heinrich Himmler einen Narren am ersten sächsisch-thüringischen König auf dem Thorn des ostfränkischen Reiches gefressen? Zudem streiten sich die Historiker seit 1.100 Jahren: Begann mit Heinrich I. das deutsche Reich und nicht erst unter seinem Sohn Otto, genannt der Große? Schrieb Heinrich der Vogler ostfränkische Geschichte fort oder begann mit ihm die deutsche Geschichte? Ein spannendes, märchenhaft schönes „Rätsel, Mythen und Legenden“ aus dem Fachwerk-Welterbe-Städtchen Quedlinburg. Janine Strahl-Oesterreich lockt mit Finkenschlag und Heinrichskamm und spürt dem höchst umstrittenen Rätsel nach dem Anfang von dem nach, was wir Deutschland nennen. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 30.05.2019 MDR Wie kam Kaiser Rotbart in den Berg? – Die Barbarossa-Sage vom Kyffhäuser
Folge 27Der Kyffhäuser – ein deutscher Zauberberg. Ein märchenhaftes Gebirge an der Nahtstelle zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt, gekrönt von einem monumentalen Kaiserdenkmal, das mit seinem Fundament in den Überresten einer einst gewaltigen Reichsburg ankert. Eine uralte Sage geht hier um, weht um den Bergfried, den die Leute seit jeher nur den Barbarossa-Turm nennen: Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, wäre auf einem Feldzug im Heiligen Land gar nicht gestorben. Kaiser Friedrich I. soll sich selbst in die Barbarossa-Höhle des Kyffhäuser-Gebirges verflucht haben – mitsamt einer Schar Getreuer, mit einer Tochter und Zwergen.Sein roter Bart sei durch den steinernen Tisch gewachsen und reiche schon zweimal um den Felsblock herum. Erst, wenn der Bart dreimal um den Tisch gewachsen ist und die Raben, die den Kyffhäuser umkreisen, tot vom Himmel fallen, erst dann würde der Kaiser erwachen und empor steigen, um sein Reich zu erneuern. Mit ihm käme eine Ära des Friedens, des Wohlstandes und der Gerechtigkeit, so die Prophezeiung. In einer neuen Folge unserer Reihe „Rätsel, Mythen und Legenden“ fragt Janine-Strahl Oesterreich: Wie kam Kaiser Rotbart in den Berg? Die Moderatorin steigt zum Barbarossa-Thron in die Barbarossa-Höhle zwischen Marienglas und Alabaster. Sie schmiedet persönlich in der nahen Königspfalz von Tilleda ein kostbares Zaumzeug aus Gold – die exakte Replik eines Stückes, das man Barbarossa zuordnen kann. Und sie taucht bei ihren Erkundungen tief in die Glaubens- und Gedankenwelt unserer Altvorderen. Denn in der Barbarossa-Sage mischen sich die Vorstellungen eines jungsteinzeitlichen Sonnengottes mit der germanischen Wettergöttin Frau Holle. Und nicht von ungefähr steht das Kyffhäuserdenkmal auf dem sogenannten Wotans-Berg. Selbstverständlich rekonstruiert der Film auch das spannende Leben von Friedrich I., der von 1155 bis zu seinem noch immer nicht vollständig geklärten Tod auf einem Kreuzzug 1190, der Kaiser des Heiligen römischen Reiches Deutscher Nation war – und somit der mächtigste Herrscher seiner Zeit in Europa. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Mi. 01.01.2020 MDR Till Eulenspiegel – Ein Narr und finsterer Straßenräuber?
Folge 28Schon ein halbes Jahrtausend lachen Kleine wie Große über die derben, despektierlichen Streiche des großen Volksnarren. Till Eulenspiegel teilt ordentlich aus – gegen Dumme, Reiche und Grausame. Der Schalk mit der Narrenkappe spukte auch rings um den Ostharz: In Halberstadt, Calbe, Quedlinburg, Sangerhausen, Bernburg und Eisleben spielen einige seiner schönsten Streiche – und das kommt nicht von ungefähr. Ein Historiker entdeckte Eulenspiegels wahre Herkunft. Die Wohnburg seiner Familie lag versteckt in einem Sumpfgebiet nahe Halberstadt.Es ist die 1.000 Jahre alte Westerburg bei Dedeleben am Forst von Huy nahe der früheren innerdeutschen Grenze. War dort Eulenspiegels Heimat, obgleich sich Mölln in Schleswig-Holstein dieses Titels rühmt? Geschichtsforscher Prof. Bernd Ulrich fand in alten Gerichtsakten überraschende Hinweise. War der beliebte Schalk in Wahrheit ein Straßenräuber im Gefolge der Raubgrafen von Regenstein? „Rätsel Mythen und Legenden“ folgt den Spuren Till Eulenspiegels in Mitteldeutschland. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Fr. 10.04.2020 MDR
zurück
Erhalte Neuigkeiten zu Rätsel, Mythen und Legenden direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Rätsel, Mythen und Legenden und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.