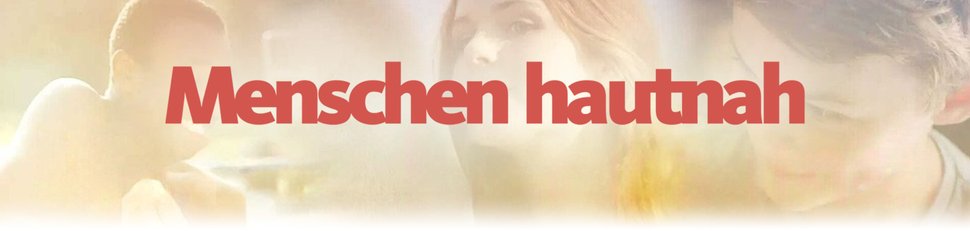1994-2014 (unvollständig), Seite 3
Nagendes Glück: Herr Schnecke, der Kaninchenzüchter
45 Min.Bernd Schnecke ist Kaninchenzüchter und lebt in Knetterheide bei Bad Salzuflen. Das Züchten von „deutschen Kleinwiddern grau“ ist sein Hobby und ein Leben ohne dieses kann und will Bernd Schnecke sich nicht vorstellen: „Das ist die Liebe zur Natur, und da geh’ ich voll drin auf“. Er liebt das Fell der Kaninchen und „wenn sie schön rund sind hinten und an den Seiten kastig“. Es ist daher nur natürlich, dass Bernd Schnecke mit einer Kaninchenzüchterin verheiratet ist: Ursula Schnecke züchtet Zwergwidder, „blaue“ und „thüringerfarben“.Und eine sehr wichtige Frage in der Ehe der Schneckes lautet: Wer von den beiden hat die schönsten Kaninchen? Was bei Kaninchen schön ist und was nicht, das ist in zahlreichen Zuchtverordnungen genau festgelegt. Herr Schnecke liegt im ehelichen Wettbewerb meistens vorn, weil er, seit er arbeitslos ist, viel Zeit im Stall verbringt, während seine Frau oft erst abends aus dem Büro nach Hause kommt. Sie hat außerdem noch Verpflichtungen als Kreisvorsitzende des Kaninchenzuchtvereins. In seinem Beruf als Altenpfleger hat Herr Schnecke nicht viel Glück gehabt. Überhaupt musste er sich immer besonders anstrengen, und jetzt steckt er eben seinen ganzen Ehrgeiz ins Hobby. In dieser Saison aber, muss Herr Schnecke zugeben, liegt seine Frau vorne. Na schön, er gönnt es ihr. Er hat schon so ziemlich alles an Kaninchenzüchter-Titeln geholt, was es so gibt: Er war mehrmaliger Vereinsmeister, Kreismeister, Bundessieger und ist noch amtierender Europameister. „Man muss sich mit den Tieren beschäftigen“, sagt er, „das ist das A und O, wenn man an der Spitze mitmischen will“. Es wird viel gestreichelt bei den Schneckes. Und die Kaninchen bekommen nur vom Feinsten. Im Sommer baut Herr Schnecke auf einem extra dafür gepachteten Feld Klee für seine Muckel an, im Winter gibt es selbstgezogenen Kohl als Beilage zu Körnern und Biomöhren. Muckel heißen die Kaninchen von Bernd Schnecke alle, da macht er keine Unterschiede. Nur wenn sie besonders schön sind, dann sind es „Granaten“. Aber wenn etwa die Ohren kürzer sind als die Preisrichter es festgelegt haben, dann hat es sich schnell ausgemuckelt für das Kaninchen. Da redet Herr Schnecke nicht so gern drüber, über das Schlachten, aber ach, er kann doch nicht alle behalten. Fast ein Jahr lang ist Autorin Annette Zinkant mit einem Kamerateam auf den Spuren Schneckes im Kaninchenzüchtermilieu geblieben. Sie war viel im Stall, im Klee, auf den wichtigsten Schauen, hat den Wettbewerb um den „Rammler 2003“ beobachtet, Züchterfreunde kennen gelernt und beim Training für den Kaninchenhindernislauf zugesehen.“ (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 31.03.2004 WDR Null Bock gibt’s nicht – Schule für junge Flüchtlinge
Sie waren Kindersoldaten, wurden zur Prostitution gezwungen oder gefoltert. Wenn sie Glück hatten, konnten sie fliehen. Jetzt sitzen die jugendlichen Migranten in Lagern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland und hoffen auf eine Zukunft. Was tun mit den 16–18-Jährigen? Wie behandelt man Menschen, die eigentlich noch schulpflichtig sind, die aber jahrelang nicht wissen, ob sie bleiben dürfen? In der „Schlau Schule“ in München wird versucht, aus Asylanten Schüler und aus Schülern Mitbürger zu machen, ihnen eine Zukunft zu geben. Doch ganz so einfach ist es nicht.Nicht für die Schüler, die sich mit der deutschen Mentalität und Sprache rumplagen, aber hoch motiviert sind. Und auch nicht für die Sozialarbeiter und Lehrer, die wenig Geld, aber viel Idealismus haben. Alle wissen: Früher oder später wird der „biografische Rucksack“, den die Jugendlichen tragen, spürbar. Eine Herausforderung für den Schulleiter. Michael Stenger muss Verständnis zeigen, aber auch streng sein können und Humor haben. „Menschen hautnah“ hat drei seiner Schüler bis zur Prüfung für den „Hauptschulabschluss“ begleitet. Wer es schafft, der startet in ein neues Leben in Deutschland. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 29.11.2012 WDR Schwarzes Glück – Gothics sind anders
„Wie sehen die denn aus?“ So reagieren viele auf die dunklen Gestalten – irritiert und befremdet. Die „Schwarzen“ haben ein denkbar schlechtes Image. Manche Menschen glauben deshalb, dass die Gothics satanistische Neigungen haben, nachts Friedhöfe schänden oder depressiv sind. (Text: WDR)Deutsche TV-Premiere Mi. 17.09.2008 WDR Sektenkinder – Zum Dienen geboren
Bei der neuen Gruppe der „Weltdiener“ herrscht die Ansicht, Kinder seien „erwachsene Seelen“ in Kinderkörpern und bräuchten keine besondere Rücksicht. Deshalb ist es für die Sekte selbstverständlich, dass Kinder auf Spiel, Spaß und Süßigkeiten verzichten müssen, um ihre „Seele voranzubringen.“ Die Kinder haben keine Krankenversicherung, Arztbesuche sind tabu. Denn zum einen vertritt der Guru die These, Ärzte könnten die jahrelange Seelenarbeit zunichte machen. Zum anderen glauben er und seine Jünger, Krankheiten seien lediglich eine Form der „Reinigung“. Eine Großmutter streitet vor Gericht gegen ihren Sohn und die Schwiegertochter, weil sie Angst vor den Folgen der „göttlichen Erziehung“ in der Gruppe hat.Bisher konnte sie kaum etwas für ihre Enkelkinder erreichen und wirft den Behörden Untätigkeit vor. Für diese aber steht offenbar der Elternwille im Vordergrund. Dabei hat es auch schon lebensgefährliche Situationen für Kinder gegeben, die früher bei den „Weltdienern“ leben mussten. Kilian war 12 Jahre, als er mit seinen Geschwistern in die Gruppe gebracht wurde. Er leidet an einer chronischen Krankheit und bekam, gemäß den Thesen des Gurus, keine Medikamente. Die Folge: Seine Lunge blähte sich auf, er magerte stark ab, war bei seiner Flucht aus der Sekte dem Hungertod nahe. Sein ehemaliger Lehrer macht sich jetzt Vorwürfe, nicht entschiedener protestiert zu haben. Ganz anders äußert sich das zuständige Jugendamt. Zu keinem Zeitpunkt habe es eine „Rechtfertigung für eingreifende Maßnahmen … gegeben.“ „Menschen hautnah“-Autorin Beate Greindl hat beeindruckende Szenen aus dem Leben der Sekte eingefangen. Es ist ihr gelungen, dem Guru und den überzeugten Eltern Aussagen über bisher wohl gehütete Ansichten zu entlocken. Nach Schätzungen gibt es in Deutschland etwa 200.000 Sektenkinder. Jugendämter tun sich schwer bei der Abwägung: Wann muss der Staat einschreiten, weil das Kindeswohl gefährdet ist? (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.10.2012 WDR Sieben Stunden Todesangst – Das Überleben der Susanne Preusker
45 Min.Am 7. April 2009 ist Susanne Preusker glücklich: In 10 Tagen wird sie heiraten, so viele Dinge sind noch zu tun. Heute will sie ihren Arbeitstag früher beenden. Sie ist Leiterin der Sozialpsychiatrischen Abteilung der JVA Straubing und arbeitet dort therapeutisch mit Schwerverbrechern, Mördern und Vergewaltigern. Als der Gefangene K. in der Tür steht und sie um ein Gespräch bittet, verweist sie ihn deshalb auf den nächsten Tag. Doch den wird es für sie so nicht mehr geben. „Mein altes Leben bis zum April 2009? Ich will nicht behaupten, dass es perfekt war.Welches Leben ist schon perfekt? Aber ich habe es gern gelebt, ich hatte einen Arbeitsplatz, den ich klasse fand, ich hatte ein spannendes Leben, es war meins, ich hatte es mir aufgebaut. Und dann passierte das, und dann gab es einfach diese Frau nicht mehr.“ Sieben Stunden lang hält der Gefangene K. sie in ihrem Büro gefangen. Er verbarrikadiert den Raum. Und droht ihr mit dem Tod. Er hat ein Messer. Er knebelt Susanne Preusker. Und die weiß, dass sein letztes Opfer an einer solchen Knebelung erstickt ist. Susanne Preusker kennt diesen Mann sehr gut, sie hat ihn vier Jahre lang therapiert. Der Mann vergewaltigt sie viele Male. Spezialeinheiten der Polizei haben das Hochsicherheitsgefängnis längst umstellt. Trotzdem dauert es sieben Stunden, bis sie freikommt. Susanne Preusker hat überlebt, doch ihr Leben ist seitdem ein anderes. Sie kannte den Täter gut, hatte ihn mehrfach begutachtet, war überzeugt, dass sie mit ihm therapeutisch auf dem richtigen Weg war. „Ich hatte mich bei diesem Menschen geirrt und ganz offensichtlich etwas übersehen. Das quält mich beinah mehr als die Tat selbst. Es hat mein ganzes Vertrauen in mich, meine Wahrnehmung, meine Fähigkeiten und Sicherheiten dieser Welt erschüttert.“ Wie kann man weiterleben nach einer solchen Erschütterung? Nicht nur Susanne Preuskers Leben ist angegriffen worden, sondern auch das ihrer Familie. „Der Täter hat mir wahnsinnig viel genommen. Meine berufliche Integrität, dieses Leben, was ich gerne hatte, er hat meinem Sohn die taffe, gut organisierte, lustige Mama genommen. Mein Sohn war siebzehn, als das passierte, und er hat mich gesehen in einem Zustand, wie ich es keinem Siebzehnjährigen wünsche. Niemand sollte seine Mutter so sehen müssen.“ In intensiven Dialogen, an Orten der Erinnerung, der Angst, aber auch der Stärke zeigt „Menschen hautnah“-Autorin Karin Jurschick eine Frau, die zusammen mit ihrer Familie immer noch jeden Tag um ein neues Leben kämpft und die dabei den Mut hat, über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Ich möchte nicht gesenkten Hauptes durch mein eigenes Leben gehen müssen, schämen soll sich der Täter. Ich muss mich nicht schämen, ich habe nichts verkehrt gemacht.“ Der Vergewaltiger von Susanne Preusker wird zu einer Haftstrafe von 13 Jahren und neun Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Gerichtssaal schaut Susanne Preusker ihrem Peiniger so lange ins Gesicht, bis der Mann die Augen senkt. „In dem Moment waren die Machtverhältnisse wiederhergestellt“, sagt sie. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 20.09.2012 WDR Susanne Preusker hat sich am 13. Februar 2018 entschieden, aus dem Leben zu gehen. (Die Dokumentation wurde um diese Texteinblendung erweitert.)Spuren der Macht – Die Verwandlung des Menschen durch das Amt: Heide Simonis
45 Min.Deutsche TV-Premiere Mo. 07.02.2000 WDR Stadtteilmütter – Unterwegs im Problemviertel
Stadtteilmütter sollen Zugang finden zu Frauen, die wie im Ghetto leben, weil sie kein Deutsch sprechen. Sie helfen in Erziehungs- und Gesundheitsfragen und erklären die deutsche Bürokratie. Sie machen isolierten Frauen Mut, den Schritt nach draußen zu wagen, sich aktiv in die Gesellschaft zu integrieren. Bei ihren Hausbesuchen werben sie um Teilnahme an Deutschkursen – vor allem mit Blick auf die Zukunft der Kinder. Ihre Klientinnen leben meist hinter verschlossenen Türen, fallen wenig auf. Die sogenannten Heiratsmigrantinnen tun sich meist schwer mit dem Leben in Deutschland.Von der Welt außerhalb der eigenen vier Wände wissen sie wenig, ihre Kinder ziehen sie wie früher in der Heimat auf. Sie haben sich eingerichtet in ihrer Parallelwelt. Einige von ihnen zeigen eine ausgeprägte Anspruchshaltung, wenn es um Hilfen des Staates geht. Sie haben wenig Eigeninitiative. Auch Ismet und Yasemin, die Stadtteilmütter, haben jahrelang sehr zurückgezogen gelebt, sie haben darunter gelitten und ihre Situation verändert. Sie sind deshalb besonders geeignet, anderen Frauen aus der Isolation heraus zu helfen. Ihre Arbeit beginnt dort, wo Eltern die Sprache des Gastlandes nicht lernen und ihre Kinder nicht in deutsche Kindergärten schicken. Bei Gewalt in der Familie vermitteln sie Hilfe. Ismet und Yasemin sind Beispiele dafür, dass Entwicklung und Veränderung des eigenen Lebens möglich sind. Sie sind stolz auf ihre Ausbildung, ihren Job und das eigene Geld. Menschen hautnah Autorin Claudia Dejá geht mit ihnen in die oft noch verschlossene Gesellschaft der Migranten und porträtiert zwei engagierte ‚Stadtteilmütter‘, die Brücken bauen zwischen zwei Parallel-Welten. (Text: Tagesschau24) Deutsche TV-Premiere Do. 26.09.2013 WDR Stiefmütter
Sie wollen dem Mann eine wunderbare Partnerin sein und seinen Kindern eine liebevolle neue Mutter. Trotzdem ist das Image der „Stiefmütter“ alles andere als gut. Das fängt bereits in Märchen an – aber wie sieht es in der Realität aus? Eigentlich können sie nur alles falsch machen und scheitern. Wenn die Kinder den Verlust der leiblichen Mutter nicht verwinden können, wenn der Ehemann der alten Beziehung nachhängt oder die Schwiegereltern die Neue und die Alte ständig vergleichen.Nicole zum Beispiel ist seit gut zwei Jahren Stiefmutter. Sie lebt in dem Haus, das ihr Mann Kai mit seiner verstorbenen ersten Frau gebaut hat. Ein Neuanfang, ganz woanders, wäre ihr zwar lieber gewesen, aber Kai und seine Tochter hängen an ihrem Zuhause, dafür hat Nicole Verständnis. Inzwischen gibt es einen gemeinsamen Sohn, und Nicole will nun beiden Kindern gerecht werden. Sie achtet darauf, dass Helen sich nicht als Stiefkind fühlt. „Helen ist ein ganz liebes Kind, da habe ich Glück gehabt, es gibt ja auch ganz furchtbare Stiefkinder, aber trotzdem …“. Steht der eigene Sohn ihr nicht doch näher? Ein innerer Konflikt, der sie täglich beschäftigt. Andrea, selbst Mutter eines Sohns, mag das Wort Stiefmutter nicht. Sie will eine ganz normale Mama sein und ihren Stiefkindern Yasmin und Tim viel Geborgenheit geben, denn die Kinder haben ihre leibliche Mutter auf sehr tragische Weise verloren. Die neue Rolle als Stiefmutter hat sie ganz selbstverständlich übernommen, denn sie selbst ist auch ein „angenommenes“ Kind, das bei Adoptiveltern aufgewachsen ist. Andrea – da ist sie sich mit ihrem Mann einig – will alle drei Kinder gleich behandeln und gleich liebhaben. Silke ist schon seit zwölf Jahren Stiefmutter. Diese Zeit hat viel Kraft gekostet. Den beiden Jungs ihres Mannes wollte sie Geborgenheit geben, ein schönes Zuhause, Mutterliebe. Da ihr Mann beruflich viel unterwegs war, kümmerte sie sich vor allem um die Erziehung. Doch besonders der ältere der beiden Brüder hat ihr das Leben schwer gemacht. Von Anfang an hat er sich wenig von ihr sagen lassen, mit der Pubertät wurde er vollends unberechenbar. Erst sein Auszug hat wieder Ruhe in die Familie gebracht. Was bleibt ist das bittere Gefühl, dass sie als Stiefmutter viel gegeben und wenig zurück bekommen hat. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Do. 20.10.2011 WDR Stiefväter
Ganz so schlecht wie die „Stiefmütter“ sind die „Stiefväter“ nicht angesehen. Aber auch sie haben es schwer, zumindest bei ihren Stiefkindern. Die wollen meistens lieber mit der Mutter alleine bleiben und sich vom „fremden Mann“ nichts sagen lassen. Hinzu kommen häufig unterschiedliche Auffassungen über die Erziehung des Nachwuchses. Ganz schwer wird es, wenn zu den Stiefkindern noch gemeinsame Kinder kommen. Wer hält zu wem – die Fronten gehen nicht selten quer durch die Familie. Roland ist mit vielen guten Vorsätzen mit Andrea zusammengezogen, die drei Mädchen mitgebracht hat.Die Ehe läuft gut, aber die Mädchen waren Regeln in ihrer alten Familie eher weniger gewohnt. Da kam Roland mit seinen klaren Vorstellungen über Erziehung gerade recht. Spätestens seit der Pubertät der Kinder gibt es richtig Krach. Mathias hat seit seiner Scheidung ein schlechtes Gewissen gegenüber seinem leiblichen Sohn und erfüllt ihm deshalb gern mal einen Wunsch. Nicklas, der Sohn seiner zweiten Frau, fühlt sich dann zurückgesetzt und zu wenig beachtet vom Stiefvater. Langsam nähern sich die beiden aber an. Frank und Agnes haben zusammen sechs Kinder. Jeweils zwei aus erster Ehe und zwei gemeinsame – alle wollen unter einen Hut gebracht werden. Mit der Stieftochter, die acht Jahre alt ist, versteht sich Frank gleich. Aber der kleinere Stiefsohn kommt noch nicht so gut mit Franks deutlichen Ge- und Verboten zurecht. Doch die müssen sein in einer Familie, davon ist Frank überzeugt. Ein Film über Kinder, Mütter und Stiefväter, die wahrscheinlich das Beste wollen, aber manchmal auch an ihre Grenzen kommen, weil die Verhältnisse ganz schön kompliziert sind. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Do. 27.09.2012 WDR Tsunami – Überlebt, aber nicht überwunden
45 Min.Eigentlich sollte es ein Liebesurlaub werden im Dezember 2004 in Thailand, im Tauchparadies Ko Phi Phi. Doch die Ferien entwickeln sich für Karin Migdalek und Thomas Dechert zum Albtraum. Die beiden, gerade auf einem Tauchausflug vor der Küste, entkommen nur knapp dem Tod. Karin Migdalek wird bewusstlos am Strand gefunden, Thomas Dechert rettet sich völlig entkräftet ans Ufer. Sie haben überlebt. Doch es gibt keine Zeit, die Bilder einzuordnen, zu verstehen, was passiert ist. Was folgt, ist „die Konfrontation mit dem Unmöglichen“, wie Thomas Dechert es ausdrückt. Sie sehen die Schwerverletzen auf dem Strand liegen und packen an. Aus Holzlatten und Wellblech baut Thomas Dechert mit anderen Überlebenden eine Trage, um die Menschen zu retten.Doch auf der Insel Ko Phi Phi gibt es kein Krankenhaus, keine Ärzte. 3 Tage leben sie in einem Zustand, dem sie selber kaum folgen können. Ihr Körper funktioniert, doch ihre Seele kommt schon lange nicht mehr hinterher. Auch nicht bei ihrer Heimkehr nach Deutschland. Hier, wieder in Sicherheit, soll der Alltag weitergehen. Doch nichts ist mehr, wie es war. Die traumatischen Erlebnisse lassen sie nicht los. Beide sind längst nicht mehr so belastbar wie früher, Thomas Dechert verliert sogar seine Arbeit. Die erste Zeit in Deutschland nennen sie heute ihren zweiten Tsunami. Sie fühlen sich unverstanden und hilflos. Bei beiden sind bis heute die Erinnerungen im Kopf eingebrannt. Bilder von Toten und Verletzten rufen immer wieder Ängste und Trauer hervor. Das Gefühl, es ist noch nicht überstanden, begleitet sie. 10 Jahre nach dem Tsunami beschließen Karin Migdalek und Thomas Dechert, dass sie der Insel noch einmal begegnen wollen. Das Paar möchte – fernab der großen Tsunami-Gedenkfeiern – in Ruhe seine Erlebnisse vor Ort verarbeiten. Im Herbst 2014 reisen sie nach Thailand, in der Hoffnung, dass die alten Bilder neuen weichen können. „Menschen hautnah“ begleitet sie auf dieser Reise. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 06.11.2014 WDR Unschuldig in Haft – Wenn der Staat zum Täter wird
Horst Arnold ist tot. Mit 53 Jahren hat sein Herz einfach aufgehört zu schlagen. Vielleicht hat es den Kampf nicht mehr ausgehalten gegen das Unrecht, das ihm widerfahren ist. Denn die letzten zehn Jahre waren für ihn, so sagte er, „die Hölle“. An einem Wochentag im August 2001 wird der Lehrer vom Fleck weg verhaftet. Ab jetzt ist er nicht mehr unbescholtener Bürger, sondern Verbrecher. Seine neue Welt: Das Gefängnis. „Die Hölle“ beginnt. Horst Arnold ist kein Einzelfall: Nach Schätzungen, die auf Entschädigungszahlungen der Bundesländer beruhen, sitzen jeden Tag hunderte Menschen unschuldig in deutschen Gefängnissen.Das System sieht nicht vor, dass die Justiz sich irrt. Wer es trotz hoher Hürden schließlich doch schafft, seine Unschuld zu beweisen, den lässt der Staat im Stich. Und: Es kann jeden treffen. Die Dokumentation bietet einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen zweier spektakulärer Fälle: Sie zeigt, wie es zu solchen Fehlurteilen kommen kann und wie zweifelhaft der deutsche Rechtsstaat mit seinen Justizopfern umgeht. Horst Arnold soll eine Lehrerkollegin vergewaltigt haben. Das Gericht entscheidet: Fünf Jahre Haft. „Ich wurde von Mithäftlingen schikaniert und angegriffen“, immer wieder spielt Arnold mit dem Gedanken an Selbstmord. Weil er die Tat nicht gestehen will, gibt es keine Hafterleichterung, keine frühzeitige Entlassung wegen guter Führung. Allein sieben Psychologen befassen sich mit dem vermeintlichen Täter und bescheinigen ihm schließlich „schwere seelische Abartigkeit“. Denn Arnold beteuert immer wieder seine Unschuld. Horst Arnold ist unschuldig. Das beweist ein Wiederaufnahmeverfahren zweifelsfrei, zehn Jahre, nachdem er verhaftet worden war und nachdem er die gesamte Haftstrafe abgesessen hatte. Nur durch einen Zufall kommt dieses Verfahren zustande und wieder hat es Jahre gedauert, bis der entlastende Richterspruch schließlich fällt. Ähnlich ergeht es Monika de Montgazon. Ihr Leben wird durch fehlerhafte Ermittlungen zerstört. Die ehemalige Arzthelferin soll ihren Vater getötet haben. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Do. 02.05.2013 WDR lief zuvor bereits außerhalb der ReiheVeränderungen – oder die Kunst, es anders zu machen
Zwischen 40 und 50 geraten Männer wie Frauen oft in eine Lebenskrise. Sie erstarren in ihrer Routine, sind erschöpft und unzufrieden. Erst wenn der Leidensdruck hoch ist, kommt die Erkenntnis: „Ich muss was verändern in meinem Leben“ oder „Ich will mich verändern“. Aber wie geht das eigentlich? Anuschka, 40, fühlt sich wie im Hamsterrad: Sie versucht, es allen recht machen, und funktioniert nur noch. Druck und Stress führen nicht nur zu Unzufriedenheit, sondern auch zu einer Nesselsucht. Nach einem Seminar zum Thema „Selbstheilung“ stellt die berufstätige Mutter alles auf den Prüfstand: ihre Ehe, ihre Lebensführung, ihre Zukunftswünsche.Das hat Konsequenzen für die ganze Familie: Sie verlässt ihren Mann, beginnt Geige zu spielen und spürt nie gefühlte Zufriedenheit und Glück. Die Sonderpädagogin Ute, 47, steckt schon lange in der Krise. Erschöpfung und verlorene Lebensfreude belasten sie am meisten. Doch Ute hat eine Idee, wie sie wieder Spaß am Leben gewinnen kann: Die Lehrerin möchte einen Bauernhof und Esel kaufen, um auch dort mit ihren Schülern zu arbeiten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Tim, Ende 30, erlebt einen Burnout und kann seinen Beruf bei einer IT-Firma nicht weiter ausüben. Er ist gezwungen, sein Leben zu verändern. Nach einem Klinikaufenthalt trifft er eine folgenreiche Entscheidung und meldet sich zu einer Schreinerlehre an. Peter, 51, produziert Spielfilme fürs Fernsehen und jettet für seinen Job rund um die Welt. Zeit für die Familie hat er kaum. Als ihm klar wird, dass er das Aufwachsen seiner beiden Söhne bisher „erfolgreich verpasst“ hat, beschließt er sein Leben zu ändern: Er startet am Wohnort der Familie ein eigenes Business mit Entschlackungskuren. „Menschen hautnah“ hat Anuschka und die Anderen anderthalb Jahre lang auf ihrem Weg zum „anders“ begleitet. Die Dokumentation zeigt, wie schwer es fällt, alte Muster los zu werden, und wie beflügelnd es sein kann, wenn das „anders“ gelingt! (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Do. 12.09.2013 WDR Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker
40 Min.„Das Leben ist eine riesige Torte und ich wollte mehr als nur einen Krümel vom Kuchen abhaben.“ Mit 25 hat Mehmet E. Göker mit dem Vertrieb privater Krankenversicherungen am Telefon seine erste Million verdient. Seine Firma, die MEG, wächst, der Umsatz steigt, neue Mitarbeiter werden angeworben, großzügige Provisionen in Aussicht gestellt und gezahlt, verschwenderische Incentive-Reisen und Ferraris gehören zu den kleinen Annehmlichkeiten der ranghöheren Mitarbeiter. Die Jubel-Veranstaltungen der Firma lassen an Pomp und grotesken Ritualen nichts zu wünschen übrig. (Text: WDR)Deutsche TV-Premiere Do. 11.10.2012 WDR lief bereits am 04.06.2012 außerhalb der ReiheVoll im Leben – Drei um die 80
Langzeitbeobachtung dreier sozial engagierter 80-jähriger: Ruth Machalet auf ihrem Schutzhof „Pferde vor dem Schlachter“ im Kölner Norden; Heinz Czech, leidenschaftlicher Boxtrainer, der mit schwierigen Jugendlichen beim Boxverein ABC in Brühl arbeitet; Elisabeth Karst, die Tanztreffen und Nachbarschaftshilfe organisiert mit dem Verein „Wir sind nicht allein“. „Zuschlagen ist sekundär. Bei mir lernen die Leute Ausweichen“, sagt Heinz Czech, Boxtrainer mit erfolgreicher Vergangenheit im Ring. In 148 Kämpfen kein einziges k.o. Das soll ihm erst mal einer nachmachen.Und: Heinz Czech ist 79 Jahre alt. Mit Energie und Geduld bereitet er Jugendliche auf ihre ersten Kämpfe vor. Fast jeden Abend verbringt er mit seinen Schützlingen in einer Brühler Turnhalle. Weil ihn das jung hält, sagt er. Auch Ruth Machalet wird bald 80. Sie leitet seit 20 Jahren einen Pferdeschutzhof im Kölner Norden, rettet Pferde vor dem Schlachter und pflegt sie. „Respekt vor Mensch und Tier sollte die normalste Sache der Welt sein“, sagt sie wütend, wenn ihr Tierschutzprojekt mal wieder in Gefahr ist. Elisabeth Karst genießt ihr Leben beim Tanzen. Sie leitet den Seniorenverein „Wir sind nicht mehr allein e.V.“ und lädt jede Woche zum Tanztee mit Livemusik in eine Schulaula ein. „Tanzen ist Freude. Tanzen ist Leben“, sagt die 80-Jährige. Jürgen Kura hat die drei ein halbes Jahr lang begleitet. Seine Frage: Woher nehmen sie Kraft und Zuversicht für ihren rastlosen Alltag? Die Antwort, die er findet, klingt einfach: Die drei leben Ihr Leben so, als wäre es tatsächlich ihr einziges. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Mi. 18.01.2017 ARD-alpha Wenn Kinder sterben – Weiterleben mit der Trauer – Weiterleben mit der Trauer
5 von 1000 Kindern sterben jedes Jahr, bevor sie 18 sind. „Es raubt einem die Zukunft“, sagt Andrea aus Oberhausen, deren Tochter Alena vor drei Jahren an Krebs gestorben ist. „Nichts wird jemals wieder so, wie es war“, meint auch Petra aus Hamburg, deren 14-jähriger Sohn Jan einen plötzlichen Unfalltod erlitt. Das Umfeld hat oft große Probleme mit der tiefen und vielleicht sogar ewig anhaltenden Trauer der Eltern. Freunde und Verwandte fragen sich, wie man den Trauernden begegnet? Das Gespräch suchen? Praktische Hilfestellung leisten? So tun, als wäre alles normal? Kaum jemand hat eine Antwort, wenn es darum geht, verwaisten Eltern zu helfen.Und doch erwarten viele, dass sie nach einer bestimmten Zeit wieder zurückfinden in ihr Leben vor dem Tod des Kindes. Für die Eltern aber ist das nicht möglich. Auch nicht für Andreas – Alenas Vater. Ihm fällt es schwer, die Stille auszuhalten. Als eine Art Eigentherapie hat er eine Homepage als Gedenkseite für Alena eingerichtet und leitet inzwischen die Facebook-Gruppe für verwaiste Eltern. Manchmal treffen sich diese Eltern auch persönlich und geben sich Schutz und Trost. Es entstehen Ersatzfreundschaften und -familien, weil die ehemaligen Freunde und auch viele Verwandte mit der andauernden Trauer der Eltern nicht umgehen können und sich allmählich zurückziehen. Deshalb fühlen sich verwaiste Eltern oft doppelt bestraft. Es macht sie traurig, wenn niemand mehr mit ihnen den Kindergeburtstag feiern oder sie am Todestag begleiten will. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Fr. 28.04.2017 ARD-alpha Wie viel Mutter braucht das Kind?
Vollzeitmutter, Teilzeitmutter, Karrieremutter – welches Modell ist das Beste? Darüber streiten sich vor allem Mütter. Nichts wird auf Spielplätzen und Mütter-Abenden so heiß diskutiert, wie die Frage, wie viel Mutter ein Kind braucht. Reicht Quality-Time am Abend? Machen so genannte Helikopter-Mütter, die ständig um ihr Kind kreisen, ihre Kinder unselbstständig? Werden Teilzeitmütter keinem gerecht – weder sich, dem Arbeitgeber noch dem Kind? Und was sagen eigentlich Kinder und Väter? Helikoptermutter Conny P. hat fünf Kinder und ist rund um die Uhr für sie da.Den Job als Groß- und Einzelhandelskauffrau hat sie sofort nach der Geburt des ersten Kindes aufgegeben. Ihr Leben dreht sich um die Kinder: „Ich stecke überall zurück,“ sagt die 48-Jährige. Connys Eifer geht so weit, dass sie an der Volkshochschule Sprachen lernt, um ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen zu können. Als ihr Ehemann ihr eine Wochenendreise geschenkt hat, ist sie nicht gefahren, weil sie die Kinder nicht allein lassen wollte. Den Ehekrach nahm sie in Kauf. Die zweitälteste Tochter sagt: „Mama erdrückt uns durch ihre permanente Anwesenheit und Überwachung.“ Auf der anderen Seite finden die Kinder es aber auch sehr schön, „betütelt“ zu werden. Karrieremutter Ganz anders als Conny lebt Vanessa C. ihr Muttersein. Sie ist Ärztin, leitet ein Pharmaunternehmen, hat eine neunjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn. Zu ihrem Vollzeitjob ist sie auch noch Vorstandsvorsitzende im Verein „Frauen und Karriere“. Vanessa ist viel unterwegs, oft im Ausland. Ihre Kinder werden häufig vom Vater oder von den Großeltern betreut. Den ersten Brei, den ersten Zahn, die ersten Schritte hat Vanessa nie hautnah miterlebt, aber es fehlt ihr auch nicht, sagt sie. Sie sei rundum glücklich mit ihrem Leben. Ihre Kinder Carlotta und Maxim machen einen aufgeschlossenen, selbstbewussten Eindruck. Alles nur Schein? Können Vater, Großeltern, Lehrer, die Mutter ersetzen, oder fehlt den Kindern doch etwas Entscheidendes? Teilzeitmutter Zeit für den Beruf, Zeit für die Kinder – diesen Spagat versucht Julia K. zu leben. Acht Jahre lang war sie Vollzeitmutter, aber nun möchte sie wieder Teilzeit arbeiten. Das ist nicht so einfach. Die ehemalige Projektmanagerin findet in Teilzeit nur Jobs, für die sie überqualifiziert ist. Nach einigen Monaten nimmt sie eine Stelle als Telefonistin an. Die beiden Kinder sind erstmal nicht begeistert. Sie wollen ihre Mutter ganz für sich. Doch Julia will die Herausforderung annehmen. Wird sie es schaffen, und wie werden die Kinder damit klar kommen? Drei Mütter, drei Modelle: Wie viel Mutter braucht das Kind? Menschen hautnah macht sich auf die Suche nach Antworten und begleitet die Mütter und ihre Familien ein halbes Jahr lang auf ihrem Lebensweg. (Text: ARD-alpha) Deutsche TV-Premiere Do. 04.09.2014 WDR Wir Kriegskinder – Wie die Angst in uns weiterlebt
40 Min.‚Ich finde meine Mutter. Sie blutet am Kopf und das Blut läuft an ihr runter und sie liegt da. Die Tür geht auf und die Russen kommen schon wieder rein. Ich muss meine Mutter schnell retten.“ Urplötzlich, von einem Tag auf den anderen, bricht der Kriegsschrecken erneut mit aller Macht über Elfriede herein. Die 80-Jährige war noch ein Kind im Zweiten Weltkrieg. Ihre traumatischen Erfahrungen verdrängte sie Jahrzehnte lang, denn sie musste funktionieren als Mutter und Ehefrau. Da war kein Platz für Vergangenheitsbewältigung.Elfriede ist eines von vielen Kriegskindern, bei denen das alte Trauma im hohen Alter wieder aufbricht. Man nennt sie Trigger – Alltagserfahrungen, die die schrecklichen Bilder und beängstigenden Gefühle auslösen: Gerüche, Töne, Berührungen oder auch verunsichernde Lebensveränderungen machen den Weg frei für das verdrängte Leid. Angehörige und Pfleger in Seniorenheimen stehen diesen Retraumatisierungen oft hilflos gegenüber. „Wir hatten mal eine Bewohnerin, die hat bei der Intimpflege immer ‚Nicht schon wieder! Nicht schon wieder!‘ geschrien. Ich denke, die ist im Krieg vergewaltigt worden.“, erzählt eine Altenpflegerin. Ein Drittel der deutschen Rentner wurde im Krieg schwer traumatisiert. Viele von ihnen sind den im Alter wieder auftauchenden Bildern und Kriegserinnerungen hilflos ausgeliefert. Aber nicht nur die Kriegskinder haben mit den Erlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Auch deren Kinder, die so genannten Kriegsenkel, bleiben nicht verschont. „Ich glaube, dass mein Vater das, was er als Kind erleiden musste, unbewusst an mich weitergetragen hat.“ Frank und seine Schwestern sind sich sicher, dass das Kriegstrauma des Vaters die Familie geprägt und über Jahrzehnte unbemerkt schweren Schaden angerichtet hat. Der Vater wie auch die Kinder leiden unter Angststörungen und Depressionen. Wissenschaftliche Studien belegen die Hypothese der Geschwister: Die Ursache für psychische Erkrankungen bei Kindern können die Kriegserlebnisse ihrer Eltern sein. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 16.05.2013 WDR Wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld – Das Leben als Hartz-IV-Kind
Ein ganz normaler Dienstag. Mariam, 14 Jahre, ist auf dem Weg in die Schule. Sie hat Unterricht bis nachmittags, trifft dann ihren Vater an der Bushaltestelle. Er bringt ihr ein wenig warmes Essen vorbei, denn Mariam hat keine Zeit: Nach der Schule geht sie zum Ballett, anschließend zum Schulchor bis abends um halb zehn. Sie fährt nach Hause, isst ein wenig, macht Hausaufgaben und fällt dann todmüde ins Bett. Mariam ist ein Hartz IV-Kind. Der 12-Jährige Fabian hat drei Brüder. Seine Mutter ist alleinerziehend und auch diese Familie lebt von Hartz IV. Fabian will unbedingt den Realschulabschluss machen.„Ich wünsche mir eine bessere Zukunft „, sagt er. Und deswegen ist er fleißig in der Schule, nutzt das Betreuungs- und Weiterbildungsangebot des Kinderwerks Arche, denn eines ist ihm klar: Ohne einen guten Schulabschluss geht nichts vorwärts. Er will einmal Busfahrer werden. Beide Kinder haben den Willen, sich für eine bessere Zukunft anzustrengen, aber wie leicht ist es, sich eine gute Bildung anzueignen? Reichen kostenfreie Schulen und Bildungsgutscheine in unserem Land, in dem über zweieinhalb Millionen Kinder an der Armutsgrenze leben? Dieser Film zeigt: Bildungsnahe Familien haben es einfacher als bildungsferne. Mariams Eltern haben beide in im ihrem Heimatland Georgien studiert und wissen alle Fördermöglichkeiten für ihre Tochter zu organisieren. Fabians Mutter hingegen kommt aus einer bildungsfernen Familie. Sie will ihren vier Jungen Werte wie Verantwortung, Zusammengehörigkeit und gutes Benehmen beibringen. Ein halbes Jahr hat die Filmemacherin Renate Günther-Greene Mariam und Fabian durch ihren Alltag begleitet. Die beiden Kinder kämpfen auf ihre Weise für ein besseres Leben. Ob es gelingt, hängt auch davon ab, wie viel Unterstützung sie dabei bekommen – zu Hause, in der Schule und vom Staat. (Text: WDR) Deutsche TV-Premiere Do. 15.11.2012 WDR Wolfgang Clement – Ein tatenlustiger und humorvoller Politiker
Dieses Portrait von Wolfgang Clement entstand in einer Umbruchphase, kurz bevor er Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und lange bevor er zum Superminister in der Regierung von Gerhard Schröder wurde. Der Filmemacher Georg Stefan Troller begleitete den fünffachen Familienvater über Wochen hinweg bei seinen öffentlichen und privaten Aktivitäten. Er galt als Technokrat, als Medienspezialist, als radikaler Erneuerer der Wirtschaft, als ein Macher, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das bevölkerungsreichste aller deutschen Länder auf das kommende Europa, auf die Globalisierung, auf den unvermeidlichen weltweiten Wettbewerb einzustimmen. Georg Stefan Troller gewann das Bild eines junggebliebenen, humorvollen und doch kompromißlosen und von seinen Überzeugungen fast messianisch durchdrungenen Politikers. (Text: ARD-alpha)Zuhause in der Kälte: Wenn Frauen frieren müssen
Deutsche TV-Premiere Do. 09.02.2012 WDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Menschen hautnah direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Menschen hautnah und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.