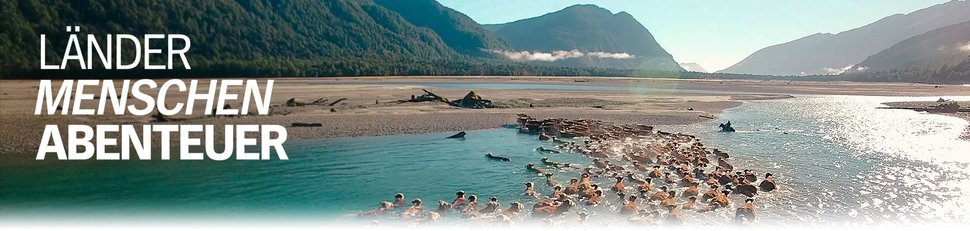1784 Folgen erfasst, Seite 34
Königliche Gärten: Hampton Court
Unter William III. und Königin Mary erblühte Hampton Court zu einem der schönsten Barockgärten Englands. Über die Jahrhunderte verfiel der Garten, bis er in den 1990er-Jahren prachtvoll restauriert wurde. Heinrich VIII. war der erste König, der im Hampton Court Palace residierte. Der Park des Palastes sollte ein Stück vom Paradies auf Erden sein und die Allmacht seines Besitzers zeigen. Unter William III. und Königin Mary erblühte der Garten zu einem der schönsten Barockgärten Englands. Meistergärtner Henry Wise schuf eine raffinierte Terrassenanlage, und der französische Kunstschmied Jean Tijou gestaltete berückende Tore zur Themse hin.Künstliche Kanäle durchzogen den Park, ein ausgeklügeltes Pumpwerk sorgte für grandiose Fontänen zwischen exakt gestutzten Eiben. Über die Jahrhunderte verfiel der Garten, bis er in den 1990er-Jahren restauriert wurde. Jetzt kümmert sich Terry Gough um das Prachtstück. Seine Gärtner sind so verbunden mit dem Park, dass sie sich auch im Rentenalter nicht von der floralen Wunderwelt verabschieden wollen. Ähnlich geht es den Volunteers wie Melanie Peterson, die zeitlebens mit dem Park verbunden war. Der Rosengarten hat es ihr besonders angetan, obwohl er erst 100 Jahre alt ist. Jedes Jahr im Juli ruft die berühmte Hampton Court Flower Show für eine Woche zu floralem Taumel auf. Die Royal Horticultural Society veranstaltet die Show für alle Gartenfreunde, um zu zeigen, wie die Gartenkunst das Leben und die Welt ein wenig besser machen könnte; und zwar auf ganz natürliche Weise wie Society-Mitglied James Alexander-Sinclair sagt: „Die Franzosen haben ihr Essen, ihren Wein, wir Briten haben Gärten – so ist es nun einmal …“ (Text: BR Fernsehen) Königliche Gärten – Hampton Court – Von Geistern und Rosen
Heinrich VIII. war der erste König, der im Hampton Court Palace residierte. Der Park des Palastes sollte ein Stück vom Paradies auf Erden sein und die Allmacht seines Besitzers zeigen. Unter William III. und Königin Mary erblühte der Garten zu einem der schönsten Barockgärten Englands. Meistergärtner Henry Wise schuf eine raffinierte Terrassenanlage, und der französische Kunstschmied Jean Tijou gestaltete berückende Tore zur Themse hin. Künstliche Kanäle durchzogen den Park, ein ausgeklügeltes Pumpwerk sorgte für grandiose Fontänen zwischen exakt gestutzten Eiben.Über die Jahrhunderte verfiel der Garten, bis er in den 1990er Jahren restauriert wurde. Terry Gough leitet nun das Prachtstück. Seine Gärtner sind so verbunden mit dem Park, dass sie sich auch im Rentenalter nicht von der floralen Wunderwelt verabschieden wollen. Ähnlich geht es den Volunteers wie Melanie Peterson, die zeitlebens mit dem Park verbunden war. Der Rosengarten hat es ihr besonders angetan, obwohl er erst hundert Jahre alt ist. Der Duft berauscht jeden Besucher, von denen manch einer verfügt, man solle seine Asche nach dem Ableben bitte hier ausstreuen. Jedes Jahr im Juli ruft die berühmte Hampton Court Flower Show für eine Woche zu floralem Taumel auf. Die Royal Horticultural Society veranstaltet die Show für alle Gartenfreunde, um zu zeigen, wie die Gartenkunst das Leben und die Welt ein wenig besser machen könnte; und zwar auf ganz natürliche Weise, wie Society-Mitglied James Alexander-Sinclair sagt: „Die Franzosen haben ihr Essen, ihren Wein, wir Briten haben Gärten – so ist es nun einmal …“ (Text: ARD-alpha) Königliche Gärten: Het Loo – Das Versailles Hollands
Der barocke Park von Schloss Het Loo in Apeldoorn besticht durch Blütenpracht und Farbenrausch. Wasserspiele, Kaskaden, Fontänen, exotische Orangenbäume und rare Pflanzen spiegeln das goldene Zeitalter Wilhelms von Oranien wieder. Seit 1980 wird der berühmte Garten restauriert, eine Aufgabe, in der Chefgärtner Willem Zeeleman vollkommen aufgeht: „Het Loo ist ja kein einfacher Garten, es muss immer alles perfekt sein.“ In seinem Team arbeiten 16 Gärtner, allesamt Fachleute, um die Anlage in barocker Perfektion erstrahlen zu lassen. Gert Jonkers kümmert sich um die genaue Ausrichtung der wasserspeienden Tritonen und Schwäne in den Brunnen.Bewegliche Kopien der schweren bleiernen Originale erleichtern ihm die Arbeit erheblich. Hightech hilft, die Fontänen zu korrigieren. Het Loo war zur Bauzeit berühmt für die damals höchste künstliche Wassersäule Europas. Täglich eine halbe Stunde lang konnte die Fontäne prächtig sprudeln, dann war der Zauber vorbei, aber Wilhelm von Oranien hatte bewiesen, dass er die Elemente beherrschte. Het Loo, das Schloss und der Garten galten seinerzeit als das Schaustück überhaupt für die niederländische Monarchie, erzählt Konservator Paul Rem. Er arbeitet hier, seitdem das Schloss vom Staat als Museum übernommen wurde und kennt neben der Geschichte jeden Winkel, jedes Kunstwerk. Ein Leben ohne Het Loo kann er sich nicht so recht vorstellen. Ebenso wenig die freiwilligen Helfer und Helferinnen, die die Gärtner bei ihrem Tun unterstützen, Unkraut zupfen, jäten und die Kieswege harken. „Einige von uns wohnen gleich hier um die Ecke, aber es gibt auch Leute, die von weit her kommen, um sich dem Garten hier zu widmen, einfach weil er so schön ist“, sagt Rentnerin Dichnah Senten, die seit Jahren jede Woche Unkrautzupfdienst macht. Als Prinzessin Margriet Het Loo noch bewohnte, war der Barockgarten verdeckt von einer englischen Parkanlage. Mit Freuden sieht sie daher die Restaurierung. Sie selbst habe einmal mit ihrem Mann ein wenig aus Spaß gegraben und dabei Teile der alten barocken Anlagen entdeckt. Damals war es zu teuer, professionell weiterzumachen, jetzt aber sei die Anlage perfekt wiederhergestellt. Ein Abbild des Paradieses sollte der Garten sein, den Wilhelm von Oranien vor über 400 Jahren angelegt hat. Für seine Besucher aus aller Welt ist er heute ein tatsächlicher Garten Eden. (Text: NDR) Das Königreich Jordanien – Zwischen Jordan und dem Toten Meer
45 Min.Der Norden von Jordanien besticht mit seiner mediterranen Landschaft. Überall finden sich Zeugnisse vergangener Epochen. Die Ruinenstadt Gerasa stammt aus der Zeit der Römer. Nicht weit entfernt: Amman, die Hauptstadt des Königreichs. Seit ein paar Jahren brechen bunte Malereien, die sich oft über ganze Häuserfassaden ziehen, das Stadtbild auf. Und immer mehr junge Frauen drängen in diese Szene. Die Street-Art-Künstlerin Dalal Mitwali ist eine von ihnen. Nach einer internationalen Ausbildung und Erfahrungen in der Fashion-Industrie von Florenz und New York kehrt Tania Haddad nach Amman zurück, um ihr eigenes Label zu gründen.Die Marke ist eine Hommage an Jordanien und das Erbe des Landes: in den Geschichten, die sie mit ihrer Mode erzählt. In den „Royal Hills“ lebt eine besondere Spezie: Araberpferde. Sie gehören zu den ältesten Pferderassen der Welt. Hier kümmern sich Experten aus aller Welt um den Fortbestand der edlen Tiere. Der Brite Mark Gamlin arbeitet seit 10 Jahren als Pferdetrainer auf dem Gestüt ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin Alia Bint Al Hussein. Der Fastenmonat Ramadan ist fast vorbei. Letzte Vorbereitungen im Haus der Familie Bani Hani. Yasmine und ihre Mutter stecken mitten in den Vorbereitungen für das Essen zum Fastenbrechen. Hoffentlich wird alles pünktlich zum Sonnenuntergang fertig. Das Tote Meer: Wer an seinem Ufer steht, befindet sich rund 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Wegen des hohen Salzgehalts ist es unmöglich, hier unterzugehen. Trotzdem braucht es Rettungsschwimmer wie Mohammed Al Amazing. Oft hat er mehr zu tun als erwartet. (Text: NDR) Das Königreich Jordanien – Zwischen Wüste, Wadi und Weltwunder
45 Min.Der Süden Jordaniens steckt voller Wunder: zwischen dem Toten Meer und dem Roten Meer liegt die Felsenstadt Petra. Mit ihren steinernen Grabkammern ist sie eines der „sieben neuen Weltwunder“. Die einzigartige Sandwüste Wadi Rum ist Drehort zahlreicher Sciene-Fiction-Filme. In Akaba, der einzigen größeren Stadt im Süden des Landes, hat Jordanien einen wichtigen Zugang zum Roten Meer. Jährlich kommen rund eine Million Besucherinnen und Besucher in die Stadt Petra. Viele von ihnen nutzen für die Erkundung des Areals Esel, Pferde oder Kamele.Vor einigen Jahren schlugen Tierschützer Alarm, viele der Tiere waren in schlechtem Zustand. Deshalb wurde die PETA Veterinary Clinic gegründet, Dr. Mini Aravind und ihr Tierarztteam ist seitdem jeden Tag in Petra unterwegs. In Wadi Rum leben noch heute Beduinen, die Nomadenvölker Arabiens. Faisal Al Zaraydeh pflegt hier eine alte Tradition: Sandtherapie. Der Wüstensand gilt als mineralienreich. Faisal behandelt mit ihm Gelenk- oder Rückenbeschwerden, aber auch Erkältungen und Magenprobleme. Mehrmals pro Jahr treten in Wadi Rum die schnellsten Kamele zum Rennen gegeneinander an. Entscheidend ist die perfekte Einstellung des Jockey-Roboters. Mit ihm wird das Kamel sozusagen ferngesteuert. Mutlaq Bani Abieh hat mit seinem Rennkamel nun das erste große Rennen. Jordanien ist eines der trockensten Länder der Erde. Wie sich unter solchen Bedingungen nachhaltig Landwirtschaft betreiben lässt, erforschen Wissenschaftler in sogenannten Greenhouses. In der Anlage verdunstet Meerwasser. So kühlt die Luft ab und die Luftfeuchtigkeit steigt. Die Pflanzen benötigen nur wenig frisches Wasser. (Text: NDR) Das Königreich Lo – Reise durch ein unbekanntes Land (1): Von Jomsom nach Lo-Mantang
Deutsche TV-Premiere Mi. 13.04.1994 S3 von Bodo Knifka und Man Mohan BhattraiDas Königreich Lo – Reise durch ein unbekanntes Land (2): Lo-Mantang
Deutsche TV-Premiere Mi. 20.04.1994 S3 von Bodo Knifka und Man Mohan BhattraiKönigreich Tonga – Auf deutschen Spuren in der Südsee
„Der König von Tonga kommt aus Buxtehude“, so heißt es. Glaubt man Gerüchten und Überlieferungen, dann hat das Oberhaupt der Südseeinsel seine familiären Wurzeln in Niedersachsen und stammt von einem Seemann ab, der sich im 19. Jahrhundert in Polynesien niederließ. Bewiesen ist das jedoch nicht. Tatsache ist allerdings, dass im Laufe der Jahrhunderte eine Reihe von Deutschen in die Südsee kamen. Sie gründeten auf Tonga Handelsposten, Geschäfte und Familien. Spuren davon sind noch heute dort zu finden. Da sind zum Beispiel die Blumenfelds. Deren Urahn kam im 19. Jahrhundert aus Hamburg auf die abgelegene Insel.Der Hanseat hatte einen Sinn für das Geldverdienen, brachte seinen Familienmitgliedern das ordentliche Münzenzählen und das Bügeln von Geldscheinen bei und galt als strenger Patriarch. Seine Nachkommen sind sich bis heute sicher, dass sie nur durch die harte deutsche Erziehung alle gute Geschäftsleute geworden sind. So ähnlich sieht das auch Finnau Walter. Er schaut alles andere als „typisch deutsch“ aus und spricht kein Wort Deutsch. Trotzdem ist er stolz darauf, dass seine Vorfahren aus Europa kommen. Walter ist eine Art Hafenmeister, Flugplatzchef, Hotelier und Bäcker in einer Person – auf einem winzigen Außenposten des Tongaarchipels. Tonga ist eines der schönsten, unbekanntesten und ungewöhnlichsten Königreiche der Welt. Der idyllische Archipel, östlich von Neuseeland, wird von rund 100.000 Insulanern bewohnt. Sie sind vor allem eines: entspannt. Die Tonganer preisen ihren „Tongan Lifestyle“ als äußerst „relaxed“, was sich nicht immer mit den „deutschen Tugenden“ vereinbaren lässt. Zurzeit wächst Unmut im Königreich: Manche machen den autoritären Führungsstil des Königs und seine angebliche Vetternwirtschaft für die Armut auf der Insel verantwortlich. (Text: BR Fernsehen) Königssöhne und Wüstenvölker
Radjasthan ist Indiens farbigster Bundesstaat, Herzland der Rajputen, der stolzen „Königssöhne“. Ihre Maharadjas regierten mehr als 1.000 Jahre lang. Ihre Geschichte, ihre Macht, ihr Reichtum faszinieren bis heute. Die mächtigen Burgen und prächtigen Herrensitze der Rajputenkönige und -fürsten sind Attraktionen des internationalen Tourismus. Doch Radjasthan ist nicht nur das Land der Radjas und Maharadjas. Eine für den Europäer kaum zu überblickende Zahl von Völkern und Kasten bevölkert die Wüstenregionen im Norden des Staates. Ihre bunten Saris, ihre Feste, ihre Lieder und Geschichten, ihr immer noch fast mittelalterlicher Lebensstil – auch in Indien ist Vergleichbares kaum zu finden. Eine Rajputen-Hochzeit auf Burg Mandawa steht im Mittelpunkt des Dokumentarfilms, doch er zeigt mehr: das Volk der Raijka etwa – Kamelhirten seit Jahrhunderten oder das der Bhopa-Bänkelsänger, die die Heldengeschichten der kriegerischen Maharadjas seit Jahrhunderten auf Jahrmärkten erzählen. (Text: SWR)Deutsche TV-Premiere Mi. 10.04.2002 Südwest Fernsehen von Horst CramerKoffein statt Heroin – Kampf dem Schlafmohn in Thailands Bergen
Deutsche TV-Premiere Mo. 02.04.1990 S3 von Edy Klein und Karl SchüttlerKolumbien – Ein Riesenrad auf Reisen
Lautes Kinderlachen hallt von jedem Platz, auf dem César Romoleroux mit seiner Kirmes Station macht. Zu seinem fahrbaren Vergnügungspark gehören unter anderem ein Riesenrad, ein Autoscooter und mehrere Kinderkarussells. Seit zehn Jahren reist er mit seinen Fahrgeschäften quer durch die kolumbianischen Anden, eine Gegend, die bis vor kurzem noch Bürgerkriegsgebiet war. (Text: WDR)Kolumbien – Eldorado am Pazifik
Bombi Cordoba, ein 17-jähriger Junge aus den Slums von Medellín, unternimmt eine Traumreise in die weitgehend unbekannte Urwald-Region Kolumbiens, den Chocó. Bombis Vorfahren sind Sklaven, die vor etwa 500 Jahren dorthin gebracht wurden. Als Sklaven, die für Spanien nach Gold suchen sollten. Bombi ist Musiker und sucht in Chocó nach seinen Wurzeln und denen seiner Musik – mit dem naiven Blick eines jungen Erwachsenen, der das erste Mal den Ozean, den Urwald und die Traditionen seines Volkes entdeckt. Seine Gastgeberin und Führerin durch diese Gegend ist Josefina Klinger, eine Tourismusmanagerin. Hier gibt es viel unberührte Natur und Traumstrände, aber auch die Drogenmafia.Die Region leidet unter Vertreibung und Landflucht. Josefina will mit dem Tourismus den Chocó aus den Fängen der Mafia befreien. Bombi hat dafür einen anderen Weg: die Musik. Auch in den Slums von Medellín tobt der Mafiakrieg und die Musik ist das Wunder, das Jugendliche wie Bombi von der Gewalt befreit. Die Geschichte von Bombi und Josefina erzählt von Sklaven, Gold und Drogen. Eine Geschichte, für die Europäer den Nährboden geschaffen haben. Es ist eine imposante Landschaft, wo der Urwald bis zum Ozean reicht und die Kieselsteine, die der Pazifik an die schwarzen Strände spült, tausend Farben haben. (Text: ARD-alpha) Kopfjäger auf Neuguinea – Die Asmat
Koran, Kanal und Kooperative – Neues und Altes in einem türkischen Dorf
Deutsche TV-Premiere Sa. 04.02.1984 S3 von Anna SoehringKorsika – Die ungebändigte
Was ist „korsisch“? Dieser Frage geht der Filmemacher Sven Rechnach und trifft auf eine alte, aber höchst lebendige Kultur – und auf Menschen, die stolz für diese Kultur eintreten und um ihre Anerkennung ringen. Entstanden ist ein Film über die ungebändigte Schönheit einer Insel im Mittelmeer. Kalliste, die „Schönste“, haben einst griechische Seefahrer Korsika genannt. Napoleon beteuerte, seine Heimat allein am Duft zu erkennen. Und jedes Jahr schwören drei Millionen Touristen, im nächsten Jahr wiederzukommen. Aber was, wenn man die Insel nicht mehr verlassen darf? Für Patrizia Gattaceca, Sängerin, Korsin von Geburt und aus Überzeugung, ist sie zum Gefängnis geworden.Weil sie einen gesuchten Mordverdächtigen bei sich versteckt hatte, darf sie Korsika nicht verlassen, bevor das Gerichtsverfahren gegen sie beendet ist. Fast immer in ihrer 6.000 Jahre langen Besiedlungsgeschichte wurde Korsika von außen, von fremden Mächten beherrscht. Und schon immer gab es Widerstand dagegen – bis heute. Die Menschen treten stolz für diese Kultur ein und ringen um ihre Anerkennung – oder leben sie einfach, ob sie nun bis tief in die Nacht den traditionellen Hirtengesang, die Paghjella, praktizieren Wildschweine jagen, Bier aus Kastanien brauen oder einem Weltkonzern wie Coca Cola ein Schnippchen schlagen. „Wir fühlen uns zuerst und vor allem als Korsen,“ sagt Patrizia Gattaceca. (Text: BR Fernsehen) Die Krabbenfischer von Feuerland
Carlos Barría ist Kapitän und Eigner eines kleinen Fischerbootes, mit dem er jedes Jahr mitten im antarktischen Winter den schützenden Hafen verlässt und wochenlang auf Krabbenfang geht. Es ist Centolla-Saison. Die großen Königskrabben sind die Haupteinnahmequelle der Fischer von Feuerland. Die Tiere können bis zu acht Kilogramm schwer werden und einen Durchmesser von mehr als einem Meter erreichen. Die Besatzung des kleinen Bootes hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schneestürme und hohe Wellen machen den Fang oft unmöglich. Nicht selten finden die Männer zudem leere Krabbenfallen vor.Denn die Großen Seespinnen werden immer seltener. „360° Geo Reportage“ begleitet die chilenischen Fischer bei der Centolla-Jagd und taucht dabei in die faszinierende Unterwasserwelt von Kap Hoorn ein. Das Kamerateam erhält Einblick in das geheime Reich der Krustentiere am nächtlichen Meeresboden. Riesige Kelpwälder bieten den Tieren dort unten Schutz und Nahrung. Doch so reich das Unterwasserleben an der Südspitze Südamerikas auch ist, an Land herrschen lebensfeindliche Bedingungen. Trotz der heftigen Stürme und der Eiseskälte besiedelte der Volksstamm der Yagan als Seenomaden über 9.000 Jahre lang diese raue Inselwelt. Ihre Kultur gilt heute als fast ausgelöscht. Die letzten Nachfahren wohnen in Ukika, dem Heimatdorf des Fischers Carlos Barría, auf der zu Chile gehörenden Insel Navarino am Beagle-Kanal. Carlos’ fast 80-jährige Nachbarin Cristina Calderón gilt als die letzte lebende Yagan, die noch die Ursprache ihres Volkes beherrscht. Ihrer kleinen Enkelin erzählt sie die alten Legenden und lehrt sie so ganz nebenbei die Yagan-Wörter und Begriffe. (Text: arte) Die Krabbenflut
Die Roten Landkrabben sind ausgesprochen friedlich und eine Rarität. Sie sind nur auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean zu Hause, dort allerdings in Massen. Sechs von ihnen versucht der britische Forscher Steve Morris einen Monat lang im Auge zu behalten, indem er ihnen Sender auf den Panzer montiert. Er will untersuchen, wie die Krabben ihren Weg vom Regenwald an die Küste finden, wo sie sich alljährlich zur Paarung treffen. Auf ihrem Weg über steile Klippen, Straßen und Gärten riskieren sie immer wieder ihr Leben. Obwohl Ranger des Nationalparks Straßensperren und kilometerlange Zäune errichten, um die kleinen Wanderer vor Autos zu schützen, kommen zahlreiche Tiere unter die Räder.Auch entwaldete Flächen und mangelnde Feuchtigkeit sind lebensbedrohlich. Noch gefährlicher sind jedoch Begegnungen mit Yellow Crazy Ants, eingeschleppten Ameisen, die in den vergangenen Jahren riesige Kolonien gebildet und bereits 35 Millionen Krabben getötet haben. Bis zu acht Kilometer weit ist der Weg der Krabben an die Küste, wo die Männchen Paarungshöhlen bauen. Zwölf Tage nach der Befruchtung laichen die Weibchen im Meer. Gelingt es den gepanzerten Gärtnern des Waldes nicht, sich fortzupflanzen, verändert sich langfristig das gesamte Ökosystem – mit unabsehbaren Folgen für die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt der Weihnachtsinsel. (Text: hr-fernsehen) Kräuter der Welt: Kräuterwelten Indiens
Ein Filmteam zeigt die Welt der Kräuter im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne und stellt die Menschen vor, die mit und von Kräutern leben. Sie stehen im sich schnell wandelnden Indien vor der Herausforderung, dass die Nachfrage an Kräutern zunehmend das Angebot übersteigt. Heiler und Händler, Patienten und Ärzte sind darauf angewiesen, dass es Indien gelingt, seine Vielfalt an Kräutern zu bewahren. 6.000 Pflanzenarten werden in Indien genutzt. Auf dem Subkontinent mit seinen 1,3 Milliarden Bewohnern steigt der Bedarf an Pflanzenmedizin stetig und die wachsende Mittelschicht verlangt zudem nach Kosmetika auf Kräuterbasis.Als Folge sind manche Kräuter bereits selten, einige bereits ganz verschwunden. Die meisten der Kräuter Indiens werden wild gesammelt. Erst langsam beginnt man mit dem Anbau. Vor allem die ländliche Bevölkerung Indiens braucht günstige, verträgliche Arznei, Arznei auf Kräuterbasis. In Kerala zeigt das Filmteam einen Familienbetrieb, der Pflanzenheilmittel in Handarbeit für den lokalen Markt herstellt, und hoch oben im Himalaya beobachtet es einen Dorfheiler bei der Arbeit. 5.000 Jahre alt ist die Wissenschaft der ayurvedischen Medizin. Heute erfährt die alte Heilkunst einen Boom, nicht nur in Indien. In der Altstadt Delhis besucht das Filmteam einen Großhändler, der den weltweit rasant wachsenden Kräutermarkt bedient und Labore des weltweit größten Herstellers ayurvedischer Medikamente. In Kerala trifft es eine Ärztin einer kleinen Ayurvedaklinik und in Nordindien steigt es mit einer Studentin der tibetischen Medizin in die Berge. (Text: BR Fernsehen) Kräuterwelten auf dem Balkan
Im Südosten Europas wächst in unberührter Natur und mildem Klima eine einzigartige Vielfalt von Wildpflanzen. Fernab von Großindustrie und verschmutzten Böden haben sich die Länder des Balkans zum größten Kräuterexporteur Europas entwickelt. Allein in Bulgarien arbeiten mehr als 300.000 Menschen mit heimischen Pflanzen. Auf der kroatischen Adria-Insel Cres lebt der Bienenzüchter Mladen Dragoslavic. Wenn im Mai der Salbei zu blühen beginnt, hat er einen Monat Zeit, um sein Einkommen für das gesamte Jahr zu erarbeiten – mit dem Ziel, den besten Salbeihonig des Balkans zu erzeugen.Freiwillig würden sich die Bienen den Salbei nicht aussuchen, denn sie gelangen nur schwer in die Blüte hinein und wieder heraus. Spätestens nach drei Wochen muss Mladen sie von der Insel bringen. Sonst würden sie an Erschöpfung sterben. In Skopje, der Hauptstadt von Mazedonien, lebt Iva Josifova. Für sie ist die Stockmalve der Rohstoff für ihre Kunstobjekte. Das Kraut besitzt Schleimstoffe, die vielen Hustentee-Mischungen beigefügt sind. Iva dagegen stellt aus der Stockmalve Papier her. Dank der langen Fasern des Krauts lässt sich das Papier auf Objekte legen und modellieren. So entstehen filigrane Skulpturen, so zerbrechlich wie die Natur. In Trigrad, einem kleinen Dorf in den bulgarischen Rhodopen, gilt der wilde Bergtee bei den Einheimischen als Wundermittel, das potenzfördernd wirkt und ein langes Leben garantiert. Die hohe Nachfrage führte beinahe zur Ausrottung des Krauts. Filmautor Sebastian Lindemann besucht Michaela Yordanowa, die in ihrem Gartenlabor den wilden Bergtee kreuzt, bis die Pflanzen so widerstandsfähig sind, dass sie vermehrt werden können. Die neue Zucht soll den Bewohnern ermöglichen, das wertvolle Kraut auch im heimischen Garten oder auf dem Feld anzubauen. Im bulgarischen Balkangebirge trifft der Filmemacher auf Nikola Nikolow. Der Lehrer aus dem Dorf Chiprovzi hat mit seinen Schülern einen Garten für den Färberkrapp angelegt. Die Pflanze starb in Chiprovzi aus, obwohl ihre Wurzel jahrhundertelang zur Färbung von Wolle genutzt worden war. Die Bewohner des Ortes produzierten vor allem Teppiche, deren Kräuterfarben aus jedem Stück ein Unikat machten. Den Färberkrapp will Nikola wieder in Erinnerung rufen. Seine Arbeit mit den Schülern bringt neuen Schwung ins Dorf. Die Farben lassen das alte Weberhandwerk neu aufleben. (Text: BR Fernsehen) Kräuterwelten der Provence
Heimische Duftblüten und Würzkräuter machen die Provence weltweit zur Marke. Das heilsame Duftöl des Lavendels nutzte die Klostermedizin bereits im Mittelalter. Heute gründet sich eine ganze Industrie auf dem Geschäft mit der aromatischen Blüte. Doch die Existenz der provenzalischen Lavendelbauern ist bedroht. Im größten Lavendelanbaugebiet Frankreichs, dem Plateau de Valensole, hat es Gérard Blanc besonders hart getroffen. Der Lavendelbauer verlor 60 Prozent seiner Ernte an ein winziges Insekt: die Glasflügelzikade. Bereits die Hälfte der Anbaufläche hat die Zikade zerstört und Frankreich von Platz eins der Weltmarktproduktion für Lavendelöl gefegt.Auch die Parfümindustrie verdankt ihren Erfolg dem Klima, die duftenden Rohstoffe wachsen direkt vor der Haustür. Parfümeurin Delphine Thierry entführt in die würzig riechenden Hügel um Nizza. Das Filmteam durfte sie beobachten bei der Kreation eines exquisiten Parfüms, das das Aroma der Côte d’Azur in sich trägt. Catherine Pisani macht ihre Sammelleidenschaft zum Geschäftsmodell, sie züchtet 60 Sorten Basilikum. Exotisch wird es auch in einer Restaurantküche in Aix-en-Provence. Der Molekularkoch Pierre Reboul transformiert erdige Küchenkräuter in ein knallbuntes Produkt der Haute Cuisine und würzt zum Beispiel seine Aniskreation mit Oregano. Würzige Almkräuter locken im Sommer Tausende Schafe in die Alpen. Das Filmteam verfolgte die Transhumanz, den Almauftrieb, eine jahrhundertealte Tradition. Aus den Alpen kommt auch ein Hoffnungsträger der Provence. In 1.000 Metern Höhe beginnt das Reich des wilden Lavendels, er heißt auch der Echte Lavendel. Die junge Bäuerin Claire Chastan erntet die duftenden Kräuterbüschel an steilen Berghängen mühsam von Hand. Sie weiß, was ihre Kunden mit der wild wachsenden Pflanze verbinden: „Es ist ein Weg zurück zur Natur. Man kauft einen kleinen Traum.“ (Text: BR Fernsehen) Kräuterwelten – In den Alpen
In unzugänglichen Alpentälern hatten die Menschen über Jahrhunderte hinweg keine andere Möglichkeit, als auf die Heilkraft der Natur zu vertrauen. Das Kräuterwissen war tief im Alltag der Bergbewohner verwurzelt – bis es im 20. Jahrhundert von der modernen Schulmedizin verdrängt wurde. Heute erleben die Kräuter der Alpen eine Renaissance. In den Berchtesgadener Alpen übt „Wurzengraber“ Hubsi Ilsanker einen Knochenjob aus – fast wie vor 400 Jahren. Für die älteste Enzianbrennerei Deutschlands gräbt Hubsi im Berchtesgadener Nationalpark nach den geschützten Enzianwurzeln.Der Gelbe Enzian ist eines der bittersten Heilkräuter der Welt, gut für Schnaps und zur allgemeinen Stärkung. In Graubünden in der Schweiz baut Drogistin Astrid Thurner ein ganzes Edelweißfeld an, um die antioxidativen Wirkstoffe dieser hochalpinen Pflanze für ihre eigene Kosmetiklinie zu nutzen. Im Centrum für Biomedizin in Innsbruck haben Forscher eine neue Edelweiß-Substanz entdeckt: Leoligin, ein Stoff, der die Behandlung von Gefäßkrankheiten revolutionieren könnte. Die Naturheilpraktikerin Astrid Süßmuth weiht die Zuschauer in die „Outdoor-Apotheke“ der Ötztaler Alpen ein. Dabei erfährt man auch etwas über das giftigste Kraut Europas, den Blauen Eisenhut – auch das „Arsen des Mittelalters“ genannt. Im Benediktinerstift Admont besucht das Filmteam die größte Klosterbibliothek der Welt und in Heiligenblut am Großglockner beobachtet es die Trachtenfrauen bei der „Kräuterweihe“. In den Dolomiten in Südtirol bringt Gourmetkoch Franz Mulser den Geschmack der Alm auf die Teller. Das Heu der Seiser Alm, das beim Koch in der Suppe landet, wird in Völs am Schlern für ein Heubad aufbereitet, in dem sich die Kräuteressenzen entfalten, hilfreich bei Gelenk- und Rückenschmerzen. Im Tauferer Ahrntal sammelt Anneres Ebenkofler von den Einheimischen geheime Rezepte und Heilmethoden. Ihr Hotel führt sie nach dem Prinzip der „Alpenländischen Lehre“, ihr Lieblingskraut spielt dabei eine wichtige Rolle: das Johanniskraut. Filmautorin Bärbel Jacks besucht Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das alte Kräuterwissen nicht verlorengeht und eine moderne Anwendung in unserer heutigen Zeit findet. (Text: BR Fernsehen) Kräuterwelten – In der Provence
Kräuterwelten Indiens
In kaum einem anderen Land der Welt bestimmen Kräuter den Alltag der Menschen so, wie in Indien. Sie lassen Räucherstäbchen duften, aromatisieren Seifen, würzen die Küche und heilen. Die SWR Dokumentation gibt Einblicke in die Wildkräuterwelt des Subkontinents. Brahmi, der indische Wassernabel regt den Geist an und beugt Depressionen vor. Tulsi, Heiliges Basilikum, hilft bei so vielen Krankheiten, dass es „das Unvergleichliche“ genannt wird. Und der indische Baldrian, der nur im Hochgebirge wächst, bringt innere Ruhe. 6.000 Pflanzenarten werden auf dem Subkontinent genutzt, die meisten wachsen wild und werden langsam knapp.Denn bei 1,3 Milliarden Bewohnern steigt der Bedarf an Pflanzenmedizin stetig. Zudem verlangt eine wachsende Mittelschicht nach Kosmetika auf Kräuterbasis. Als Folge sind einige Kräuter bereits verschwunden. Langsam beginnt man deshalb mit dem Anbau. Hoch oben im Himalaya zeigt der Film einen Dorfheiler bei der Arbeit. 5.000 Jahre alt ist die Wissenschaft der ayurvedischen Medizin. Heute erfährt die alte Heilkunst einen Boom. In der Altstadt Delhis besuchen die Zuschauer einen Großhändler, der den weltweit rasant wachsenden Kräutermarkt bedient und die Zuschauer blicken in die Labore des weltweit größten Herstellers ayurvedischer Medikamente. In Kerala lernen die Zuschauer die Ärztin einer kleinen Ayurvedaklinik kennen und in Nordindien steigen die Zuschauer mit einer Studentin der tibetischen Medizin in die Berge, wo sie sich auf einen Test in Kräuterkunde vorbereitet. Die SWR Dokumentation „Kräuterwelten Indien“ zeigt die Welt der Kräuter im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne und porträtiert Heiler, Händler, Patienten und Ärzte, die mit und von Wildkräutern leben. (Text: SWR) Kräuterwelten in Südamerika
Lange bevor die spanischen Eroberer den Kontinent in Besitz nahmen, wussten die indigenen Stämme Südamerikas, was in Kräutern steckt. Auch heute ist in den abgelegenen Regionen die medizinische Versorgung ohne Kräuter nicht denkbar. Die SWR-Dokumentation zeigt die Heilkräfte der Natur und ein Wissen, das seit über 2.000 Jahren von Generation zu Generation weitergegeben wird. Durch den globalen Trend zur Naturmedizin gibt es einen wachsenden Markt für Heilpflanzen. Mehr als 70.000 Pflanzenarten werden weltweit gehandelt. In Peru ist dadurch ein neuer Erwerbszweig entstanden. Der Zuschauer lernt eine Familie kennen, die für eine Schweizer Kosmetikfirma die Wurzeln der hochempfindlichen Ratanhia sammelt.Dafür campieren sie wochenlang in der Steppe. Aus ihrer Ernte wird später ein antibakterieller Wirkstoff gewonnen und zu Zahnpasta verarbeitet. Der Film folgt der Spur der Kräuter quer durch den Kontinent. In Bolivien begleiten wir einen deutschen Ethnobiologen, der seit 15 Jahren auf seinen Expeditionen dokumentiert, welche Kräuter die Menschen gegen welche Krankheiten einsetzen. In Patagonien entlockt eine Pharmakologin einem winterharten Kraut betörende Düfte, während ein Spitzenkoch in Buenos Aires in alten botanischen Büchern nach Kräuter sucht, die seine preisgekrönten Menüs einzigartig machen. Die Argentinier scheinen süchtig zu sein nach dem Kräutertee „Mate“. In der Region Misiones haben Kleinbauern sich zusammengeschlossen, um ihn so herzustellen, wie die Guarani-Indianer vor 2.000 Jahren: geräuchert über offenem Feuer. Dank der Delikatesse haben die Mate-Farmer und ihre Familien wieder eine Zukunft. In der 45-minütigen Dokumentation Kräuterwelten – In Südamerika beschwört der Autor Christian Stiefenhofer anhand von Protagonisten-Geschichten Wirkung, Duft und intensiven Geschmack, der in unscheinbaren Kräutern stecken kann. (Text: SWR) Kreta – Die Wilde
Abseits vom Rummel aber gibt es immer noch viele Möglichkeiten, die Seele Kretas zu entdecken. Zum Beispiel im größten Kloster der Insel, Agia Triada. Die Mönche hier leben von Öko-Landwirtschaft. Dazu gehört, dass der Abt es sich nicht nehmen lässt, selbst auf den Traktor zu steigen, wenn Weinernte ist. Die Produkte des Klosters werden in ganz Europa, aber auch im kleinen Klosterladen verkauft. Wer das echte Kreta erleben möchte, muss auf den Psiloritis fahren. Hier, wo die All-Inclusive-Urlauber selten hinkommen, sind die alten Traditionen noch lebendig.Bei Hochzeiten werden Freudenschüsse aus Maschinengewehren abgefeuert. Sie sollen zeigen, dass die Kreter stets wehrbereit sind. Sie sind aber auch heftig umstritten, weil sie schon Tragödien ausgelöst haben. „Hier oben gilt noch das Ehrenwort“, sagt der Pfarrer von Anoiga, im Nebenberuf Zeitungsverleger und Präsident des örtlichen Fußballvereins, auch er ein Waffenfreund, wie jeder hier. Im Dorf nebenan wurden zuletzt Polizisten niedergeschossen, als sie dem Drogen- und Waffenhandel ein Ende bereiten wollten. (Text: SWR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail