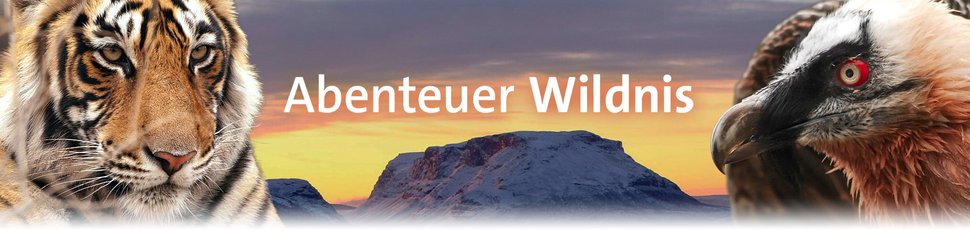553 Folgen erfasst seit 2020 (Seite 21)
Wildes Oldenburger Land – Moore, Wälder, Wiesen
45 Min.Das Oldenburger Land ist so abwechslungsreich wie kaum ein anderer Landstrich in Deutschland. Mit dem Naturfotografen Willi Rolfes geht es im Film auf Entdeckungsreise zu den schönsten und wildesten Landschaften im Oldenburger Land. Gewaltige Kranichschwärme, tausendjährige Eichen und mächtige Damhirsche – das Oldenburger Land ist so abwechslungsreich wie kaum ein anderer Landstrich in Deutschland. Im Süden des Oldenburger Landes liegen riesige Moorflächen, sie sind der wichtigste innerdeutsche Rastplatz für Kraniche und Heimat vieler seltener Tiere und Pflanzen.In der Mitte erstreckt sich die Wildeshauser Geest, eines der größten Waldgebiete Norddeutschlands. Im Norden, am Jadebusen, leben die vielleicht bekanntesten Flussseeschwalben überhaupt, seit 25 Jahren folgen Forscher ihnen auf Schritt und Tritt. Mit dem Naturfotografen Willi Rolfes geht es im Film auf Entdeckungsreise zu den schönsten und wildesten Landschaften im Oldenburger Land. Ein Jahr lang dauerten die Dreharbeiten der aufwendigen Naturdokumentation von Svenja und Ralph Schieke. Richtig bunt wird es Oldenburger Land im Frühling, vor allem rund ums Zwischenahner Meer. Der blühende Rhododendron lockt Zehntausende Touristen ins Ammerland. In Deutschlands größtem privaten Rhododendronpark von Volker Hobbie in Westerstede ist auf 70 Hektar auch reichlich Platz für Rehe, Kaninchen und Eisvögel. Richtig spannend ist es im Oldenburger Land im Sommer, wenn am Banter See in Wilhelmshaven die Küken der Flussseeschwalben geschlüpft sind. Dem Naturfotografen Willi Rolfes liefern die Vogeleltern dramatische Motive, wenn sie Fische für den Nachwuchs erbeuten. Damit die Wilhelmshavener Forscher die Küken untersuchen können, müssen sie sich mitten in die Vogelkolonie wagen. Gegen die Attacken wütender Seeschwalben-Eltern helfen nur dicke Jacken und Schutzhelme. Um die faszinierenden Szenen für diesen Film dokumentieren zu können, haben die Naturfilmer mit einer Super-Zeitlupenkamera, die bis zu 1.100 Bilder pro Sekunde aufzeichnet, gearbeitet. Damit sind auch einzigartige Aufnahmen gelungen wie die vom Hochzeitstanz der Gebänderten Prachtlibellen und der Paarung des Kleinen Nachtpfauenauges, dem Schmetterling des Jahres 2012. (Text: BR Fernsehen) Wildes Prag
45 Min.Prag – vom mittelalterlichen Geist der Stadt fühlen sich Einheimische und Besucher magisch angezogen. In Sichtweite des Altstädter Rings und der Karlsbrücke leben aber auch viele Tierarten. Filmautor Jan Hosek stellt die Tiere bei ihrem Überlebenskampf durchs Jahr in einer der schönsten Städte der Welt vor. Prag gehört zu den größten Touristenattraktionen, die die Welt zu bieten hat. Millionen von Menschen fühlen sich vom mittelalterlichen Geist der Stadt angezogen, wandeln auf den Spuren von Kafka, genießen die Atmosphäre der Altstadt. Aber nicht nur die Menschen fühlen sich von der „Mutter aller Städte“ magisch angezogen.In Sichtweite des Altstädter Rings und der Karlsbrücke leben Hunderte zum Teil seltener Tierarten. Sie profitieren von den Vorzügen des Großstadtdschungels auf ihre Weise. Filmautor Jan Hosek begleitet Mufflons, die auf dem Gelände des Krankenhauses leben, Teichrallen, die gelernt haben, in Bäumen zu nisten, Graureiher, die am Prager Zoo den Pelikanen die Fische stehlen, Amazonenameisen, die unterirdisch ihre Sklaven halten, und Siebenschläfer bei ihrem Überlebenskampf durchs Jahr in einer der schönsten Städte der Welt. (Text: BR) Wildes Regensburg
45 Min.In Regensburg gehen Natur, Kultur und Geschichte respektvoll Hand in Hand. Im Bild: Enten am Donau-Ufer.Bild: Blue Paw Artists/BR/Marion PöllmannRegensburg zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist ein typisches Beispiel dafür, dass gerade Städte mit alter Bausubstanz eine besonders hohe Lebensqualität für Mensch und Natur bieten. Regensburg ist die mittelalterliche Großstadt Deutschlands. In Regensburg bilden Natur, Kultur und Geschichte eine harmonische Einheit. Marion Pöllmann zeigt diese alte, weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannte Stadt aus einem ganz neuen Blickwinkel. Regensburg besitzt heute den größten zusammenhängenden Bestand an romanischer und gotischer Architektur nördlich der Alpen. Die Lage am Kreuzungspunkt der Flüsse Donau, Naab und Regen beschert Regensburg ein mildes Klima und eine vielfältige Natur. Durch den großen Fluss mit seinen Inseln, die großen Wälder rundum und die mittelalterliche Struktur besitzt Regensburg eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt. Die „Stadt am Fluss“ steht jedoch auch für ein besonderes Lebensgefühl: Die Inseln in der Donau sind ein beliebtes Naherholungsgebiet. (Text: BR Fernsehen)Wildes Rio
Rio de Janeiro – inmitten der pulsierenden City schlägt das wilde Herz Brasiliens. Filmemacher Christian Baumeister zeichnet ein prächtiges Bild der brasilianischen Metropole mit ihren Wildtieren und dem weltberühmten Karneval. Traumstadt Rio de Janeiro – die Zehnmillionen-Metropole ist auch die Heimat exotischer Wildtiere. Der Tropenwald reicht fast bis ins Stadtzentrum. Begegnungen mit Kaimanen im Swimmingpool und plündernden Affenbanden, die sogar in Hochhausappartements eindringen, sind hier an der Tagesordnung. Das Filmteam begleitet die Künstler einer Sambaschule bei ihren Vorbereitungen auf den Höhepunkt des Jahres: In einer riesigen Lagerhalle entwerfen Skulpteure naturgetreue Tierplastiken, Schneiderinnen kreieren, inspiriert von bunten Vögeln und Schmetterlingen, fantasievolle Kostüme für die Nacht der Nächte.Wenn es dunkel wird in der riesigen Werkhalle, kommen die heimlichen Bewohner aus ihren Verstecken hervor: Opossums ziehen zwischen Kostümen und Pappmaschee ihre Jungen groß. Majestätische Flugaufnahmen rund um den Zuckerhut zeigen den fließenden Übergang zwischen Natur und Stadt. Die einzigartige Landschaft trug Rio den Beinamen „Cidade Maravilhosa“ – „Wunderbare Stadt“ ein. Regelmäßig kommt es hier zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Kapuzineräffchen stehlen Nahrungsmittel vom Frühstückstisch, in den Armenvierteln gehen Schlangen auf Jagd, Krallenaffen tummeln sich in den Baumkronen der City, nachts umflattern Fledermäuse die Bürohäuser. (Text: BR Fernsehen) Wildes Rumänien – Land der Bären und Wölfe
Im Südosten Europas liegt ein Naturjuwel, das seinesgleichen sucht: Rumänien. Durch seine unzugänglichen Wälder streifen noch Bären und Wölfe, in seinen abgelegenen Dörfern leben die Menschen bis heute im Einklang mit der Natur – vieles erscheint wie aus längst vergangenen Zeiten. Siebenbürgen liegt im Zentrum Rumäniens: Seit etwa 800 Jahren sind hier die Siebenbürger Sachsen zu Hause. Die von Rhein und Mosel stammenden Siebenbürger Sachsen wirtschaften noch heute nach bewährter Tradition, viele sind Selbstversorger: Die meiste Feldarbeit wird von Hand erledigt, Pferde- und Ochsengespanne helfen dabei.Die Karpaten umgeben Siebenbürgen – über 2.000 Meter ragen die mächtigen Gebirgszüge empor. Wenn im Sommer große Schafherden auf den saftigen Bergwiesen weiden, droht ihnen Gefahr durch hungrige Bären. Große Schutzhunde begleiten daher die Schafe und ihre Hirten. Abseits der Alm tummeln sich Murmeltiere – während des kurzen Sommers im Hochgebirge sind sie vor allem damit beschäftigt, sich so viel Speck wie möglich für den nächsten Winterschlaf anzufressen. Rumänien ist ein Land der Kontraste: Lange Sandstrände, Felsklippen und mediterranes Klima prägen die Küste zum Schwarzen Meer. Gut geschützt an steilen Ufern nisten Zehntausende Uferschwalben – in mühsamer Feinarbeit graben sie ihre ein Meter langen Bruthöhlen in die Wand. Wo die Donau ins Schwarze Meer mündet, tut sich ein weiteres Naturparadies auf: das Donaudelta. Im größten Schilfgebiet der Erde finden viele seltene Vögel Schutz und Lebensraum. Nur hier leben noch große Kolonien von Pelikanen. Wenn in Siebenbürgen der Sommer zu Ende geht, werden die süßen Trauben geerntet. Die Weinlese ist der Höhepunkt im Erntejahr. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Das Abenteuer
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Die siebte Folge gewährt dem Zuschauer einen Einblick in die Entstehung der Serie. Einen Blick hinter die Kulissen der aufwendigen deutschen Naturfilmreihe „Wildes Russland“ gewährt die Folge „Das Abenteuer“. Gezeigt wird, was Russland für die Tierfilmer während ihres dreijährigen Aufenthalts zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean an Überraschungen bereithält.Tobias Mennle, Ivo Nörenberg, Henry M. Mix, Uwe Anders, Christian Baumeister und Oliver Goetzl stehen selbst vor der Kamera und berichten von großen Erwartungen, kleinen Katastrophen und bewegenden Erfolgserlebnissen. Um die faszinierende Wildnis und deren Bewohner filmen zu können, besteigen die furchtlosen Autoren uralte Fluggeräte, verbringen ganze Tage im Iglu und tauen bei minus 30 Grad ihre gefrorenen Stiefel am Feuer auf. Sie entgehen nur knapp einem Erdrutsch, der einen kompletten Berghang in Bewegung versetzt und „wie von Gottes Hand gestoppt“ vor ihrer Hütte zum Stillstand kommt. Bären zerlegen ihre Kamera. Ein Unwetter schwemmt den Proviant davon. Sie stehen Auge in Auge mit Eisbären und schließen Freundschaft mit jungen Käuzen und neugierigen Polarfuchswelpen, die ihnen bis zum Tarnzelt folgen. Dabei achten sie stets darauf, den natürlichen Verlauf der Dinge in der Natur nicht zu stören und fangen dadurch bewegende Bilder einer monumentalen Wildnis ein. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Der Kaukasus
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Zwischen Europa und Asien, eingezwängt zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer, ragen gewaltige Berggipfel über 5.000 Meter hoch in den Himmel. Der Kaukasus ist eine Welt voller Vielfalt und Gegensätze, wo Sandwüsten und eisige Gletscher aufeinandertreffen, wo blubbernde Schlammvulkane auf dichte Wälder treffen und sich Sandstürme mit Lawinen abwechseln.Es ist ein Land, in dem Bären und Wisente leben, Luchse jagen und Geier auf der Suche nach Aas kreisen. Die vielfältigen Landschaften haben einen riesigen Artenreichtum hervorgebracht – hier sind im Laufe der Evolution Tierarten entstanden, wie man ihnen sonst nirgends begegnet. Geradezu außerirdisch mutet die Saiga-Antilope an, deren aufgeblähte, flexible Nase eher an einen Rüssel erinnert. Dem Langohrigel als echtem Wüstenbewohner erleichtern seine langen Beine das Fortkommen im Sand. Für viele bedrohte Arten ist die Region der letzte Zufluchtsort: Kaukasusgämsen und Ture erklimmen die schroffen Felsen, während Störe, urtümliche Wesen aus der Urzeit, die Tiefen des Kaspischen Meeres durchschwimmen. Doch wie so viele ist dieses Paradies bedroht. Obwohl gut 3.000 Quadratkilometer des Hochgebirgssystems streng geschützt sind, nimmt die Wilderei überall zu. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Der Ural
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Geheimnisvolle Steinmonumente markieren die Grenze zwischen Europa und Asien: Auf einem Felsplateau des nördlichen Ural-Gebirges ragen die „Sieben starken Männer“ bis zu 80 Meter in den Himmel. Den Einheimischen gilt „Manpupuner“ als Ort, an dem sich die Geister versammeln. Die Ausläufer des Urals erstrecken sich von der Küste des Nordpolarmeers über 2.000 Kilometer bis an die kasachische Grenze.Dichte Nadelwälder bedecken die Hänge und laufen sanft in der angrenzenden Steppenlandschaft aus. Hungrige Wölfe durchstreifen den Wald auf der Suche nach Beute, stets auf der Hut vor Bären, den unangefochtenen Herrschern im Wald. Die größte Wildnis Europas versorgt die Bären nicht nur mit Beutetieren, sondern auch mit Beeren und Honig. Geschickt klettern die Bären auf die höchsten Bäume, um die von den Menschen der Region Baschkortostan aufgehängten Bienenkörbe herunterzureißen. Der Ural ist auch die Heimat von Elchen – die großen Tiere finden auch dann noch Nahrung, wenn Bären schon bis zum Bauch im Schnee versinken. Erstmalig wurde gefilmt, wie Gruppen von Elchen am Ende des Winters große Flüsse durchschwimmen, um in neue Weidegebiete zu gelangen. Hohle Baumstämme dienen dem Uralkauz als Bruthöhle. Die vielen Bäche des Urals bieten ideale Bedingungen für zwei besondere Tierarten: Europäische Nerze sind geschickte Fischer und andernorts selten geworden. Der Desman, ein Verwandter des Maulwurfs, den es nur in Russland gibt, taucht lieber nach Schnecken. Seine lange Nase benutzt er dabei als Schnorchel. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Die Arktis
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Russland hat mehr arktische Gebiete als jedes andere Land der Erde – die endlosen Eiswüsten und Tundren ziehen sich vom Weißen Meer an der Grenze Finnlands bis nach Tschukotka im äußersten Nordosten an der Beringstraße nur einen Steinwurf von Alaska entfernt.Hier liegt auch die Wrangel Insel. Dort sammeln sich im Sommer große Gruppen von Eisbären, um auf die Ankunft der Walrosse zu warten. Nach eher mageren Wochen hoffen die größten Bären der Erde auf einfache Beute, aber die Kolosse des Meeres wissen sich zu wehren. Im äußersten Westen der Arktis, im Weißen Meer, liegt die Kinderstube von Sattelrobben und Beluga Walen. Sie finden hier ideale Bedingungen, um ihre Jungen aufzuziehen. Einen härteren Start haben junge Schneekraniche in Tschukotka – ihre Eltern legen am Ende des arktischen Winters ihre Eier und die müssen immer warmgehalten werden. Eine halbe Stunde in der eisigen Luft zerstört die Brut. Schneekraniche kommen nur in Russland vor. Die Schneegänse, die auf Wrangel brüten, müssen sich vor den diebischen Polarfüchsen in Acht nehmen, die es sowohl auf ihre Eier als auch auf die Küken abgesehen haben. Im kurzen arktischen Sommer versuchen die Füchse, so viel Nahrung wie möglich für ihre Jungen zu finden. Denn eines ist sicher in der russischen Arktis – nach wenigen Wochen des Überflusses regiert wieder der dunkle Winter. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Kamtschatka
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Die Halbinsel Kamtschatka – hier treffen Feuer und Eis aufeinander. Feuer speiende Vulkane herrschen über Himmel und Erde. 20 verschiedene Klimazonen gehen ineinander über: Vulkanschlote rauchen neben Gletschern, meterhohe Schneewehen grenzen an kochend heiße Geysire. Im „Tal der Geysire“ sind die heißen Wasserfontänen besonders konzentriert.Es wurde daher zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. In einem verheerenden Erdrutsch 2007 wurden jedoch viele von ihnen unter Schlammmassen begraben. Kamtschatka gehört zu den geothermisch aktivsten Gebieten der Welt, wie die zahlreichen Vulkankrater, Geysire und Fumarolen deutlich vor Augen führen. Trotz der launischen Natur ist die heimische Tierwelt einen gewissen Komfort gewöhnt: Bachstelzen finden „beheizte“ Kinderstuben und Bären lieben das Bad in den Thermalquellen. Das warme Wasser befreit sie von Flöhen, Zecken und anderen Parasiten. Überhaupt ist Kamtschatka ein Paradies für Bären: Im feuchten Sommer finden sie genug Kräuter und Beeren – und im Spätsommer stehen täglich 40 Kilogramm Lachs pro Bär auf dem Speiseplan. Auch der seltene Riesenseeadler ist hier heimisch und jagt im Herbst Lachse für seine Jungen. Im Meer finden Orkas und Pottwale Nahrung im Überfluss. Im Winter schlägt die Stunde der kleineren Raubtiere: Während die Bären Winterschlaf halten, konkurrieren Vielfraß und Rotfuchs um kleine Beutetiere und vor allem um Aas. Die Adler belagern die wenigen offenen Wasserstellen und kämpfen untereinander um die wenigen Fische. Noch stehen sechs Monate kalter Winter bevor – im Land der Bären und Vulkane. (Text: BR Fernsehen) Wildes Russland – Sibirien
Die Reihe „Wildes Russland“ zeigt die Natur des riesigen Landes zwischen Schwarzem Meer und Pazifischem Ozean. Fernab der Metropolen Moskau und St. Petersburg offenbart sich eine ursprüngliche Welt mit rauen Gipfeln und endloser Weite, ungezähmten Flüssen und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Eine riesige Wildnis im Herzen Russlands ist Sibirien. Jenseits des Urals gelegen, umfasst Sibirien rund zehn Prozent der gesamten Landmasse der Erde. Keine Frage, dass es sich um ein Land der Superlative handelt: riesige Temperaturschwankungen um etwa 80 Grad, der tiefste und älteste See der Welt und die wohl widerstandsfähigsten Tiere unseres Planeten.Das Moschustier dürfte das einzige Reh mit Vampirzähnen sein und Wölfe machen Bären die heiß begehrte Beute streitig. Der harte Winter fordert Anpassung – der dichte Pelz des Zobels wurde ihm allerdings fast zum Verhängnis. Inzwischen liegen Pelze glücklicherweise nicht mehr im Trend, und die einheimischen Raubtiere stellen dem Zobel häufiger nach als der Mensch. Sibirien ist die kälteste bewohnte Gegend der Erde, und die Menschen leben meist in einfachen Verhältnissen. Die Männer züchten die berühmten jakutischen Pferde und halten große Rentierherden – ihre Haustiere kennen jedoch keinen Stall und keine Futterzeit, sondern sorgen in der Wildnis für sich selbst. Zugefrorene Flüsse dienen im Winter als Straßen, auf denen Rentierschlitten und Lastwagen gleichermaßen unterwegs sind. Und der Baikalsee ist dann nicht nur der größte See der Welt, sondern auch ein riesiges Eishockeyfeld. Für die scheuen Baikalrobben bleibt immer noch genug Platz – auch wenn sie sich im Sommer um die wenigen Sonnenplätze auf den Felsen streiten. Zum ersten Mal gelangen auch spektakuläre Unterwasseraufnahmen der einzigen Süßwasserrobben-Art unseres Planeten. (Text: BR Fernsehen) Wildes Sardinien
45 Min.Sardinien hat viele Gesichter: Schnee bedeckt die Gipfel der Gebirge im Winter, der Frühling taucht ganze Täler in ein prächtiges Rosa aus Mandelblüten und im Sommer fressen sich Feuerwalzen durchs Innere der Insel. Sechzig Meter hohe Sandberge wandern durch eine der größten Dünenlandschaften des Mittelmeeres und vor der Küste liegt das „Heiligtum der Wale“, in dem sich ein Dutzend Arten der großen Meeressäuger tummeln. Die Unterwelt Sardiniens ist mit fantastischen Höhlenlabyrinthen gespickt: Zufluchtsort Zehntausender von Fledermäusen in den hohen Karstgebirgen und gewaltiger Geschwader von Feuerquallen in den tiefen Grotten entlang der Küsten: Diese Naturdokumentation zeigt mit aufwendiger Technik über und unter Wasser die unbekannten Seiten der Insel, wie sie ein Urlauber an der Costa Smeralda kaum einmal sieht.Dabei tut sich schon vor der „Smaragdküste“ im Norden Sardiniens eine farbenprächtige Zauberwelt auf: Filigrane Blumentiere und Röhrenwürmer leben hier, edle Korallen und gewaltige Zackenbarsche, die zutraulich sind, weil sie im streng geschützten Archipel nicht gejagt werden dürfen. Die sardische Küste ist über 1.900 Kilometer lang – ein Paradies für Taucher, die mit etwas Glück das flatterhafte Liebesspiel schriller Geschöpfe beobachten können: So genannte Nacktkiemer, die man kaum als Schnecken erkennt, und die sich Gift von ihrer Beute klauen, um nicht selber gefressen zu werden. Auch das Innere Sardiniens verblüfft mit seiner vielgestaltigen Natur – schroff, wild, und immer wieder überraschend grün. Hier werden die letzten Geier der Insel in „Geierrestaurants“ gefüttert, damit sie sich wieder vermehren. Seltene Wildschafe, die Mufflons, ziehen durchs Inselgebirge, dazu sardische Rothirsche und halbwilde Pferdchen. Sie sind Mitbringsel von frühen prähistorischen Seefahrern, von Phöniziern oder Römern. Denn Sardinien ist auch eine uralte Kulturlandschaft – wovon mehr als 7.000 Steintürme zeugen, die Nuraghen. Viele sind mehr als 3.500 Jahre alt. Überall offenbart sich die uralte Schöpfungsgeschichte der Insel: So tauchen die Kameras vorbei an unterseeischen heißen Quellen vor der Küste in über 2.000 Meter Tiefe hinab, wo eine Todeszone beginnt: eine hochkonzentrierte Salzlake. Sie ist Überbleibsel einer Zeit, als Sardinien nicht vom Wasser umgeben war: Vor fast sechs Millionen Jahren trocknete das Mittelmeer aus – und die Insel lag inmitten einer großen Salzwüste zwischen Afrika und Europa. Computeranimationen zeigen den wohl größten Wasserfall der Weltgeschichte, der innerhalb von Jahrzehnten das Mittelmeer wieder auffüllte und Sardinien erneut zur Insel machte, wie wir sie bis heute kennen: einer Insel mit vielen Gesichtern. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Dänemark
45 Min.Hammershus war einst eine der größten Burgen Nordeuropas. Mittlerweile gehört die Burgruine zum Weltkulturerbe.Bild: NDR/Nautilusfilm/NDR NaturfilmWeite Strände, mildes Klima und natürlich die kleine Meerjungfrau im Hafen von Kopenhagen: So kennt man Dänemark. Doch das kleine Land hat deutlich mehr zu bieten … Dänemark hat viel zu bieten: Urwälder, in denen Rothirsche, Wildschweine und Kraniche leben; Kegelrobben, die sich auf Sandbänken tummeln und Raabjerg Mile, eine der größten Wanderdünen Europas. Und schließlich die schneeweißen Kreidefelsen der Insel Mön. Der Filmemacher Jan Haft gibt Einblicke in die Vielfalt Dänemarks und zeigt seltene Tiere wie Wanderfalken und Kampfläufer. Rothirsche, die größten Wildtiere Dänemarks, leben in einigen Dünenlandschaften und sind sogar am Strand zu beobachten.Die Wälder von Lille Vildmose im nördlichen Jütland gehören zu den artenreichsten Nordeuropas. Mehr als 4.700 Tier- und Pflanzenarten gibt es hier, in einem der letzten Urwälder Europas. Während Dänemark überwiegend kultiviert ist, herrscht in diesem Schutzgebiet noch der ursprüngliche Mischwald mit kleinen Lichtungen und verrottenden Baumstämmen. Das Land wurde früh besiedelt. Die Wikinger holzten viele Wälder ab, um ihre Drachenboote zu bauen. Viehweiden entstanden. Wo Rinder und Schafe die küstennahen Feuchtwiesen kurzhalten, leben Wat- und Wiesenvögel wie der auffallende Kampfläufer mit seinen sehenswerten Balzkämpfen. Im Frühjahr und Herbst sind die Flächen Rastplatz für Tausende Zugvögel. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Das Abenteuer
„Wildes Skandinavien – Das Abenteuer“ ist die spannende Dokumentation über die Entstehung dieser besonderen Naturfilmreihe. Gezeigt werden Höhepunkte und kleine Niederlagen bei den Dreharbeiten, skurrile, aufregende und gefährliche Erlebnisse der vier Filmteams. Das Making-of gibt Einblicke in das spartanische und wahrhaft abenteuerliche Leben der Tierfilmer und ihre Arbeit. So steht etwa Jan Haft beim Dreh in Norwegen einem wütenden Moschusochsen gegenüber als er eine ferngesteuerte Kamera aufbaut. Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg wollen sich aus der Luft einen Überblick verschaffen und mit dem Heißluftballon über die finnischen Winterwälder fahren. Es ist ihre erste Ballonfahrt nach einem katastrophalen Ballonunfall in Russland, bei dem Ivo sich schwer verletzt hatte.Schon kurz nach dem Start geht alles schief: Der Ballon kracht in einen Baum, Äste verfangen sich im Gasbrenner und fangen Feuer. In Grönland ist Uwe Anders Eisbären auf der Spur. Es ist nicht das erste Mal, dass er die großen Raubtiere filmt – doch die grönländischen Bären gelten als besonders angriffslustig. Als ein Eisbär an das Zeltcamp herankommt, sind alle in Alarmbereitschaft. Die aufregendsten Tage seines Berufslebens erlebt Tobias Mennle in Island: Er ist dabei, als der Vulkan Eyjafjallajökull ausbricht. Die Asche verwandelt das Land in eine Wüste, hochgiftig für die dort lebenden Tiere. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Finnland
45 Min.Für „Wildes Skandinavien – Finnland“ gelangen den Tierfilmern Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg außergewöhnliche Einblicke in das faszinierende Leben wilder Gleithörnchen, Bären und Wölfe, Luchse und Vielfraße. Im Osten Skandinaviens erstreckt sich Finnland – ein Mosaik aus Wasser und Wald. Nur fünf Millionen Menschen leben auf einer Fläche so groß wie Deutschland. In den Wäldern nahe der russischen Grenze gibt es noch Braunbären und Wölfe. Bis ins 18. Jahrhundert verehrten die Finnen Bären als Gottheit. Noch immer gilt der Bär als Nationalsymbol. Wo sich Bären wohlfühlen, können auch Wölfe leben – im Rudel trauen sie sich, einen Braunbären um seine Beute zu bringen.Eine Wolfsfamilie in der finnischen Wildnis zu filmen, hat Seltenheitswert, da es dort nur noch 150 Tiere gibt. Im Frühjahr treffen sich die Auerhähne zur Balz in ihren Arenen. Dem Sieger winkt die Paarung mit den Weibchen, dem Verlierer bleibt nur die Hoffnung auf einen neuen Versuch. Merkwürdig erscheint es, wenn sich Gleithörnchen um die Gunst eines Weibchens bemühen. Nachdem ein Weibchen einen Baum mit Kot markiert hat, treffen „wie im Flug“ die ersten Verehrer ein. Dank ihrer Flughaut können die Nager relativ große Distanzen überwinden. Verlassene Spechthöhlen sind nicht nur bei Gleithörnchen beliebt. Auch Schellenten nutzen sie, um darin ihre Küken auszubrüten. Schon kurz nach dem Schlupf lockt die Mutter ihren Nachwuchs ins Freie. Erstmals aus sechs Kamera-Perspektiven und in der Wildnis gedreht, ist der Absprung der flugunfähigen Kleinen in die Tiefe zu sehen. Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg haben über drei Jahre außerordentlich detailliert Tierverhalten dokumentiert. Hierfür wurden sie beim Wildlife Film Festival in Missoula (USA) bereits mit fünf Auszeichnungen geehrt. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Grönland
45 Min.Eisbär ohne Eis: Im Sommer, wenn das Meereis vor Grönlands Küsten schmilzt, müssen Eisbären oft weit wandern, um Beute zu finden – normalerweise jagen sie vom Eis aus nach Robben.Bild: BRKalbende Gletscher, schwimmende Eisberge und Polarlichter – Grönland ist die größte Insel der Erde mit einem Herz aus Eis: 1,7 Millionen Quadratkilometer groß und bis zu drei Kilometer dick ist Grönlands Eiskappe. Im Nordosten der Insel liegt der größte Nationalpark der Erde. Dies ist das Reich von Eisbären, Moschusochsen und Walrössern. In den menschenleeren Weiten leben auch weiße Wölfe. An den Küsten brüten Millionen von Krabbentauchern. Bei Brutbeginn im Frühjahr formieren sie sich manchmal zu riesigen Schwärmen – ein einzigartiges Naturschauspiel. Lange, dunkle Winter mit eisigen Schneestürmen machen Grönland zu einem Lebensraum für Spezialisten.Selbst die mächtigen Moschusochsen geraten jetzt an ihre Grenzen. Der Nahrungsmangel macht ihnen zu schaffen. Nur die Stärksten überleben bis zum nächsten Frühjahr, wenn der Schnee endlich das Land frei gibt und die Tundra zu blühen beginnt. Anders als für Moschusochsen ist gerade der arktische Sommer für Eisbären die schwierige Jahreszeit. Sie jagen Robben vom Meereis aus, wenn es im Sommer schmilzt, wird die Nahrung für die Bären knapp. Im Film „Wildes Skandinavien – Grönland“ wird der andauernde Überlebenskampf der arktischen Tierwelt gezeigt. Atemberaubende Landschaftsaufnahmen und spannende Tiergeschichten machen den Film von Uwe Anders so besonders. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Island
45 Min.Im April 2010 überrascht der isländische Eyjafjallajökull mit einer gewaltigen Ascheeruption, die wochenlang anhält und den europäischen Flugverkehr komplett lahmlegt.Bild: PHOENIX/NDR/Tobias MennleIsland – vor 17 Millionen Jahren formten gewaltige Eruptionen die Insel im Nordatlantik mit ihren zerklüfteten Bergen, zahlreichen Wasserfällen und rund 200 Vulkanen. Landsäugetiere gibt es nur wenige. Die ersten Polarfüchse kamen auf Eisschollen treibend vor rund 10.000 Jahren nach Island. Zwei Jahre lang folgte Filmemacher Tobias Mennle den Füchsen. Er filmt ihr stürmisches Liebesspiel, die Aufzucht der Jungen im Bau und ist dabei, als die Jungfüchse zum ersten Mal auf Jagd gehen. Erst vor gut 1.000 Jahren gelangten die berühmten Islandpferde an Bord norwegischer Wikingerschiffe auf die Insel. Mittlerweile ist die ursprüngliche Pferderasse streng geschützt. Berühmt ist Island auch für seine Seevogelkolonien.In steil abfallenden Klippen brüten Dreizehenmöwen, Papageientaucher und Dickschnabellummen. Eines der größten Naturwunder Islands ist die Silfra-Spalte. Ein bis zu 40 Meter tiefer Canyon, der die Insel in zwei Hälften teilt. Die Silfra-Spalte ist gefüllt mit dem wohl klarsten Wasser der Welt. Am Ende des gigantischen Grabenbruchs füllt es eine blau schimmernde Lagune von einmaliger Schönheit. Eisige Gletscher, kochend heiße Geysire und dampfende Fumarolen kann man auf Island jeden Tag beobachten. Zu einem Vulkanausbruch aber kommt es seltener – zuletzt im März 2010: Entlang einer riesigen Spalte stößt der Eyjafjallajökul über Wochen große Mengen Lava aus und legt mit riesigen Aschewolken Europas Flugverkehr lahm. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Norwegen
45 Min.Zauberhafte Tundra: Bis weit in den Sommer hinein liegt Norwegens Fjell-Landschaft unter Schnee.Bild: NDR/Nautilusfilm/NDR NaturfilmMit diesem Film ist den Machern der weltweit ausgezeichneten Produktion „Mythos Wald“ eine opulente Reise zu den schönsten Naturschauplätzen zwischen Skagerrak und Nordkap gelungen. Filmemacher Jan Haft gelingt es, die Tierwelt und die entlegenen Landstriche Norwegens aus ungewohnten Perspektiven zu zeigen. Zu sehen ist, wie im eisigen Winter Seeadler mit Nebelkrähen um Nahrung streiten – mit fatalen Folgen für die furchtlosen Rabenvögel, wie Lemminge im Frühjahr über dünnes Eis flitzen, und wie Doppelschnepfen ihren klirrenden Balzgesang erklingen lassen. Das Team folgt einer Herde Moschusochsen auf ihrer Wanderung durch die baumlose Tundra.Die Naturfilmer werden Zeugen der eindrucksvollen Brunftkämpfe, erleben die Moschusochsen bei der Paarung und der Aufzucht ihrer Jungen. In einer Superzeitlupe wird die Wucht förmlich spürbar, wenn zwei Kolosse von Moschusochsen mit voller Kraft und Kopf voran aufeinanderprallen. Auch die Ohrentaucher gehen beim Kampf um die Weibchen nicht zimperlich miteinander um. Erst die hochauflösende Zeitlupe macht deutlich, wie heftig die Vögel miteinander streiten. Friedlicher und weitaus graziler geht es beim Balztanz zu, wenn sich die Partner anmutig im Synchronschwimmen üben. (Text: BR Fernsehen) Wildes Skandinavien – Schweden
45 Min.Faszinierendes Tierverhalten und brillante Vogelflugaufnahmen machen „Wildes Skandinavien – Schweden“ zu einem Fernseherlebnis. Die Naturfilmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg zeigen Schweden von seiner wilden Seite. Im Norden von Schweden, in den Hochlagen des Sarek Nationalparks, liegt bis zu sechs Monate im Jahr Schnee. Spezialisten wie der Bartkauz haben sich angepasst. Er hört eine Wühlmaus selbst unter der Schneedecke – spannende Zeitlupen-Aufnahmen zeigen die große Eule bei der Jagd. Wenn die Singschwäne im Frühjahr ihre Brutreviere besetzen, sind die schwedischen Seen noch vereist. Beißend gehen die konkurrierenden Männchen aufeinander los.Auch bei den Birkhühnern geht es zur Balz im Frühjahr um alles – erst hochauflösende Zeitlupenbilder zeigen, was genau beim Kampf der Hähne passiert. Wenn Schnee und Eis weichen, kommen im Mai die Elchkälber zur Welt. Jetzt beginnen üppige Zeiten in Schwedens Wäldern und Sümpfen. Nicht nur an den Bäumen, auch im Wasser finden die Elche reichlich zu fressen: Seerosen sind eine Delikatesse. Nach einem kurzen, intensiven Sommer kündigen die Brunftschreie der Elche wieder den Herbst an. Mit mächtigem Geweih gehen die Elchbullen auf Brautschau. Doch letztlich entscheidet das Weibchen, mit wem es sich paaren will. (Text: BR Fernsehen) Wildes Slowenien
45 Min.Slowenien liegt im Herzen Europas: zwischen Italien, Österreich und Kroatien, zwischen Alpen und Meer. Es gehört zu den kleinsten Ländern des Kontinents. Die Vielfalt der unterschiedlichen Landschaften, die eine Fülle von Tier- und Pflanzenarten bergen, ist dennoch groß. Die Dokumentation zeigt in jeder Region des Landes die für sie typische Tier- und Pflanzenwelt. In den weiten Wäldern Sloweniens leben noch Braunbären und Wölfe, es überwintern Scharen von Edelfinken in hohen Bäumen und in einer Höhle verbirgt sich der geheimnisvolle Grottenolm, ein europäischer Schwanzlurch.Doch nicht nur in der nahezu unberührten Wildnis, sondern auch in direkter Nachbarschaft zum Menschen finden sich zahlreiche Tierarten, darunter Füchse, Igel und Fledermäuse. Eingebettet zwischen Gebirge und Küste verfügt Slowenien über verschiedenste Ökosysteme auf engstem Raum. Dadurch ergibt sich die einzigartige Gelegenheit, über 50 unterschiedliche Tierarten gleichzeitig zu beobachten. Ob unter der Erde, inmitten tiefer Wälder oder an der Küste – über einen Zeitraum von einem Jahr kann miterlebt werden, wie die Tiere ihren Lebenszyklus durchlaufen, vom Jagen und der Nahrungsaufnahme über das Balzverhalten und die Paarung bis zu Rivalitätskämpfen und der Fürsorge für den Nachwuchs. „Wildes Slowenien“ entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Reise, die von den Julischen Alpen mit ihren schneebedeckten Gipfeln über die Pannonische Ebene und hinab in unterirdische Karstwelten bis zu den Tiefen der Adria reicht. (Text: BR Fernsehen) Wildes Slowenien – Brücke zum Balkan
45 Min.Von Alpengipfeln bis in die Unterwasserwelt der Adria, der Naturfilm „Wildes Slowenien – Brücke zum Balkan“ zeigt die vielen unbekannten Seiten eines kleinen Landes im Herzen Europas, in dem ein enges Miteinander von Mensch und Natur bis heute möglich ist. Im Sommer 2023 war das kleine Alpenland Slowenien weltweit in den Schlagzeilen: Gewaltige Regenfälle und Überschwemmungen richteten Schäden von dramatischem Ausmaß an. Dabei ist der Kreislauf des Wassers für Sloweniens Natur besonders prägend.Die spektakuläre Karstlandschaft mit Höhlensystemen, unterirdischen Flüssen, einem geheimnisvoll verschwindenden und wieder auftauchenden See, Wasser prägt diese Landschaft, erschafft sie und zerstört sie. Und sie ist besonders vielfältig, die Landschaft Sloweniens: So klein das Land ist, es vereint Meeresküste und Hochgebirge und weist eine beeindruckende Artenvielfalt auf. In Slowenien bewahren die Menschen weite Teile der Natur des Landes für bedrohte Tierarten, wirtschaften mit Weitsicht und unterstützen Luchse und Goldschakale bei ihrer Rückkehr. Auf relativ kleiner Fläche leben hier auch besonders viele Braunbären. Dem Kamerateam, Christine Sonvilla und Marc Graf, gelangen seltene Aufnahmen während der Brunft der Tiere wie sie aus Mitteleuropa bisher noch nicht zu sehen waren. Die ausgedehnten Gewässer im Süden des Landes sind Schauplatz spektakulärer Hochzeitsflüge von Abermillionen Eintagsfliegen. Und die Adriaküste überrascht mit Flamingos, Delfinen und exotisch anmutender Meeresfauna. (Text: BR) Wildes Tokio
38 Millionen Menschen, keine Stadt der Welt hat mehr Einwohner/innen als der Großraum Tokio. Millionen Lichter verwandeln die japanische Hauptstadt nachts in ein gigantisches Geflecht aus Goldfäden, doch tagsüber dominieren Glas und Beton. Kaum zu glauben, dass in diesem Moloch Tiere eine Zuflucht finden. Und doch wurden die Filmemacher fündig und von der Artenvielfalt in der Metropole überrascht. Als Comicfiguren sind Tanukis, wie Marderhunde in Japan genannt werden, omnipräsent, aber in freier Wildbahn bzw. auf offener Straße haben nur wenige Menschen in Tokio diese pelzigen Nachbarn gesehen.Das liegt vor allem daran, dass sie meist nachtaktiv sind. Dann statten sie gern Tempeln einen Besuch ab, da die Opfergaben der Gläubigen immer eine gute Mahlzeit garantieren. Der größte Tempel ist der Meiji-Schrein. Bei seiner Eröffnung 1920 wurden über 100.000 Bäume gepflanzt. 100 Jahre später ist auf dem 70 Hektar großen Areal ein richtiger Wald entstanden, der über 230 verschiedene Baumarten beherbergt und Lebensraum für zahlreiche Vogelarten, Schildkröten, Schlangen und Insekten bietet. So viel Platz inmitten von Tokio zu haben, ist eher die Ausnahme als die Regel. Gerade entlang der Küste gibt es kaum noch natürliche Strände. So wundert es nicht, dass dank der Hilfe einiger Wissenschaftler eine Seeschwalbenkolonie auf dem Dach einer Kläranlage eine neue Heimat gefunden hat. Mittlerweile brüten jedes Jahr mehr als 500 Paare dort. Aber nicht nur Vögel finden auf dem Dach Platz. Sogar Reisfelder sind inzwischen in luftiger Höhe angelegt worden. Sie produzieren nicht nur Sauerstoff, sondern dienen auch als natürliche Klimaanlage. Auch die Bucht von Tokio bietet einige Überraschungen: Es gibt einen Unterwassertempel, Haiversammlungen und auch der Walhai, die größte Fischart der Erde, lässt sich hin und wieder hier blicken. Die japanische Hauptstadt gilt als extrem sicher, aber in den Vorstädten treiben Diebesbanden mit strubbeligem Fell ihr Unwesen. Japanmakaken warten nur darauf, umliegende Gärten und Gemüsestände zu plündern. Die Affen sind dabei gleichermaßen geschickt und dreist. Dies sind nur einige Beispiele der Tierwelt der Metropole Tokio. Dank der erstaunlichen Vielfalt und der engen Beziehung der Japaner zur Natur ist Tokio wilder als man es auf den ersten Blick für möglich halten würde. (Text: BR Fernsehen) Wildes Uganda – Tierparadies im Osten Afrikas
45 Min.Männerbünde: Lange dachte man, sie seien Einzelgänger, doch im Süden des Queen Elizabeth Nationalparks kommen die großen Elefantenbullen zusammen. Warum sie sich hier treffen ist noch unerforscht.Bild: NDR/doclights/Terra Mater Facutal Studios/Harald PokieserWeite Savannen, alte Vulkanriesen, salzhaltige Höhlen: Winston Churchill nannte Uganda einst „die Perle Afrikas“. Das Land im Osten Afrikas ist nur etwa zwei Drittel so groß wie Deutschland und umfasst doch Landschaften, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Zwischen dem Ruwenzori-Gebirge im Westen und dem Vulkan Mount Elgon im Osten Ugandas erstreckt sich das Land mit heißen, trockenen Savannen, unberührten Regenwäldern, dem größten Süßwassersee des Kontinents und einem fruchtbaren, dicht besiedelten Zentrum. Ein Kaleidoskop unterschiedlicher Lebensräume mit einer faszinierenden, oft einmaligen Tier- und Pflanzenwelt.Im Dschungel des Bwindi-Nationalparks leben besonders seltene Tiere: Berggorillas. Etwa 400 der rund 1.000 Primaten, die im Grenzgebiet zwischen Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo zu finden sind, sind hier zu Hause. Die Gene der Berggorillas entsprechen zu etwa 98 Prozent denen des Menschen. Die Menschenaffen leben in kleinen Gruppen mit einem männlichen Alphatier, dem sogenannten Silberrücken, sowie mehreren Weibchen und ihrem Nachwuchs aus verschiedenen Jahren. Seit rund zwei Jahrzehnten werden die Gorillas von Biologen des Max-Planck-Instituts in Leipzig beobachtet. Kein Wunder, dass die Tiere Namen tragen und alle bestens bekannt sind: Anführer Muzika beschützt sechs Weibchen, drei Jugendliche und zwei Neugeborene. Der kleinste Neuzugang ist ein Weibchen namens Nyakabara, auf das sich die ganze Aufmerksamkeit des Clans konzentriert. Auch der Mount Elgon im Osten des Landes bietet einmalige Geschichten. In den Höhlen des alten Vulkans scheint es zu spuken, nachts ereignen sich hier seltsame Dinge. In der völligen Finsternis sind merkwürdige Geräusche und Bewegungen zu hören. Haben die Elefanten etwas damit zu tun, deren Gruppen diese Region durchstreifen? Der Queen Elizabeth Park bietet ebenfalls Erstaunliches: Hier haben Mangustenfamilien und Warzenschweine zu einer Symbiose gefunden, die es nirgends sonst zu beobachten gibt. Von den riesigen Krokodilen an den Murchison Falls über die berühmtesten Bewohner des Kibale Nationalparks, den Schimpansen: Der Filmemacher Harald Pokieser hat die faszinierendsten Seiten dieses vielseitigen Landes in einmaligen Bildern festgehalten und erzählt die spannendsten Geschichten dieser Tierwelt atmosphärisch dicht, packend und anrührend. (Text: BR Fernsehen) Wildes Vietnam – Der tropische Süden
50 Min.Thung-Chai, so werden die traditionellen Rundboote der Fischer genannt.Bild: NDR/Doclights GmbH/Heike GrebeDer illegale Wildtierhandel ist ein großes Problem in Vietnam, selbst in den Nationalparks werden die Tiere illegal bejagt. Überall im Land weichen Naturräume neuen Hotels und Straßen. So stehen die Tiere im tropischen Süden Vietnams vor großen Herausforderungen. Wie sie diese meistern, welche Tiere den Kampf verlieren könnten, und welche Comebacks sich im Reich des Wassers abspielen, erzählt die letzte Folge des spektakulären Zweiteilers „Wildes Vietnam“. Im Süden Vietnams herrscht tropisches Klima mit deutlich üppigerer Vegetation als im Norden. Im Vietnam-Krieg wurde jedoch ein Großteil der Natur zerstört.Mittlerweile haben sich Pflanzen und Tiere ihr Reich zurückerobert. Die zweite Folge „Wildes Vietnam“ zeigt einige dieser Erfolgsgeschichten. Überquert man den Wolkenpass in der Mitte Vietnams, ist es, als betrete man ein anderes Land. Während im Norden raues, kühles Klima herrscht, ist der Süden ganzjährig tropisch warm. Unweit der Millionenstadt Ho-Chi-Minh City liegt ein letztes kleines Paradies. Umringt von landwirtschaftlichen Flächen schützt der Cat Tien Nationalpark den letzten intakten Flachlandregenwald Vietnams. Hier folgte das Team einer der verbliebenen 300 Südlichen Gelbwangen-Schopfgibbon-Familien in Vietnam. Es sind faszinierende Verhaltensstudien dieser seltenen Primaten gelungen, die zu den Hauptdarstellern des Films werden. Reist man vom Cat Tien Regenwald noch tiefer in den Süden Vietnams, trifft man unweigerlich auf Wasser. Der Mekong ist die Lebensader Südvietnams, das Mekongdelta ist das drittgrößte der Erde und war einst eine endlose Wasserwildnis. Heute wird hier mehrmals im Jahr Reis geerntet. Und auf den unzähligen Wasserwegen treiben die Vietnamesen regen Handel. In einem kleinen Schutzgebiet trafen die Kameraleute auf zwei junge Zwergotter, die im Wald eher unerwartete Beute jagten. Darüber hinaus erzählt der Naturfilm die Erfolgsgeschichte der seltenen Siam-Krokodile, die bereits als ausgestorben galten und nun dank strenger Schutzmaßnahmen die Feuchtgebiete am Mekong zurückerobern. Der illegale Wildtierhandel ist ein großes Problem in Vietnam, selbst in den Nationalparks werden die Tiere illegal bejagt. Der Tourismus explodiert förmlich in Vietnam. Jedes Jahr werden neue Übernachtungsrekorde gemeldet. Überall im Land weichen Naturräume neuen Hotels und Straßen. So stehen die Tiere im tropischen Süden Vietnams vor großen Herausforderungen. (Text: BR) Wildes Vietnam – Die Bergwälder des Nordens
45 Min.Vietnams Norden ist von dichten Bergregenwäldern geprägt.Bild: NDR/Doclights GmbHDieser Naturfilm zeigt neben den weltberühmten Kalksteinformationen der Halong-Bucht, der pulsierenden Hauptstadt Hanoi und dem dichten Dschungel-Nationalparks einige bisher nie gefilmte Arten und Verhaltensweisen der heimischen Tiere und es wird erklärt, warum das Land ein Hotspot der Biodiversität ist. Vietnam gehört zu einem der artenreichsten Länder der Erde, und doch ist über das Leben vieler Tiere dort bisher wenig bekannt. Ein Drittel aller Tiere Vietnams gibt es nur in diesem Land, sonst nirgendwo auf der Welt. Und immer wieder werden neue Arten entdeckt! Allein 90 neue Reptilienarten wurden in den letzten zwei Jahrzehnten beschrieben.Viele der Tiere leben allerdings nur an einem einzigen, eng begrenzten Ort. Um diese zu erreichen, waren einige aufwendige Expeditionen nötig. Lange Fußmärsche in die entlegensten Winkel der Bergregenwälder Nordvietnams und zahlreiche Stunden auf wackeligen Booten brachten das Kamerateam immer wieder an ihre Grenzen. Doch es sind einzigartige Aufnahmen entstanden, unter anderem von dem scheuen Fleckenroller oder der vom Aussterben bedrohten Krokodilschwanzechse. Ein besonderes Augenmerk legten die Filmemacher jedoch auf das Pangolin, ein Schuppentier. Diese Gattung ist das meistgewilderte Tier der Welt. Um deren Schicksal zu dokumentieren, suchte das Team nach einer Möglichkeit, Schuppentiere in Freiheit, aber auch in Gefangenschaft begleiten zu können. Schließlich stießen die Filmer auf die Organisation Save Vietnam’s Wildlife. Es sind Aufnahmen entstanden, die zuvor so noch nie zu sehen waren wie zum Beispiel die ersten Schritte eines frisch geborenen Pangolin-Babys. Welche Abenteuer das kleine Pangolin erlebt, was ein Fleckenroller mit Kaffee zu tun hat, und warum Cat-Ba-Languren nur auf einer einzigen Insel leben, das zeigt diese Universum-Dokumentation. (Text: BR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail