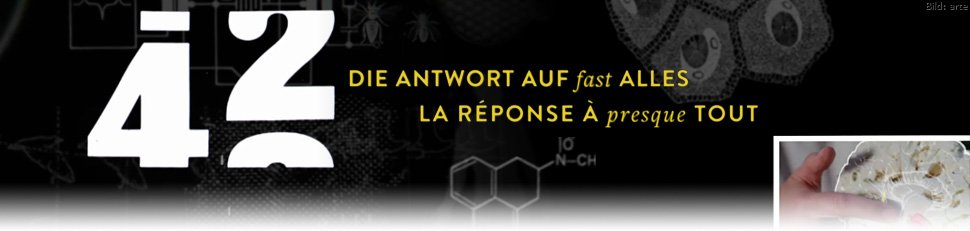2024/2025 (Folge 148–167)
Beherrscht uns das Mikrobiom?
Folge 148 (25 Min.)Es ist erstaunlich, wie viele Mikroben in uns leben – doch unsere Begegnung mit ihnen ist oft weniger angenehm. Täglich scheiden wir Millionen nützlicher Mikroben mit dem Stuhl aus. Allein im Darm können sich bis zu zwei Kilogramm Mikroben befinden. Doch nicht nur der Darm ist ihre Heimat: Mikroben besiedeln auch die Haut, die Nase und den Rachen. Fühlen sie sich in ihrer Umgebung wohl, vermehren sie sich und unterstützen dabei wichtige Körperfunktionen: Sie produzieren Vitamine, helfen bei der Verdauung, beeinflussen den Stoffwechsel, stärken das Immunsystem und wehren Krankheitserreger ab. Doch es gibt ein Problem: „Es ist durchaus möglich, dass gewisse Bakterien bereits ausgestorben sind“, sagt der Mikrobiologe Adrian Egli von der Universität Zürich.Auch wenn noch längst nicht alle Arten erforscht sind, zeigt sich bereits, dass der Verlust mikrobieller Vielfalt ernsthafte Folgen haben könnte: Ein Rückgang könnte mit der Entstehung von Krankheiten wie Asthma oder Depressionen zusammenhängen. „Das Darmmikrobiom ist der Hauptproduzent von Serotonin im Körper. Und das beeinflusst unsere Stimmung“, sagt Christina Warinner, Anthropologin an der Harvard University in Boston. Um die mikrobielle Vielfalt für die Zukunft zu bewahren, sichert der Microbiota Vault in der Schweiz Stuhlproben aus aller Welt. Sie werden eingefroren, um einzigartige Mikrobenarten zu erhalten. Können wir die verlorenen Mikroben wieder zurückgewinnen – und damit unsere Gesundheit stärken? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 17.01.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 16.02.2025 arte Warum ist Reichtum so ungerecht verteilt?
Folge 149 (27 Min.)Die einen fliegen für viele Millionen Dollar touristisch ins All oder feiern gigantische Hochzeiten – während die anderen noch immer in Slums von wenigen Dollar am Tag leben. Obwohl die Wirtschaft wächst wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, ist der erzeugte Wohlstand ziemlich ungleich verteilt. Warum ist das so? (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 24.01.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 23.02.2025 arte Was macht uns depressiv?
Folge 150 (25 Min.)Keine Kraft, keine Freude, keine Hoffnung. Jeder Fünfte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Depression. Doch obwohl die Krankheit so weit verbreitet ist, ist noch wenig über sie erforscht. Warum erkranken so viele Menschen? Was macht depressiv? Früher dachten Forschende, allein ein Botenstoff im Gehirn sei dafür verantwortlich. Inzwischen blickt die Wissenschaft anders auf die Krankheit – und entdeckt neue Wege, um sie zu heilen. Manche vermuten sogar, dass Depressionen einen verborgenen Sinn haben könnten. Welcher könnte das sein? (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 31.01.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 02.03.2025 arte Finden wir den perfekten Geheimcode?
Folge 151 (28 Min.)Dass unsere Daten verschlüsselt sind, wenn wir E-Mails abrufen, uns bei unseren Bankkonten anmelden, Nachrichten auf Messenger-Diensten verschicken oder im Internet surfen, verdanken wir der Kryptographie. Im Hintergrund tobt dabei ein Zweikampf: Die Kryptographen entwickeln sichere Geheimcodes, während die Codeknacker versuchen, diese Verschlüsselung zu brechen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich von der Antike, über Julius Cäsar, die Königshäuser im 17. Jahrhundert bis in unsere moderne Welt durchzieht, erklärt Cécile Pierrot (Inria Nancy).Je geschickter die Codeknacker agieren, desto ausgefeilter müssen die Verschlüsselungsverfahren werden. Unsere Daten heute sind dadurch gesichert, dass niemand die Verfahren knacken kann, die sie schützen. Zumindest noch nicht. Denn das Spiel könnte eine neue Wendung bekommen: Derzeit werden Quantencomputer entwickelt, die so ganz anders ticken als bisherige Rechner. Sollten sie eines Tages gut funktionieren, könnten sie unsere jetzige Verschlüsselung im Handumdrehen brechen – ein Sicherheitsrisiko für uns persönlich und die globale Gesellschaft. „Ohne Kryptographie wäre unsere heutige Welt nicht vorstellbar“, sagt Peter Schwabe vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre. Zusammen mit dem Mathematiker Eike Kiltz (Ruhr-Universität Bochum) entwickelt er neue Kryptographie-Verfahren. Doch ist es möglich einen Geheimcode zu finden, der sowohl den Angriffen heutiger Computer als auch denen der Quantencomputer von morgen standhalten kann? (Text: arte) Deutsche TV-Premiere So. 09.03.2025 arte Sind wir bereit für eine Weltregierung?
Folge 152 (28 Min.)Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geriet die Weltordnung des 21. Jahrhunderts ins Wanken. Die Vereinten Nationen, eigentlich als Schiedsrichter für globale Krisen gedacht, wirkten hilflos. „Die UNO wurde für die Krisen von gestern gebaut“, urteilt Ursula Schröder, Friedensforscherin an der Universität Hamburg. Doch was braucht es, um Herausforderungen wie Grenzkonflikte oder den Kampf gegen den Klimawandel zu bewältigen? „Etwas, das einer Weltregierung nahe kommt“, sagt Anthony Lang, Professor für Politikwissenschaft an der University of St.Andrews. Gleichzeitig warnt Lang vor der Gefahr, dass eine solche Regierung zu viel Macht in den Händen weniger konzentrieren könnte. Was könnte unsere heute so zerstrittene Welt dazu bringen, sich unter einer gemeinsamen Regierung zu vereinen? In der Science-Fiction-Welt von Star Trek entstand die Weltregierung der Erde nach dem Dritten Weltkrieg. „Die Menschheit lernt offensichtlich in allererster Linie durch Crashs und Katastrophen“, meint der deutsche Philosoph Richard David Precht. Kann die Menschheit auch ohne Katastrophen zusammenwachsen? Die Zukunftsforscherin Florence Gaub erinnert daran, dass die Weltgemeinschaft erst mit der Einführung global gültiger Zeitzonen entstand. Damals zwangen technische Errungenschaften wie die Telegraphie die Welt zu einem gemeinsamen Konsens. Könnte der technologische Fortschritt also auch heute der Schlüssel sein, um unsere Welt näher zusammenzubringen – vielleicht eines Tages sogar unter einer gemeinsamen Regierung? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 14.02.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 16.03.2025 arte Verschwenden wir Periodenblut?
Folge 153 (28 Min.)Jeden Monat landen weltweit mehr als 100 Millionen Liter im Müll oder im Abwasser: Menstruationsblut. Wir betrachten es als Abfall. Doch was, wenn wir uns irren? Für Forscherinnen und Forscher ist längst klar: Wir haben das Potenzial der Menstruationsflüssigkeit unterschätzt. Es könnte etwa bei der Diagnose von Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs und Endometriose helfen oder in Zukunft die Wundheilung verbessern. (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 21.02.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 23.03.2025 arte Können wir Zeit fühlen?
Folge 154 (25 Min.)Die Zeit ist eines der größten Rätsel unseres Lebens. Sie vergeht für alle gleich und doch erlebt sie jeder anders. Mal vergehen die Tage wie im Flug, mal scheint die Zeit still zu stehen. Wie kommt diese Wahrnehmung zustande? Und was passiert, wenn unser Zeitgefühl aus dem Takt gerät? In zum Teil extremen Experimenten kommt die Forschung diesen Phänomenen immer näher. Emotionen, besondere Erlebnisse, Isolation, Stress oder Erinnerungen scheinen unsere Wahrnehmung von Zeit zu verändern. Können wir dieses Wissen nutzen, um unser Zeitempfinden bewusst zu steuern – und so noch intensiver zu leben? (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 28.02.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 30.03.2025 arte Wie schafft Wasser Leben?
Folge 155 (29 Min.)Ist Wasser die universelle Wiege des Lebens?Bild: HR/mobyDOKUnser Blut, der Urin, Tränen, das Innere unserer Zellen: Bis zu etwa 70 Prozent bestehen Menschen aus Wasser, einer Flüssigkeit, die als Transportmedium, als Lösungsmittel und chemischer Reaktionspartner für uns unverzichtbar ist. Wasser ist so allgegenwärtig, dass uns normalerweise gar nicht auffällt, wie ungewöhnlich es ist: Mehr als 70 Anomalien haben Forschende inzwischen dingfest gemacht. Eigenschaften, bei denen sich Wasser ganz anders verhält als vergleichbare, kleine Moleküle. Wäre Wasser nicht so seltsam – es gäbe nicht nur kein Eis auf kalten Gewässern, es gäbe gar keine Meere und Flüsse und keinen Regen auf der Erde.Inwiefern also ist Wasser anders – warum kann es mit Leichtigkeit so viele dem Leben zuträgliche Funktionen übernehmen? Ist Wasser vielleicht sogar biophil, also: das Leben liebend? Und warum sieht man das gerade auf der Erde am deutlichsten – wo Wasser anders als an anderen bekannten Orten in drei verschiedenen Zuständen vorliegen kann. Wie sieht dieses „anders“ anderswo im Universum aus? Immerhin ist das Wasser eine der ältesten Verbindungen im Weltall und tatsächlich überall in gewaltigen Mengen zu finden. Müsste es dann nicht im gesamten Universum Leben geben? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 04.04.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 04.05.2025 arte Werden Menschen bald zu Cyborgs?
Folge 156 (29 Min.)Der Cyborg-Künstler Neil Harbisson ließ sich einen Chip in den Kopf implantieren, der Lichtwellen von Farben in Schallwellen umwandelt. Damit kann er nun „Farben hören“. Aufgrund eines Sehfehlers kann er sonst nur Schwarz-Weiß erkennen.Bild: BR/mobyDOK/Lars NorgaardWir Menschen sehen uns gerne als Krone der Schöpfung. Aber sind wir nicht eher eine – nun ja – Fehlkonstruktion? Je älter wir werden, desto „baufälliger“ werden wir. Streng genommen beginnt dieser Verfall schon kurz nach der Pubertät. Sobald sich unser Körper voll entwickelt hat, beginnt der Abbau. Irgendwie deprimierend, oder? Aber was wäre, wenn wir diese Konstruktionsfehler einfach durch Technik beheben könnten? Es gibt kaum ein Handicap, für das wir keine technische Lösung haben: Brillen, Hörgeräte, Arm- und Beinprothesen sind ganz selbstverständlich. Aber geht da vielleicht noch mehr? Könnten wir uns technisch nicht noch viel besser machen, als wir es heute sind? Weltweit wird an Gehirnchips, smarten Prothesen und künstlichen Organen geforscht.Sie lassen Querschnittsgelähmte mit Gedankenkraft Schach spielen, Amputierte mit Sensoren im Arm fühlen und Herzpatienten mit Herzmuskelzellen aus dem Labor länger leben. Wäre es denkbar, dass eines Tages auch gesunde Menschen von solchen Technologien profitieren? Transhumanisten sprechen davon, dass wir irgendwann den Menschen durch Technik überwinden, sagt Technikphilosophin Janina Loh. Wollen wir das wirklich? Und wer kann sich solche Technologien leisten? Man stelle sich vor, Superreiche versuchten, nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Oberstübchen zu optimieren. Halb Mensch, halb Maschine. Entsteht am Ende eine „neue biologische Kaste“? Oder werden wir zu Supermenschen? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 11.04.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 11.05.2025 arte Ist die Wahrheit noch zu retten?
Folge 157 (29 Min.)Manche Geschichten sind zu schön, um nicht wahr zu sein. Der Mensch zieht eine gute Geschichte der Wahrheit oft vor.Bild: BRSie ist umkämpft, umstritten und immer in Gefahr: die Wahrheit. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht vor Desinformation gewarnt wird – und doch sind wir alle grundsätzlich anfällig dafür, die Unwahrheit zu glauben, egal, wie sehr wir uns anstrengen. Und das liegt nicht daran, dass es so etwas wie Wahrheit gar nicht gibt, sagt Romy Jasper, Philosophin an der HU Berlin: Schließlich können wir bei der Frage „Ist der Mond aus Käse?“ durchaus sagen, welche Antwort wahr ist. Dass Menschen trotzdem an die Unwahrheit glauben, liegt daran, dass unser Gehirn evolutionär gesehen ganz andere Aufgaben hat, sagt der Neurowissenschaftler Philipp Sterzer von der Universität Basel.Er erklärt: Unsere Überzeugungen sollen uns in erster Linie beim Überleben helfen und uns vor teuren Fehlern bewahren. Ob sie der Wahrheit entsprechen, sei zweitrangig. Zum Beispiel, dass wir Gefahren sehen, wo keine sind. Oder – aus Gründen des sozialen Zusammenhalts – dass wir eher das glauben, was unsere soziale Gruppe für wahr hält. Tatsächlich gibt es viele solcher systematischen Fehleinschätzungen, sogenannte Biases. Das sind Verzerrungen in unserem Urteilsvermögen, die bei allen Menschen gleich funktionieren. Zum Beispiel der Confirmation Bias: Menschen glauben eher Aussagen, die zu ihren eigenen Überzeugungen passen. Und: Wir sind alle anfällig für eine gute Geschichte. Weil der Mensch sein ganzes Leben lang Ereignisse in Geschichten einordnet, sagt die Germanistin Petra Sammer, kann es leicht passieren, dass wir der Unwahrheit auf den Leim gehen, wenn sie in Form einer guten Geschichte daherkommt. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 18.04.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 18.05.2025 arte Können wir Süchte ausschalten?
Folge 158 (27 Min.)Dass unser Gehirn auf Drogen reagiert, ist kein Zufall: Sie stimulieren das Gehirn viel stärker als natürliche Reize wie Nahrung oder Sex.Bild: NDR/ARTEEine Welt ohne Sucht – das klingt so realistisch wie der Bau einer Metropole auf dem Mars. Besonders harte Drogen mit starkem Suchtdruck, wie das Schmerzmittel Fentanyl, führen bei vielen Betroffenen zu Rückfällen. Die Suchthistorikerin Helena Barop ordnet ein, wie die zunehmende Verfügbarkeit und die gesellschaftliche Präsenz von Drogen zu einer süchtigen Gesellschaft beitragen. Der Neurowissenschaftler Colin Haile von der Universität Houston will das Problem an der Wurzel packen und Sucht verhindern, bevor sie entstehen kann. Er forscht an einer Anti-Fentanyl-Impfung. Diese soll dafür sorgen, dass Fentanyl im Körper nicht mehr wirkt. Doch warum werden wir überhaupt süchtig? Das liegt vor allem daran, dass das Belohnungssystem im Gehirn darauf ausgelegt ist, auf bestimmte Reize anzusprechen – Drogen docken häufig genau dort an, wo auch körpereigene Stoffe wirken.„Es ist so, dass Drogen letztendlich das System kidnappen“, erklärt der Psychopharmakologe Rainer Spanagel. Trotz gleicher Anatomie ist die individuelle Suchtanfälligkeit sehr unterschiedlich. Der Genetiker Markus Hengstschläger von der Universität Wien zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit und Geschwindigkeit einer Suchtentwicklung durch ein Zusammenspiel von Genetik und Umwelt bestimmt wird. Aber was wäre, wenn wir jede Form von Sucht beseitigen könnten – und damit auch jeden Rausch? Wollen wir das überhaupt? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 25.04.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 25.05.2025 arte Sind wir zu neugierig?
Folge 159 (27 Min.)Experimente zeigen: Aus Neugier sind wir bereit, Schmerzen zu ertragen, nur um Unsicherheiten zu beseitigen.Bild: NDR/ArteNeugier ist eine der Triebfedern menschlicher Entwicklung. Und dennoch gilt es nicht unbedingt als positive Eigenschaft, ihr ständig nachzugeben. Doch was ist Neugier überhaupt? Woher kommt ihr ambivalentes Image? Medienmacher und Internet-Algorithmen wissen längst, wie sie die ständige Suche nach Neuem immer wieder füttern können. Gibt es daraus einen Ausweg? Sind die Menschen vielleicht zu neugierig? (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 02.05.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 01.06.2025 arte Wie sahen die Dinosaurier wirklich aus?
Folge 160 (27 Min.)Kein Film hat unser Bild von den Dinosauriern so geprägt wie „Jurassic Park“. Aber entspricht diese Darstellung überhaupt der Wahrheit?Steven Spielbergs Blockbuster (1993) ist inzwischen über 30 Jahre alt. Inzwischen hatte die Paläontologie viel Zeit, neue Erkenntnisse nachzuliefern. Aber wie findet man etwas über Tiere heraus, die vor über 65 Millionen Jahren ausgestorben sind? (Text: arte.tv) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 09.05.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 08.06.2025 arte Können wir Viren überlisten?
Folge 161 (28 Min.)Die meisten Viren „wollen“ dem Menschen nicht schaden. Sie nützen ihm sogar. Sie regulieren Bakterien in den Ozeanen und beschleunigen die Evolution. „Viren sind Meister der Evolution“, sagt der Evolutionsbiologe Morgan Gaia. Trotzdem sind Viren und Menschen nicht die besten Freunde – sie dringen in unsere Zellen ein, missbrauchen sie und machen uns krank. „Die nächste Pandemie ist nur eine Frage der Zeit“, sagt die Infektiologin Marylyn Addo. Können wir nicht schneller sein und die Viren überlisten, bevor sie uns schaden? Der Virusökologe Daniel Streicker arbeitet an einem Impfstoff, der sich unter Fledermäusen selbst verbreitet.So kämen die Viren erst gar nicht zum Menschen. Eine andere Idee: ein Universalimpfstoff, der uns gleich gegen mehrere Virenstämme schützt. Vogel- oder Schweinegrippe könnten uns dann nichts mehr anhaben. Das Problem: Das dauert. Deshalb suchen Forscherinnen und Forscher weiter nach neuen und alten Viren. Die Krankheitsökologin Barbara Han will den Viren einen Schritt voraus sein. Mit Hilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz versucht sie mit ihrem Team, Infektionsherde vorherzusagen, bevor sie entstehen. Könnte man so den nächsten Ausbruch verhindern? (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Mo. 19.05.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 15.06.2025 arte Wo beginnt der Wahnsinn?
Folge 162 (28 Min.)Zwischen dem, was uns an dem „Verrückten“ fasziniert oder verängstigt, liegt ein schmaler Grat. Aber wer oder was trifft eigentlich diese Entscheidung? Kann man überhaupt mit Sicherheit sagen, was als „verrückt“ und was als „normal“ gilt? Es ist schließlich kein Geheimnis, dass alle Menschen unterschiedlich ticken. Und wo verläuft schließlich die Grenze zum Wahnsinn? (Text: arte.tv)Deutsche Streaming-Premiere Fr. 23.05.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 22.06.2025 arte Sollten wir uns öfter langweilen?
Folge 163 (29 Min.)Vor der Corona-Pandemie beschäftigten sich nur wenige Forschende weltweit mit Langeweile. Erst während des Lockdowns kam die Wissenschaft in Schwung. Als alle zu Hause bleiben mussten, wurde deutlich, wie sehr Menschen unter Langeweile leiden können und welche Auswirkungen dies haben kann. Die Reaktionen reichten von Frustration über Wut bis hin zu Ohnmacht. Dafür ist jedoch nicht die Langeweile verantwortlich, sagt der kanadische Forscher James Danckert. Langeweile sei weder gut noch schlecht, sondern ein Signal, dem wir gut zuhören sollten. Sie zeigt uns, dass wir uns in einer Situation befinden, die nicht gut für uns ist und in der wir etwas ändern sollten.Wer sich an seine Schulzeit erinnert, weiß, dass das manchmal leichter gesagt als getan ist. Aber auch hierfür haben Forschende Tipps parat. Über diesen unerträglichen Zustand, wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können und die Zeit quälend langsam verrinnt, ist noch überraschend wenig bekannt. Warum fühlt sich Langeweile so schrecklich an? Und was passiert im Körper? Dies sind Fragen, auf die die Forschenden nach und nach Antworten finden. So hat beispielsweise der französische Neurowissenschaftler Thomas Andrillon entdeckt, wie Langeweile die Gedanken wandern lassen kann. Das kann überraschende Auswirkungen haben. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Di. 10.06.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 29.06.2025 arte Welche Macht hat Desinformation?
Folge 164 (29 Min.)Am sogenannten Mittelozeanischen Rücken bildet sich neuer Meeresboden – etwa so, wie bei einer Rolltreppe Elemente aus dem Boden fahren.Bild: BR/mobyDOKFotografien, Videos und Nachrichten galten lange als verlässliche Quellen. Doch mit der rasanten Entwicklung der Künstlichen Intelligenz und ihren Möglichkeiten verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fälschung immer stärker. Deepfakes und computergenerierte Stimmen lassen Aussagen entstehen, die nie getroffen wurden. Bilder werden manipuliert, Fakten verdreht, Informationen gezielt platziert. Ein Klima des Misstrauens entsteht, in dem alles wahr sein kann – oder auch nicht. Gezielte Falschinformationen sind kein neues Phänomen. Schon in der Vergangenheit wurden sie als politische Waffe eingesetzt, um Meinungen zu beeinflussen und Gesellschaften zu spalten. Doch moderne Technologien machen die Manipulation noch raffinierter.Bot-Netzwerke verbreiten Desinformation in sozialen Medien, Algorithmen verstärken Emotionen und sorgen für maximale Reichweite. Die Grenzen zwischen seriösen Nachrichten und Propaganda verschwimmen – mit Folgen für demokratische Systeme. Doch es gibt Wege, sich gegen Manipulation zu wappnen. Medienkompetenz, kritisches Denken und faktenbasierte Berichterstattung sind essenziell, um Täuschungen zu erkennen. Strategien wie Prebunking, also das frühzeitige Erkennen von Mustern der Desinformation, können helfen, weniger anfällig für Falschinformationen zu sein. In einer Welt, in der nicht alles, was echt aussieht, auch echt ist, wird ein geschulter Blick zum wichtigsten Mittel gegen gezielte Manipulation. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 06.06.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 06.07.2025 arte Warum gehen Zivilisationen unter?
Folge 165 (29 Min.)Bild: ArteZivilisationen wie das alte Rom, das mongolische, assyrische oder persische Großreich, die Inka und Maya beherrschten auf den Höhepunkten ihrer Macht oft große Teile der ihnen bekannten Welt, schienen fast unangreifbar. Doch heute ist von vielen dieser einstigen Großmächte nicht viel mehr übrig als Artefakte hinter Museumsglas und Ruinen unter Lianen oder Wüstensand. Wie konnte es so weit kommen? Über die Jahrhunderte wurden viele unterschiedliche Erklärungen für den Untergang von Zivilisationen gefunden. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppen sich viele von ihnen eher als Spiegel der Sorgen der Zeit, in der sie entstanden.Unterstellen wir den Römern moralische Dekadenz, weil wir uns um unsere eigene Gesellschaft sorgen? Erzählen wir deshalb weiterhin von rücksichtsloser Umweltzerstörung durch die Maya oder auf der Osterinsel, obwohl die Forschung das heute in Frage stellt? Dennoch lassen sich in den Geschichten vom Untergang durchaus spannende Muster und wiederkehrende Motive finden. Und gleichzeitig zeigen viele dieser Geschichten, dass der „Untergang“ vielleicht weniger absolut ist, als es das Wort vermuten lässt, und dass Geschichten vom Kollaps gleichzeitig auch oft Geschichten vom Überdauern, Weitermachen, Wiederaufbau sind. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 13.06.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 13.07.2025 arte Sollten wir mehr streiten?
Folge 166 (27 Min.)Streit bedeutet Stress: Wenn wir mit Meinungen konfrontiert werden, die unseren eigenen widersprechen, schalten wir oft in den Flucht- oder Angriffsmodus.Bild: ARTENicht jeder Streit muss weltbewegend sein, aber oft fühlt er sich so an. Auch, wenn es nur um die Frage geht, ob Ananas auf die Pizza darf. Schon verlieren wir die Fassung und gehen in den Angriffs- oder Fluchtmodus. Warum ist das so? Die Forschung zeigt, dass wir gar nicht anders können: Streit stresst uns. Schon der kleinste Widerspruch kann unser Streitzentrum im Gehirn in Alarmbereitschaft versetzen, weiß Tali Sharot, Neurowissenschaftlerin an der University of London. Allerdings ist das nicht nur schlecht: „Gefühle im Streit sind ein Kompass, um zu erkennen, was uns wirklich wichtig ist“, erklärt Psychologe Rune Miram von der Universität der Bundeswehr in München.Denn hinter kleinen Streitigkeiten im Alltag stecken oft tiefergehende Probleme. Um genau diese zu lösen, betont Hugo Mercier, Kognitionswissenschaftler am Pariser École normale supérieure, dass Streit für uns Menschen schon immer wichtig war. Denn nur so konnten wir Regeln für das Zusammenleben in der Gemeinschaft festlegen. Und ist auch die Demokratie am Ende nicht vor allem ein Regelwerk, um konstruktiv streiten zu können? Caja Thimm, Medienwissenschaftlerin an der Uni Bonn, warnt deshalb vor den Gefahren, wenn unsere Streitkultur, besonders im Internet, immer weiter verroht – wenn wir nur noch in den Austausch kommen, um uns gegenseitig zu beleidigen. Eine gute Lösung für die drängenden Fragen der Gegenwart finden wir eher, wenn wir viele Perspektiven und Argumente kennen. Herausfinden können wir das allerdings nur, wenn wir miteinander streiten. Und zwar richtig. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 20.06.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 20.07.2025 arte Wie viel Mathematik steckt im Universum?
Folge 167 (29 Min.)Mathematik gilt vielen als abstraktes Schulfach – trocken, schwierig, weltfremd. Doch was, wenn sie in Wahrheit die verborgene Ordnung hinter allem ist? Mathematik ist verblüffend präsent in unserem Alltag: Sie steckt in den Blättern und Blüten von Pflanzen. Selbst Bienen – das zeigt die neueste Forschung – haben so etwas wie einen Sinn für Mathematik. Pflanzen etwa orientieren sich häufig an der sogenannten Fibonacci-Folge – einer Zahlenreihe, die entsteht, indem man immer wieder die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen addiert. Der Pflanzenbiologe David Spencer zeigt anhand von Sonnenblumen und Romanesco, wie sich aus einfachen mathematischen Regeln faszinierende Muster ergeben. Selbst Insekten scheinen ein Gespür für Mathematik zu haben: Die Verhaltensforscherin Aurore Avarguès-Weber hat in Experimenten mit Bienen gezeigt, dass diese nicht nur Mengen unterscheiden, sondern sogar einfache Rechenaufgaben lösen können.Doch ist Mathematik wirklich die Sprache der Natur – oder nur ein Werkzeug des Menschen? Für die Mathematikerin Sarah Hart ist klar: Mathematik und ihre Formeln sind ein Schlüssel zu den Vorgängen im Universum. Der Physiker und Computerpionier Stephen Wolfram geht noch einen Schritt weiter: Er entwirft das kühne Bild eines Universums, das selbst wie ein gigantisches Rechenprogramm funktioniert – gesteuert durch einfache Regeln, die wir gerade erst beginnen zu verstehen. (Text: arte) Deutsche Streaming-Premiere Fr. 11.07.2025 arte.tv Deutsche TV-Premiere So. 27.07.2025 arte
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu 42 – Die Antwort auf fast alles direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu 42 – Die Antwort auf fast alles und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail