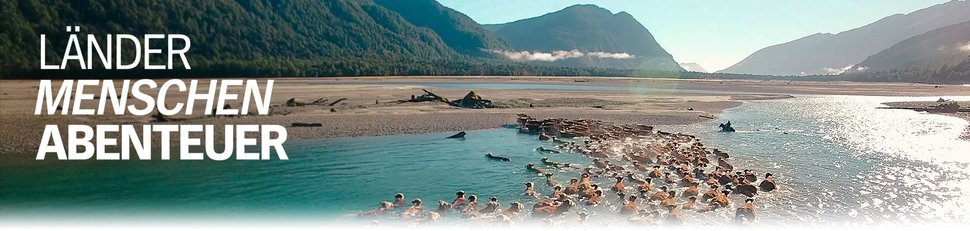1783 Folgen erfasst, Seite 7
Argentinien – Im Land der Gauchos – Viehhüter in Argentinien
Die Provinz Corrientes ist ein wilder und unberührter Landstrich am Rande des zweitgrößten Sumpfgebietes der Welt. Rund 1.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt gibt es riesige Rinderfarmen. Ein Filmteam begleitet die Gauchos bei der Arbeit und zeigt ihr einfaches Leben in jahrhundertealten Traditionen, die heute noch lebendig sind. Etwa 1.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt liegt im Norden Argentiniens ein wilder und unberührter Landstrich: die Provinz Corrientes mit ihren beeindruckenden, riesigen Rinderfarmen am Rande des zweitgrößten Sumpfgebiets der Welt. In den Esteros del Iberá sind nicht nur Gauchos und Rinder zu Hause, es ist auch die Heimat einer einzigartigen Tierwelt.Mitten in dieser rauen Landschaft, die von Wasser, Lagunen und grünen Grasbüscheln durchzogen ist, liegt die Estancia „San Juan Poriahu“. Diese traditionelle Rinderfarm, nahe der Grenze zu Paraguay und Brasilien, wurde bereits 1635 von den Jesuiten gegründet. Seit fünf Generationen ist San Juan Poriahu in Familienbesitz. Marcos Rams, der Patron, hat seinen Großvater schon vor 30 Jahren abgelöst. 4.000 Rinder und über 200 Pferde gehören zu seiner Estancia. Das Farmgelände erstreckt sich über 30 Kilometer. Die Arbeit der Gauchos beginnt im Morgengrauen, und auch der Patron packt mit an: Kälber kastrieren, bei den Jungtieren Brandzeichen und Ohren markieren, Wunden behandeln, junge Pferde zureiten. Und mittags ist die Siesta. Dann gibt es koffeinhaltigen Matetee, das Nationalgetränk Argentiniens, und einen deftigen Eintopf mit Rindfleisch. Die Kleidung der Gauchos im Norden Argentiniens ist sehr traditionell. Über den weiten Hosen, den Bombachas, werden bunte Stofftücher kunstvoll mit Lederriemen befestigt. In Corrientes ist man besonders stolz auf den Chamamé, den traditionellen Tanz, auch correntinische Polka genannt. Er stammt von den Guarani, später haben Jesuiten, Spanier und deutsche Auswanderer die Musik beeinflusst. Am Wochenende treffen sich Jung und Alt und natürlich die Gaucho-Gemeinde auf den Chamamé-Partys. Vieles hat sich in den vergangenen 30 Jahren zwar auch in diesem Landstrich verändert, aber die Begeisterung für Pferde, die Natur und das einfache Leben auf dem Land sind geblieben. Es gibt noch die Gauchos und ihre jahrhundertealten Traditionen, davon konnte sich das Filmteam überzeugen, als es die Gauchos begleitet hat auf ihrem stundenlangen Ritt nach Hause, beim Piranha-Fischen oder beim traditionellen Fleischgrillen, dem Asado. (Text: BR Fernsehen) Argentinien – Mission Urwald
Außer in der Hauptstadt Buenos Aires leben besonders viele Enkel der ersten Migranten in der Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens, geprägt durch Urwald, Flüsse und Wasserfälle wie den Iguazu, der zu den Weltwundern der Natur zählt. Miguel Tazi, Enkel italienischer Einwanderer, hat den Urwald zu seinem Arbeitsplatz gemacht. Jahrzehntelang fuhr er die Ambulanz, die Kranke und Schwangere aus den Indianer-Dörfern holte. „Viele Kinder wurden unterwegs in meinem Auto geboren“, erzählt er. Heute fährt er Touristen im Schlauchboot zu gewaltigen Wasserfällen, die wenig bekannt sind.„Die Einwanderung hat in Argentinien eine Situation geschaffen, die einzigartig ist in der Welt und in der Geschichte“, meint Rodolfo Zagert, ein bekannter Maler, der mit der roten Erde seiner Heimatregion Misiones malt. „Wir haben die verschiedenen Kulturen und Religionen integriert.“ Und für Chango Spasiuk, den weltberühmten argentinischen Akkordeonspieler mit ukrainischen Wurzeln, ist die Verschiedenheit ein Schatz, aus der er seine Musik schöpft. (Text: rbb) Arizona – Grand Canyon Nationalpark
Der Grand Canyon ist eines der größten Naturwunder auf unserem Planeten. Doch während die meisten Touristen nur wenige Tage im Nationalpark bleiben, ist er für etliche Menschen zum Lebensraum geworden. Der Grand Canyon gehört zu den größten Naturwundern. Der ehemalige amerikanische Präsident Teddy Roosevelt nannte ihn den „einzigen Ort, den jeder Amerikaner einmal gesehen haben sollte.“ Tatsächlich ist der Grand Canyon heute der meistbesuchte Nationalpark der USA. Doch während die meisten Touristen nur wenige Tage im Nationalpark bleiben, ist er für etliche Menschen zum Lebensraum geworden. Kim Blatsch tauschte den Job in der Fabrik gegen den auf dem Rücken eines Maultiers und führt seitdem Reitergruppen durch die Schlucht.Biologe Brandon Holton verfolgt die Spur des Pumas, des letzten verbliebenen großen Raubtiers im Grand Canyon. Aber auch Geologen, Feuerwehrleute und Bootsführer bei Wildwasserfahrten leben von und mit dem einzigartigen Nationalpark. Viel besser als alle Zugezogenen kennen sich aber die Ureinwohner des Parks in dem unwegsamen Gelände aus. Die Hualapai-Indianer besiedeln die Gegend schon seit Jahrhunderten und haben im Tourismus eine neue Einnahmequelle entdeckt. So veranstalten die Indianer heute Wildwassertouren auf dem Colorado River am Westrand der Schlucht und führen Touristen auf den Skywalk, eine gläserne Aussichtsplattform, von der sich ein spektakulärer Blick in die Tiefe werfen lässt. (Text: BR Fernsehen) Arjeplog – Lappland zwischen Eis und Hightech
Lappland – unweigerlich denkt man an Seen, Wälder, Kälte und Einsamkeit. Doch in dem kleinen Städtchen Arjeplog passiert im Winter Ungewöhnliches. Autotester aus aller Welt kommen mit Pkws und Lkws in die Abgeschiedenheit des Nordens, um ihre Neuentwicklungen – „Erlkönige“ – zu testen. Die Einwohner von Arjeplog leben dann nur noch von und für die Autotester. Sie präparieren viele Kilometer Eispisten auf den zugefrorenen Seen und versorgen die Tester rund um die Uhr. Der Film schildert das Leben in Arjeplog aus der Perspektive der „Eismacherin“ Åse, die mit ihrem Vater die Eispisten präpariert und inzwischen mit einem deutschen Testingenieur verheiratet ist. (Text: hr-fernsehen)Armor und Argoat – Land am Meer – Land am Wald: Bretagne
Deutsche TV-Premiere Mi. 03.03.1993 S3 von Rainer SchirraDie Aromunen – Stolze Griechen mit eigener Sprache
Beim Treffen der aromunischen Griechen, die sich Vlachen nennen, kommen im Norden Griechenlands alljährlich fast 200 Menschen zu einem großen Fest zusammen. Ein Filmteam war im Sommer 2018 dabei und konnte erleben, wie die aromunische Minderheit versucht, ihre Sprache und Kultur zu bewahren. Wie kann das funktionieren, wenn eine Sprache nicht schriftgestützt ist? In welcher Zwickmühle befindet sich eine „Minderheit“, die sich als Minderheit nicht begreifen will aus Sorge, dass ihr Traditionserhalt politisch missbraucht werden kann? (Text: BR Fernsehen)Arrat – Abschied von der Steinzeit
Deutsche TV-Premiere Sa. 24.01.1981 S3 von Eugen R. EssigAserbaidschan – Im Land des schwarzen Goldes
45 Min.Seidentücher aus der Seidenfabrik in Sheki. Die Traditionstücher wurden in die UNESCO Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.Bild: NDR/ARTE/TELLUX-Film GmbH/Till L / NDR Presse und InformationAserbaidschan liegt in einer Region, deren Schönheit schon von Marco Polo gepriesen wurde: von den spektakulären Bergen des Kaukasusgebirges über die weiten Steppen der transkaukasischen Ebene bis zu den Stränden des Kaspischen Meeres. Genauso bemerkenswert: der Reichtum unter der Erdoberfläche. Das sogenannte schwarze Gold sorgt seit der Antike für Reichtum. Gulnura Bagirova und Babek Suleymanov wollen heiraten, typisch aserbaidschanisch mit ganz großem Brimborium. Das Wichtigste an diesem Tag: Fotos und Videos. Dafür wurde ein halbes Dutzend Profis gebucht. Das Paar lässt sich diesen Tag im „engsten Familienkreis“ rund 15.000 Euro kosten. Direkt an der Hauptstraße nach Baku liegt die Tandirofen-Bäckerei von Leyla Subhajeva.Das Besondere: Die 52-Jährige beschäftigt nur Frauen. Kein Problem in Aserbaidschan: Laut Gesetz sind Frauen den Männern gleichgestellt. Khan Muhammed Hassans um 1797 erbaute Sommerresidenz in Sheki ist UNESCO-Weltkulturerbe, vor allem wegen ihrer Fenster, Shebeke genannt. Kunstwerke aus edlen Hölzern und kleinen bunten Muranoglasscheiben. Gleich neben dem Palast liegt die Glaswerkstatt von Familie Rasulov. Bei den Palastsanierungsarbeiten haben Vater und Sohn mehrere Jahre mitgearbeitet. Die Seidenfabrik von Sheki wurde 1931 gegründet, damals war sie die größte in der gesamten Sowjetunion. Natella Movsumova hat 1985 in der Fabrik angefangen und die Privatisierung miterlebt. Heute ist sie verantwortlich für das Qualitätsmanagement und auch für die berühmten Seidentücher. Das Öl-Sanatorium Sefa in Naftalan ist das ganze Jahr über ausgebucht. Für Selbstzahler. Krankenkassen übernehmen den Kuraufenthalt nicht. Jaxya Quliyev nimmt sein erstes Bad im Rohöl. Er hat schlimme Bandscheibenprobleme, seit er zu DDR-Zeiten in Gotha als Kanonier der Roten Armee stationiert war. Aserbaidschan, ein Land, das noch vom sowjetischen Erbe geprägt ist, sich jetzt aber auf der Suche nach einer neuen Identität zwischen Tradition und Moderne befindet. (Text: NDR) Asien – Geheimnisvolle Metropolen: Benares
Benares – auch als Varanasi bekannt – wird als heilige Stadt verehrt. Wer dort stirbt, unterbricht den Kreislauf der Wiedergeburt und geht direkt in die Ewigkeit ein. Aus allen Teilen Indiens bringen Menschen die Leichname ihrer Verwandten in die Stadt, um sie dort zu verbrennen. Aber auch Hindus, die ihr Ende nahe fühlen, kommen hierher und erwarten in Hospizen geduldig ihren Tod. Benares, das auch den Beinamen „großes Krematorium“ führt, beherbergt inmitten der Stadt am Ufer des heiligen Ganges die Verbrennungsstätte „Manikarnika Ghat“. Dort werden Hunderte von Leichen verbrannt, und die heilige Flamme erlöscht niemals. (Text: hr-fernsehen)Asien – Geheimnisvolle Metropolen: Isfahan
Isfahan liegt im felsigen Hochland des Iran. Mit ihren prunkvollen Moscheen, dem großen Bazar und dem Gassenlabyrinth spiegelt die Metropole auch heute noch den Glanz des früheren persischen Reichs wider. Auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehen die königliche Moschee Majed-e-Imam mit ihren blauen Kacheln und der königliche Palast Ali Qapu, an deren Aussehen die Zeit spurlos vorübergegangen zu sein scheint. In den engen Straßen arbeiten Handwerker, die die Kultur Persiens bewahren: Gold- und Silberschmiede, Elfenbeinschnitzer und Teppichknüpfer. (Text: hr-fernsehen)Asien – Geheimnisvolle Metropolen: Jogjakarta
Jogjakarta, im Herzen von Java gelegen, ist eines der letzten Königreiche Asiens. Zum ersten Mal wurde das Leben im Palast des Sultans Hamengkubuwono X. filmisch dokumentiert. Bei den Bewohnern von Jogjakarta dreht sich alles um den Sultan, den sie als Gott und Vaterfigur verehren. Für die Menschen in der Stadt ist es eine Auszeichnung, für den Herrscher als Hoftänzer, königliche Diener, Musiker, Puppenspieler und Handwerker arbeiten zu dürfen. Der Hofstaat hält die uralten Traditionen Jogjakartas am Leben. (Text: BR Fernsehen)Asien – Geheimnisvolle Metropolen: Peking
Im Mittelpunkt der Sendereihe „Geheimnisvolle Metropolen“ stehen die Menschen, die einen Einblick in die Kulturgeschichte des jeweiligen Landes geben. Erzählt werden sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit – auf der Suche nach den Geheimnissen, die diese Metropolen umgeben. Traditionen und Zeremonien, die die Zeit überdauert haben, zeigen die verborgenen Seiten der asiatischen Städte. Computeranimationen rekonstruieren die mystischen Stätten. So erklärt sich die zeitlose Anziehungskraft der großen Metropolen Asiens. (Text: hr-fernsehen)Athen per Taxi
Über Athen ist schon viel berichtet worden: Von der Akropolis bis Zappeion oder Zentralmarkt. Und wer sich den Alltag, das Leben in der griechischen Hauptstadt vorstellt, denkt an Smog, Stau, sengende Sonne und Sonnenglut. Aber die Metropole am Mittelmeer ist mehr – Athen lebt durch seine Kontraste: Antike trifft auf Moderne, die Inselwelt verbindet sich hier mit dem Festland, Menschen aller Landesteile kommen in Athen zusammen. Jeder vierte Grieche lebt in der Stadt, um hier sein Glück zu suchen. Als Besucher zumindest kann man es schnell finden: In der Gastfreundschaft und der Gelassenheit der Athener. ‚Geduld, Geduld‘, das charakterisiert die Lebensart der Athener, von der wir uns gern eine Scheibe abschneiden könnten, findet Eva Böhme, die seit dreißig Jahren mit einem Griechen in Athen verheiratet ist.Die Pfälzerin produziert in Attika Wein, der mit dem herben Retsina nichts zu tun hat. Wer weiß eigentlich, dass die Wiege des europäischen Rebenanbaus in Griechenland steht? Und wer würde nicht gern einmal in eines der nobelsten Hotels dieser Welt, das Grande Bretagne, hineinschauen? In der Königlichen Suite bleibt kein Wunsch offen. Die Türen zu diesem Luxus öffnen sich sonst nur wenigen … Wenn Griechen Geld haben, zeigen sie es meist auch. George Vernicos, zum Beispiel, besitzt einen Yachthafen voller Schiffe, mit denen auch der ehemalige US-Präsident George Bush schon durch die Ägäis segelte. Vernicos läßt uns in sein Privatleben blicken und philosophiert über Erfolg – ganz wie die alten Griechen. Gerade die waren nicht immer so kultiviert wie wir es heute glauben. Der deutsche Archäologe Stefan Brenne weiß ein Lied davon zu singen: Auf einer antiken Stimmscherbe, dem altertümlichen Stimmzettel, fand er den Kommentar ähnlich dem heutigen ‚Fuck You‘, was beweist, dass sich der Sprachgebrauch innerhalb mehrerer tausend Jahre gar nicht viel verändert hat. (Text: Tagesschau24) Auca (1): Erinnerung an ein tapferes Volk
Deutsche TV-Premiere Mo. 15.10.1990 S3 von Eugen R. EssigAuca (2): Sing nicht das Lied vom Tod
Deutsche TV-Premiere Mo. 22.10.1990 S3 von Eugen R. EssigAuf Achse nach Kathmandu (1): Zwischen Bosporus und Belutschistan
Deutsche TV-Premiere Sa. 26.10.1985 S3 von Bruno SchneiderAuf Achse nach Kathmandu (2): Zwischen der pakistanischen Wüste und dem Dach der Welt
Deutsche TV-Premiere Sa. 02.11.1985 S3 von Bruno SchneiderDer Aufbruch der Kaiowá – Eine Indianergeschichte aus Brasilien
Luciano und seiner Familie geht es wie den anderen Kaiowá-Indianern. Ihr Reservat bei der südbrasilianischen Stadt Dourados ist viel zu klein, sie können sich nicht mehr selbst versorgen, sind auf die Lebensmittelspenden des Staates angewiesen. Von den Weißen fühlen sie sich wie Tiere behandelt. Sie können nicht mehr auf die Jagd gehen oder ihre bewährten Heilkräuter sammeln, und Luciano muss befürchten, dass seine Kinder – wie viele Jugendliche – eines Tages Selbstmord begehen, weil sie sich zwischen der eigenen und der „weißen“ Kultur nicht mehr zurechtfinden. Da fassen Luciano und seine Frau Eva einen Entschluss: Sie brechen zusammen mit den Kindern auf in das etwa sechzig Kilometer entfernte Lima Campo, wo ihre Verwandten auf altem Indianerland – weiter weg von der weißen Zivilisation – ein neues Dorf gegründet haben.Nach einem turbulenten Umzug mit einem Bus ohne Zulassung und einem Fahrer ohne Führerschein werden sie in dem neuen Dorf willkommen geheißen. Gemeinsam wollen sie den abgeholzten Wald aufforsten und wieder ganz wie Indianer leben. Lima Campo ist zwar als Indianerland markiert, aber noch nicht offiziell anerkannt. Die Kaiowá werden ihre Ansprüche gegen die weißen Farmer, die das Land heute besitzen, verteidigen müssen – mit ungleichen Waffen. „Die Farmer benutzen Revolver und Gewehre. Wir haben nur Pfeil und Bogen und die Worte, die wir aus dem Mund schleudern“, sagt der alte Kaiowá Ignacio. (Text: hr-fernsehen) Auf dem Dach der Welt
Reißende Flüsse, tiefe Schluchten, schneebedeckte Bergriesen und weite Wüsten – der Pamir. „Dach der Welt“ nannte Marco Polo eines der höchsten, wildesten und am wenigsten erforschten Gebirge der Welt. Seit 75 Jahren hatte kein westlicher Wissenschaftler diese Region bereist. Jetzt startete wieder eine Expedition deutscher Botaniker und Zoologen. Ihr Ziel: die Wüsten des Pamir zu erforschen – auf über 4.000 Metern Höhe. Filmautor Jan Kerckhoff begleitet die Wissenschaftler auf ihrer 3.000 Kilometer langen Fahrt – durch reißende Bäche, über steinige Gebirge und extrem trockene Hochebenen. Dabei interessiert vor allem eine Frage: Wie kann die Wüste aufgehalten und die einzigartige Natur erhalten werden? Im Pamir leben äußerst seltene Tiere wie der Schneeleopard oder das Marco-Polo-Schaf, das größte Wildschaf der Welt. Zugleich ist der Ostpamir Lebensraum für die letzten als Nomaden lebenden Kirgisen. (Text: hr-fernsehen)Auf dem Ob durch Russland – Mit dem Schiff nach Novosibirsk
45 Min.Sibirien hat viele Gesichter. Aber das als unwirtlich beschriebene Land wird selten verbunden mit einem der bedeutendsten Opernhäuser Russlands, mit reichen Öl- und Gasregionen, Luxus und Wohlstand. Und auch die Wissenschaft muss den Vergleich mit westlichen Forschungseinrichtungen nicht scheuen. Die Reise auf dem Ob an Bord eines Schiffes beginnt in Salechard. Hier holen Öl- und Gasarbeiter den Reichtum Sibiriens aus dem Boden. Die Arbeiter kommen aus dem 3.000 Kilometer entfernten Wolgograd oder aus Weißrussland.Sie leben zwei Monate lang in engen Bauwaggons, bevor es wieder nach Hause geht. Man verdient hier besser, erzählen sie. Und irgendwie muss die Eigentumswohnung ja abbezahlt werden. Inzwischen ist man aber auch in Russland überzeugt, dass die Umwelt geschützt werden muss. Seit zehn Jahren gibt es eine staatliche Naturaufsicht, die Ölverschmutzungen und lecke Leitungen mithilfe von Helikopterkameras aufspürt und die Verursacher zur Kasse bittet. Dass Westsibirien reich ist, sieht man auch in Chanty-Mansijsk. Hier hat der Gazprom-Konzern ein futuristisches Gebäude errichten lassen, eine Schach-Akademie für Kinder. Schon Sechsjährige spielen hier Schach, es ist ein Unterrichtsfach in der Schule wie Mathematik und Englisch. Der sechsjährige Kirill hat schon im Kindergarten angefangen, Schach zu spielen. Seine Eltern sind zufrieden, seit der Sohn Schach spielt, ist er nicht mehr so zapplig und kann besser denken. An Bord des Schiffes sind Deutsche auf Expeditionsreise. Edeltraud steht schon seit Stunden an der Reling und blickt in die Weite. Die Berlinerin hat sich einst in einen russischen Offizier verliebt, traf sich mit ihm in Potsdam und Fürstenwalde. Doch als das ruchbar wurde, galt deutsch-sowjetische Freundschaft nichts mehr. Er wurde nach Sibirien geschickt, sie habe nie wieder etwas von ihm gehört, sagt sie. Verbannung nach Sibirien ist kein Phänomen der Sowjetzeit. Schon unter dem Zaren wurden Missliebige wie der Schriftsteller Dostojewskij dorthin verfrachtet. Das Schiff hält in Berjosovo, einem Städtchen mit einer schönen golden glänzenden Kirche. Fürst Menschikow, Günstling von Peter dem Großen, fiel nach dessen Tod in Ungnade und wurde nach Berjosovo verbannt. Er ließ die Kirche errichten. An der Spitze ein Engel, der dem Engel auf der St. Petersburger Peter-und Paul-Festung nachgebildet ist. Ausdruck der Sehnsucht des Fürsten nach der Zivilisation, in die er nie zurückkehren durfte. Er starb in Berjosovo. Regelmäßig zündet Galina Maslakova eine Kerze in der Menschikow-Kirche zum Gedenken an ihre Großeltern an, die in den 1930er-Jahren in den verschlafenen Ort verbannt wurden. Sie schrieben an Stalin und Molotow, erzählt sie, aber rehabilitiert wurden sie erst in den 1990er-Jahren. Das Schiff landet in Tomsk an: Das Filmteam wird von vielen Russen angesprochen. Sie haben in der DDR gedient, in Wünsdorf, Fürstenwalde und Neuruppin. Schön sei es gewesen und so sauber, schwärmen sie. Und manchmal hatte diese Freundschaft unerwartete Folgen. Irinas Mann war in Neuruppin als russischer Offizier stationiert. Sie freundete sich mit Klaus und Hannelore an, die die Speisegaststätte in Neuruppin führten. Als sie mit ihrem Mann in den turbulenten 1990er-Jahren nach Russland zurückkehrte, hielt die Freundschaft: Irina eröffnete ein kleines Restaurant, Klaus half mit Rezepten und Ratschlägen, Besteck und Geschirr. Seitdem gibt es in Tomsk das Klaus Cafe. Das Foto des Neuruppiners hat einen Ehrenplatz in der stets gut besuchten Gaststätte. Bienenstich und Mohnkuchen nach Neuruppiner Rezept finden reißenden Absatz unter den Tomsker Bürgerinnen und Bürgern. Das Schiff kehrt an den Unterlauf des Ob zurück in die Stadt Nowosibirsk, drittgrößte Stadt Russlands. Mächtige Brücken überspannen dort den Fluss. Am Ufer des gestauten Ob liegt Akademgorodok, ein Zentrum der Wissenschaft. Hier wurden schon in den 1950er-Jahren Getreidesorten entwickelt, die im kurzen sibirischen Sommer reifen. Berühmtberüchtigt wurde das Städtchen Ende der 1990er-Jahre, als renommierte Physiker ins Ausland gingen und ihr Wissen auch in sogenannten Schurkenstaaten vermarkteten, weil der russische Staat ihre Löhne nicht mehr zahlte. Eine Erklärung für den Erfolg des iranischen Atomprogramms habe mit dem Exodus der sibirischen Wissenschaftler zu tun, heißt es hier, aber diese Zeiten sind vorbei. Inzwischen werden die Institute wieder gut ausgestattet. Margarita Romanenko ist Mikrobiologin und hat eine acht Monate alte Tochter. Trotz Elternzeit betreut sie die Studierenden weiter. Ihr Mann hilft und räumt freimütig ein, er sei eine Ausnahme. Die meisten russischen Männer finden, Kinder seien Frauensache oder die der Großmütter. Tänzerin und Primaballerina, Olga Grischenkova lacht. Sie habe sich nie zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen, erzählt sie und dass sie schon sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter wieder auf der Bühne stand. Das große Opern- und Balletttheater Nowosibirsk braucht den Vergleich mit Moskau und St. Petersburg nicht scheuen. Die Zukunft kann also kommen. Für Russland liegt sie in den entlegenen Weiten Sibiriens. Das haben übrigens schon die Zaren so gesehen. (Text: NDR) Auf dem Polarkreis unterwegs (1): Von Point Hope zum Bärensee
In einem Geisterdorf im äußersten Nordwesten Alaskas beginnt der erste Teil der Abenteuertour, die Grimme-Preisträger Klaus Scherer und sein Team zunächst bis tief ins arktische Kanada führt. Vom Frühling in der Tundra reist er an die Polarmeerküste in die ersten Schneestürme. Mit den Inuit-Eskimos, die seit Jahrtausenden im Einklang mit dem so unwirtlichen Eismeer leben, feiert Scherer das Walfangfest. Ebenso wie den Gwich’in-Indianern verfällt er dem Bann des Porcupine-Flusses und zieht mit den letzten Nomaden der Arktis durch traumhafte Landschaften.Zusammen mit Buschpilotinnen überfliegt Scherer Gebirge, deren Gipfel keinen Namen tragen, und trifft den einsamsten Grenzwächter Amerikas sowie einen verschlossenen Hüter der eiszeitlichen Kleinvulkane, die von den Ureinwohnern „Pingos“ genannt werden. Der Film unternimmt eine Zeitreise und führt durch die sich wie im Zeitraffer verändernde Alltagswelt der Inuit. Seit langem droht den eskimoischen Volksgruppen das gleiche Schicksal wie den Eisbären, denn ihre Heimat, die auch sie als Jäger stets ernährt hat, schmilzt buchstäblich dahin. (Text: hr-fernsehen) Auf dem Polarkreis unterwegs (2): Vom Bärensee nach Tasiilaq
Der zweite Teil seiner Abenteuerreise durch die Arktis führt Klaus Scherer durch den Norden Kanadas, über die Baffininsel bis zur Ostküste von Grönland. In diesen Gebieten findet man zottelige Moschusochsen in der Tundra, Eisbären auf Küstenfelsen, wilde Gräber verschollener Entdecker. Scherer und sein Kamerateam treffen auf weitere Inuit-Stämme, einen passionierten Ochsenzähler und einen lange verleugneten Enkel des Seefahrers Roald Amundsen. Sie besuchen Kinder in der Schule, die dort wieder die Bearbeitung von Rentierfellen erlernen, und Eskimo-Familien, deren Alltag sich wie im Zeitraffer verändert. Auf dem Hundeschlitten überquert das Filmteam Pässe und an der Seite von Hubschrauberpiloten Buchten voller Eisberge.Die Arktisbewohner machen sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam: Den Eisbären an Land fehlen inzwischen drei jagdreiche Wochen auf dem Packeis, das später gefriert und eher schmilzt als früher. Eine Inuit-Aktivistin nennt die bedrohte Arktis ein Barometer für das Schicksal der gesamten Erde. Die Schlussetappe der Reise beendet Scherer im grönländischen Tasiilaq, wo die Gletscher des Inlandeises auf die Gebirge der Küste treffen und Eislochfischer die Fjorde bevölkern. Nur wenige Stunden Tageslicht blieben dem Team dort, um zu drehen. Gerade dort aber hüllte die tiefstehende Polarsonne die Häuser in das geheimnisvollste Licht der Reise. (Text: hr-fernsehen) Auf dem Rücken der Pferde – Steppenreiter in Kirgistan
„Vor sechs Jahren bin ich zum ersten Mal nach Kirgistan gereist. Und seither lebe ich fast immer hier.“, sagt die französische Pferdenärrin Jacqueline Ripart. „In diesem Land habe ich meine Mission gefunden: Ich will das kirgisische ‚Urpferd‘ wiederfinden, das ausgestorbene Steppenpferd der Nomaden.“ Wann immer die 54-jährige ehemalige Sportreiterin aus Aix-en-Provence hört, dass irgendwo Bauern oder Nomaden viele Pferde besitzen, sucht sie diese Leute auf. Denn einer von ihnen könnte noch Exemplare der Rasse haben, mit der Dschingis Khan einst Zentralasien eroberte. (Text: SWR)Auf den Spuren der Wikinger
Der erfahrene Weltumsegler Henryk Wlonski und seine siebenköpfige Mannschaft unternehmen einen Törn der besonderen Art: eine Schiffsfahrt in die Vergangenheit. Die Männer wollen eine alte Wikingerroute neu erkunden. Ausgangspunkt ihrer Expedition ist Polens Hafenstadt Danzig. Dort wird die „Welet“, der originalgetreue Nachbau eines Wikingerschiffs, ablegen und Kurs auf Odessa nehmen. Insgesamt beträgt die Strecke zwischen Ostsee und dem Schwarzen Meer 2.500 Kilometer – eine Reise übers Meer und durch Flüsse, für die die gefürchteten Seemänner aus dem Norden einst fast zwei Jahre brauchten. Die „Welet“ hingegen will ihr Ziel schon in drei Monaten erreichen.Die Filmautorin Malgorzata Bucka begleitet den polnischen Kapitän und seine Mannschaft bei der abenteuerlichen Fahrt. Die Route der Wikinger zwischen Danzig und Odessa soll unter möglichst ursprünglichen Bedingungen erkundet werden. Immer wieder muss die Mannschaft der „Welet“ ihre Muskelkraft einsetzen, jeden Tag wird mindestens fünf Stunden gerudert. Beinahe täglich stoßen die Männer an ihre körperlichen Grenzen und auf Hindernisse. So setzt das Boot immer wieder auf flachem Grund auf. Gesprungene Planken und gefährlich tief hängende Fährseile sind hierbei nur kleinere Übel. Die erste große Herausforderung wartet an der Landesgrenze zur Ukraine: In Przemysl muss das Boot über Land auf den Fluss Dnjestr übergesetzt werden. Statt nach Wikingerart Holzrollen und Zugvieh zu gebrauchen, wird hierfür ein Kran eingesetzt – eine schwierige Operation, da sich das Boot mit Wasser vollgesogen und enorm an Gewicht zugelegt hat. Doch damit nicht genug – am Grenzübergang werden die Segler dann plötzlich mit sehr neuzeitlichen Problemen konfrontiert: Wlonski soll eine Kaution von mehreren tausend Dollar hinterlegen. Kann er nicht zahlen, ist die Reise hier zu Ende. (Text: hr-fernsehen) Auf den Spuren von Dschingis Khan – Von der Mongolei ins Herz Sibiriens
Deutsche TV-Premiere So. 19.10.2003 Südwest Fernsehen von H. Jürgen Grundmann
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail