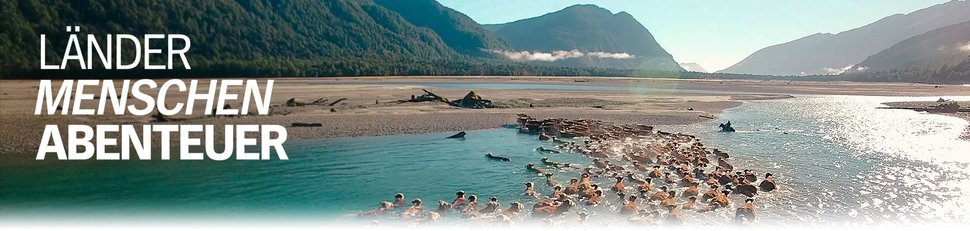1783 Folgen erfasst, Seite 17
Einmal Pazifik und zurück
Der Pazifik ist der größte und tiefste Ozean der Erde, regelmäßig wird er von den heftigsten Stürmen heimgesucht. Unter diesen Umständen ist eine Reise über 15.000 Kilometer, quer durch den Pazifik, ein enormes Unterfangen. Solche riesigen Strecken sind normalerweise Albatrossen und Buckelwalen vorbehalten. Doch eine kleine Schildkröte schlägt sie alle: die Unechte Karettschildkröte. (Text: SWR)Einmal quer durch Südafrika
Von Kapstadt geht es über die Weinberge des sogenannten Franzosenecks zum höchsten Bungee-Brückensprung der Welt bis ganz in den Nordosten Südafrikas in die Wildnis von Sabi Sand. Man muss mutig sein, wenn man am Kap der Guten Hoffnung tauchen geht, denn der Weiße Hai liebt die südafrikanischen Gewässer. Nicola Stelluto, der Haiflüsterer vom Kap, stimmt die Touristen darauf ein. Von Kapstadt geht es über die Weinberge des sogenannten Franzosenecks zum höchsten Bungee-Brückensprung der Welt bis ganz in den Nordosten Südafrikas in die Wildnis von Sabi Sand. Die Reise führt rund 2.500 Kilometer durch unglaubliche Landschaften, durch das Tal der Trostlosigkeit, das an den Grand Canyon erinnert, und durch die mächtigen Drachenberge mit ihren uralten Wandmalereien, die von Wesen aus einer anderen Welt zu stammen scheinen.Die Geschichte Südafrikas ist auch eine Geschichte des Kolonialismus’, darauf stößt man bei einer Reise quer durch Südafrika immer wieder. So etwa liegt in Isandlawana das Schlachtfeld, auf dem die Zulus im Jahr 1879 britische Soldaten vernichtend geschlagen haben. Doch am Ende siegten die weißen Siedler und die Geschichte der Apartheid begann. Erst 1994 wurde sie beendet, aber für die jüngere Generation ist sie heute kein großes Thema mehr. Sie schaut nicht im Groll zurück, sondern optimistisch nach vorne. „Wenn wir Afrikaner Erfolg haben wollen“, sagt der Modedesigner Floyd Avenue, „müssen wir zusammenarbeiten, egal ob schwarz oder weiß.“ (Text: BR Fernsehen) Einsam im Atlantik – Die Färöer Inseln
Die Färöer Inseln liegen mitten im Nordatlantik, zwischen den britischen Inseln und Island. 50.000 Menschen leben auf den 18 Inseln. Es ist ein besonderer Menschenschlag, der Wind und Kälte trotzt. Die Natur ist atemberaubend, aber eben auch sehr hart. Clas Oliver Richter und sein Team wollen erfahren, was es heißt, auf den Färöern zu leben. Mitten im Nordatlantik liegen die Färöer: 50.000 Menschen leben auf den 18 Inseln, pflegen ihre Traditionen und ihre Sprache, das Färingisch. Die Färinger sagen über sich selbst, dass sie glücklich sind. Die Einsamkeit scheint sie nicht zu stören. ARD-Skandinavien-Korrespondent Clas Oliver Richter und sein Team wollen herausfinden, warum die Menschen auf den Färöern so glücklich sind – und wie sie ihren Alltag bewältigen.Der Polizist Lars zum Beispiel ist einer der Färinger, die nirgendwo anders leben wollen. Es gibt kaum Verbrechen auf den Inseln, deshalb kann er sich seiner Leidenschaft widmen: Fußballspiele zu pfeifen. Das Filmteam besucht mit ihm ein Meisterschaftsspiel und trifft dort Adeshima Lawal aus Afrika. Durch einen Spielertransfer ist er in dieser kühlen Inselwelt im Nordatlantik gelandet. Julia Kavalid hat lange im Ausland gelebt, bis sie das Heimweh packte. Die Filmemacherin kehrte zurück auf die Inseln und versucht nun, auf den Färöern Filme zu produzieren. Inzwischen sind viele Inseln durch Tunnel verbunden. Die Insel Stora Dimun jedoch ist nur mit dem Helikopter zu erreichen oder mit der Fähre, insgesamt nur zwei Familien leben dort. In der Hauptstadt Torshavn ist das einzige Restaurant auf den Färöern, das sich einen Michelin-Stern erkocht hat: das Koks. Eine der Spezialitäten: Gammelfleisch. Schaffleisch, das durch den Verwesungsprozess haltbar gemacht wurde und einen ganz zarten Geschmack hat. Auch wenn sich die Färöer immer wieder mit der EU über Fangrechte streiten, die Fischerei ist nach wie vor von großer Bedeutung für die Inseln, auch in dem kleinen Dorf Eidi. (Text: BR Fernsehen) Einsam im Eismeer – Mit dem Schlauchboot Kurs 80 Grad Nord
Deutsche TV-Premiere Mi. 25.12.1985 S3 von Georg FeiglEinsatz in Alaska – Auf Streife in der Wildnis
Sie schützen Tiere und Natur. Vor allem in der Jagdsaison sind die Alaska Wildlife-Troopers immer wieder Alarmbereitschaft. Dann ist die ungewöhnliche Polizeitruppe ständig auf Patrouille in Wäldern und Meeresbuchten. Daniel Valentine (39) und seine Kollegen sind auf dem Kodiak-Archipel stationiert. Die Inselgruppe südwestlich von Anchorage verfügt über einzigartige Landschaften, wild und unzugänglich, und ist ein beliebtes Freizeitgebiet für Jäger und Angler. Alan Jones ist der einzige Pilot der Truppe.Sein Einsatzgebiet erstreckt sich über 300 Kilometer, eine Landfläche fast so groß wie Schleswig-Holstein. Meistens weiß er nicht, was ihn an den abgelegenen Orten erwartet. Illegale Jagdbeute, aggressive Jäger, verängstigte Jungtiere? Seinem Kollegen Shane Nicholson geht es nicht anders. Was wird er bei der toten Bärenmutter vorfinden? Wurde sie erschossen? Wo sind die Jungtiere geblieben? Die Polizisten greifen hart durch, wenn Jagdgesetze überschritten oder Fischereibestimmungen missachtet werden. Wen sie erwischen, dem drohen bis zu 10.000 Dollar Bußgeld und bis zu einem Jahr Gefängnis. Wenn jedoch Roy Rastopsoff jagt, gelten andere Gesetze. Er gehört zu den Aleuten, den Ureinwohnern, und genießt daher Sonderrechte. Für seine Familie darf er sogar Seehunde erlegen, was anderen nicht erlaubt ist. Insgesamt leben 13.000 Menschen auf dem Kodiak-Archipel. Einige von ihnen werden von Elise Pletnikoff medizinisch versorgt. Die Ärztin arbeitet im Krankenhaus der Stadt Kodiak, Verwaltungssitz der gleichnamigen Insel. Aber manchmal ist die 31-Jährige auch mit dem Flugzeug unterwegs zu ihren Patienten. Einmal im Monat hat sie Sprechstunde für die 225 Einwohner von Old Harbor. Elise Pletnikoff ist dann auf sich allein gestellt. Einen Facharzt oder einen Operationssaal in der Nähe gibt es nicht. Im Notfall müssen die Patienten in die Klinik geflogen werden. Die meisten Bewohner auf Kodiak Island leben vom Fischfang oder vom Tourismus. Aber manche sind auch Lebenskünstler wie Sherri Ewing. Sie betreibt einen Cateringservice und ein Outdoorrestaurant. Als sie vor 20 Jahren vom Bundesstaat Wisconsin auf die Insel zog, hat sie als Köchin in einem Bärenjägercamp angeheuert. Inzwischen tritt sie sogar in einer eigenen Fernsehkochshow auf. Filmemacher Christian Pietscher zeigt in seiner Dokumentation einzigartige Landschaften und ungewöhnliche Menschen. Sie alle können sich nicht vorstellen, das Inselarchipel jemals zu verlassen. Alaskas Wildnis und das ungewöhnliche Leben auf Kodiak Island lässt sie nicht mehr los. (Text: NDR) Eisbärenalarm an der Hudson Bay – Eine Stadt im Ausnahmezustand
Hinter jeder Tür steht ein geladenes Gewehr. In allen Autos steckt der Schlüssel. Kinder werden unter Bewachung zur Schule gebracht. Schilder warnen: Nicht weitergehen: Eisbären! Das nur tausend Einwohner zählende kanadische Städtchen Churchill liegt auf der Wanderroute der Eisbären. Den Sommer über haben die größten Landraubtiere der Erde nur wenig zwischen die Zähne bekommen. Jetzt warten sie darauf, dass die Hudson Bay zufriert und sie auf den Eisschollen wieder Robben jagen können. Bis es so weit ist und weil es aus den Restaurants von Churchill verheißungsvoll nach Fleisch und Donuts duftet, finden die Eisbären, sie könnten ein bisschen mitessen.Unerwartete Begegnungen sind also an der Tagesordnung. Doch die Menschen in Churchill haben gelernt, mit den Bären zu leben: Jeder, der rausgeht, wirft erst einmal einen vorsichtigen Blick in den Vorgarten oder um die Ecke. Taucht ein Bär im Ort auf, kennt jedes Kind die Eisbärennotrufnummer. Bären, die sich in die Stadt vorgewagt haben, werden betäubt und ins „Eisbärengefängnis“ gebracht. Bis zu vierzig Tiere können dort untergebracht werden. Sobald die Hudson Bay zufriert, werden die Tiere dann netterweise per Helikopter aufs Eis geflogen, ein Service, der die Provinz Manitoba eine Menge Geld kostet, doch die Bären sind geschützt und ziehen auch eine Menge begeisterter Besucher an. Das Filmteam von Rita Knobel-Ulrich fuhr mit der Eisbärenpatrouille mit, war dabei, wenn vorwitzige Bären ins Eisbärengefängnis eingeliefert wurden, besuchte die Schule von Churchill, wo jedes Kind weiß, was man tut, wenn ein Eisbär um die Ecke biegt, war in der Tundra, wo in vergitterten Wagenburgen verzückte Touristen Eisbären in freier Wildbahn fotografieren, und hat sich in einer Hütte umgetan, die von einem Bären gründlich zerlegt wurde. (Text: hr-fernsehen) Eisbären als Nachbarn – Mit Kind und Kegel in die Arktis
Für ein Jahr zog sich die norwegische Familie Aasheim-Amundsen in eine leerstehende Jagdhütte in die Arktis zurück. Vater, Mutter und zwei halbwüchsige Töchter verlebten auf einem abgelegenen Eiland der Inselgruppe von Spitzbergen eine aufregende Zeit, die manchmal aber auch sehr lang werden konnte: Für Aufregung sorgten die Besuche von Eisbären, von denen einer sogar bis ins Haus gelangte. Für eher eintönige Tage sorgte der arktische Winter, in dem monatelange Dunkelheit herrscht, weil die Sonne den Horizont nicht überschreitet.Ein Jahr lang musste sich die Familie selbst versorgen – mit Fleisch, mit Fisch, mit frischem Wasser. Im Gepäck hatten die Aussteiger auf Zeit ihre Videoausrüstung, mit der sie das ganze Jahr dokumentierten – das Vertreiben der Eisbären, das Erlegen von Robben, den Tod eines Schlittenhund-Welpen, die Eisstürme, das Weihnachtsfest, die Geburtstage der Töchter, den Wechsel der Jahreszeiten und die grandiose Landschaft. Es war offenbar ein sehr schönes Jahr, denn als der Abschied nahte, rollten auch ein paar Tränen … (Text: WDR) Eisdiamanten – Frostige Schatzsuche in Kanadas Norden
Schwere Trucks kämpfen sich durch eine Eiswüste im äußersten Norden Kanadas. Hier, in den Northwest Territories, gibt es längst keine Straßen mehr und keine Schienen. Die einzige Landverbindung besteht aus „Ice Roads“, gefrorenen Seen. Wenn das Eis mindestens 1,04 Meter dick ist, fahren die Lkw in Viererkonvois los, von Yellowknife immer Richtung Norden. Die Fahrer haben Proviant für mehrere Tage dabei, falls sie in einen Schneesturm geraten. Das Ziel ist die Mine Diavik. Hier wird mit unglaublichem Aufwand ein ganz besonderer Bodenschatz gewonnen, ein Schatz im wahrsten Sinne des Wortes: Diamanten. Erst seit gut 20 Jahren ist überhaupt bekannt, dass sich im Niemandsland im nördlichen Kanada Diamanten in so großer Menge finden, dass der Abbau lohnt, auch wenn der Aufwand unglaublich ist.Die kanadischen Diamanten sind von größter Reinheit und gelten als „saubere“ Diamanten, im Unterschied zu afrikanischen Blutdiamanten. Ein Filmteam begleitet die Trucker auf ihrem Weg über die Ice Roads, die Inuit, die als Minenarbeiter angeheuert haben und die gigantischen Kipplaster im ebenso riesigen Tagebaukrater fahren, die Geologen und auch einen Trapper, der ganz allein die endlosen Wälder durchstreift – auf der Suche nach dem nächsten großen Vorkommen von Eisdiamanten in den Northwest Territories. (Text: NDR) Die Eisenbahn vom Baikal zum Amur
Die „Baikal-Amur-Magistrale“, kurz BAM genannt, war das letzte große Prestige- und Propaganda-Projekt der Sowjetunion. Sie verbindet neben der Transsibirischen Eisenbahn als zweite transkontinentale Trasse das östliche Europa über den Baikalsee mit dem Pazifik. Ihr „Büro“ rollt auf Schienen zwischen Baikalsee und Pazifik, über Dauerfrostboden und vergletscherte Gebirgszüge, durch endlose Sümpfe und Rentierweiden: Sergej Kuplenski und Gennadi Laptjew sind Chefinspektoren auf der Baikal-Amur-Magistrale, deren Gleise sich 4.000 Kilometer quer durch Sibirien ziehen. Ganze dreißig Jahre dauerte ihr Bau, und neben der Trasse wuchsen Städte und Siedlungen, die nur durch die Bahn mit der Zivilisation verbunden sind. Der Film zeigt das Leben entlang eines der größten und schwierigsten Einsenbahnprojekte der vergangenen hundert Jahre. (Text: hr-fernsehen)Das eiserne Kamel – Mauretaniens Nomaden und der Wüstenzug
Der Eisenerzzug im Norden Mauretaniens, der täglich viermal die Minen bei Zouerat mit dem Verladehafen in Nouadhibou verbindet, ist mit über 2,5 Kilometern einer der längsten Züge der Erde, und er hat in den 35 Jahren seit der Eröffnung der Strecke ein ganzes Land verändert: Auf einem Gebiet von der Größe Baden-Württembergs, wo vor 1963 ungefähr 10.000 Menschen als Nomaden mehr schlecht als recht lebten, sind entlang der Eisenbahnlinie mitten in der Sahara Dörfer, künstliche Oasen und Städte entstanden. Allein in „Boomtown“ Zouerat leben heute mehr als 50.000 Menschen, und alle leben sie mit und von der S.N.I.M., der Betreibergesellschaft des Zuges und der Minen.Der Zug transportiert das Wasser für die gesamte Region, er schafft Arbeit, und er transportiert neben dem Eisenerz auch die Menschen – kurz: er ist die einzige Lebensader im Norden Mauretaniens. „Das eiserne Kamel“ lässt ein völlig neues Bild des Wüstenstaates Mauretanien entstehen. Er zeigt eindrucksvolle Bilder eines dröhnenden Ungetüms, das die Kamelkarawanen ersetzt hat und Leben dort ermöglicht, wo früher keines war. (Text: hr-fernsehen) Deutsche TV-Premiere Mi. 21.10.1998 Südwest Fernsehen von Michael Mattig-Gerlach und Michel WeberDie Eisfischer vom Baikalsee
Es ist März: Der Baikalsee ist eine bizarre Landschaft aus Eis und Schnee. Ein kleiner Konvoi, bestehend aus einem Quad, einem Kleinbus und einem Lkw, fährt vorsichtig übers Eis. Erst vor zwei Tagen ist hier ein Lkw mit kompletter Ladung im Eis versunken – obwohl es um diese Jahreszeit einen Meter dick ist. Der Expeditionsleiter Igor Chanajew ist Biologe am Limnologischen Institut der Russischen Akademie. Er will den Baikal-Omul, einen endemischen Fisch, auf seine Gesundheit untersuchen. Dazu verbindet der Russe Igor seine Studien mit einem leidenschaftlichen Abenteuer: dem Eistauchen.Er ist einer von wenigen Russen, die sich aufgrund ihrer Erfahrung unter die Eisplatten wagen – ohne Orientierung ist jeder Weg zurück versperrt. Regelmäßig besucht Igor diese Unterwasserwelt, um Veränderungen im See feststellen zu können. Auf den Felsen unter Wasser wachsen korallenförmige Schwämme – hoch effektive Wasserfilter, die über eventuelle Verschmutzungen Aufschluss geben. Auch diese findet man an keinem anderen Ort der Erde. Die geschätzten 1,5 Millionen Omule im Baikalsee sind nach den aktuellen Studien nicht bedroht. Sie leben in großen Tiefen, die Selbstreinigungskraft des Sees ist ihr Garant fürs Überleben. Die Fischer rund um den See angeln zum Eigenbedarf, lediglich auf den Märkten der Region kann man den Fisch kaufen, ein Geheimtipp für Besucher aus ganz Russland. Reich werden die Menschen am Baikalsee durch den Fisch nicht, doch können sie sich ein Leben ohne „ihren“ Baikalsee und „ihren“ Omul nicht vorstellen. Wie ist es aus Sicht der Forscher um die Zukunft des Omuls bestellt? (Text: NDR) Der eisige Weg – Expedition nach Zanskar/Ladakh
- Alternativtitel: Der eisige Weg nach Zanskar
Sieben Monate im Jahr ist Zanskar, ein Distrikt der Provinz Ladakh, von der Außenwelt abgeschnitten. Die Pässe, die in diesen dünn besiedelten Landstrich im Transhimalaya führen, sind verschneit. Im Januar und Februar, wenn der Zanskar-River zugefroren ist, gibt es die Möglichkeit, einige Dörfer über diesen Fluss zu erreichen. Ein Team des Hessischen Rundfunks wagte das Abenteuer einer Winterexpedition, um das Leben der Mönche im Kloster Lingshed im Winter zu dokumentieren. Seit 500 Jahren leben hier ständig sechzig Mönche und zwanzig Novizen, durchdrungen vom Buddhismus.Der Film zeigt sowohl das Abenteuer des Expeditions-Teams während der jeweils einwöchigen Tour auf dem Zanskar-River bei Temperaturen von bis zu minus 30 Grad, als auch das entbehrungsreiche Leben der Mönche im Kloster Lingshed. Ein Höhepunkt der Dokumentation ist das Portrait des mit 87 Jahren ältesten Mönchs von Lingshed, der seit 75 Jahren im Kloster lebt. Der eisige Weg zum Kloster Lingshed in Zanskar ist eine Herausforderung unter extremen Bedingungen für das Fernsehteam und seine Technik. (Text: hr-fernsehen) Eisige Welten – Naturwunder im Nordosten Kanadas
45 Min.Die Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours wurde zur Pilgerstätte für Seeleute, die im Alten Hafen von Montreal ankamen. Sie brachten der Jungfrau Maria aus Dankbarkeit für ihre „gute Hilfe“ für sichere Seereisen Opfer dar.Bild: NDR/Peter MoersDie Winter in Kanadas Provinz Québec sind die längsten und kältesten in Nordamerika. Für diese Dokumentation über die extremen Winter in Kanada haben die Filmemacher bei den First Nations, das sind indigene Völker, in der Wildnis der Wälder und in den eisigen Weiten am Polarkreis gelebt. Von der dicht besiedelten Region um Montreal herum bis nach Puvirnituq am Polarkreis reicht die größte kanadische Provinz Québec. Französisch ist hier die wichtigste Amtssprache. Im Winter herrschen in Québec von November bis März Temperaturen zwischen minus 20 und minus 40 Grad und lassen den mächtigen Sankt-Lorenz-Strom zufrieren.Es ist Hauptsaison für die Kanumannschaft von Sophie Asselin. Zusammen mit 55 Teams tritt sie ab Anfang Februar immer wieder zu Eiskanu-Rennen an. Der Film begleitet sie beim harten Training und zum Turnier nach Québec-Ville. Nördlich der Provinz-Hauptstadt beginnt die Taiga. Sie ist Heimat von Wildtieren wie Karibus und Wölfen. Jean-Luc Kanapé ist Innu und gehört zur Cree Nation. Er versteht sich als Hüter der Karibus. Ihre ehemals riesigen Herden werden immer kleiner. Das liegt vor allem an den Menschen und nicht an den Wölfen. Um das zu beweisen, will er im tiefen Schnee den Leitwolf festsetzen und ihm einen Peilsender anlegen. Ein echter Québécois geht zum Volksfest der Kleinen Fische. Seit vielen Generationen ist es Tradition, mit der ganzen Familie in gemütlichen Hütten im Eis zu angeln. Sinken die Hütten ein, hilft Jacques: mit Traktor, Motorsäge und Schlitten wird ruckzuck ein neuer Hüttenplatz gezaubert. Im Norden Québecs wächst weder Baum noch Strauch. Im Winter sieht die Region Nunavut nach lebensfeindlicher Eiswüste aus. Doch es ist der Lebensraum der Innuit, die die karge Tundra das „Land, in dem es sich leben lässt“ nennen. Ihre ehemals verstreuten Iglus sind längst wohlig warmen Häusern gewichen, die in Siedlungen wie Purvinituq oder Ivujivik zusammenstehen. Hierhin führen keine Straßen. Im Winter werden die Siedlungen aus der Luft versorgt. Melissa Hanley ist die erste Innuit-Pilotin ihrer Airline und eine dieser Eisflieger, die auch in der langen, stürmischen Polarnacht den Nachschub an Medikamenten und Lebensmitteln sicherstellt. Die Filmemacher Peter Moers und Edward Porembny haben für diese Dokumentation nicht nur die Überlebenstechniken des Karibuhüters kennengelernt und in der kalten Heimat der Eispilotin gelebt, sondern suchten in der Wildnis Québecs den verlorenen Schneepflug der Eisenbahngesellschaft und lernten in Montreal, warum es eine Million kanadische Dollars kostet, einen Zentimeter Schnee in der Metropole zu entfernen. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 16.01.2025 NDR Eiskalte Pracht – Auf Argentiniens gefährdeten Gletschern
Ein Film über die Bedeutung der Eisfelder in Zeiten der drohenden Klimakatastrophe – und nicht zuletzt über die einmalige Schönheit der bizarren Eislandschaften am südlichen Rand der Welt. Hinter der Granitbarriere des Fitzroy-Massivs staut sich ein gigantisches Eisfeld: 13.000 Quadratkilometer groß, 370 Kilometer lang. Der Eispanzer ist über 1.000 Meter dick. 60 Gletscher stürzen sich in die Täler Patagoniens, auf der chilenischen Seite im Westen wie auf der argentinischen Flanke im Osten des Kontinents. Die grandiose Landschaft wird seit 1981 von der UNESCO als Weltkulturerbe geschützt. Die Klimadaten sind jedoch alarmierend: Die Gletscher gehen zurück.Im Auftrag des Instituto Antartico Argentino untersucht der slowenisch-argentinische Glaziologe Pedro Skvarca die Veränderungen der Gletscher. Die Filmemacher Christine Kruchen und Thomas Hoepker haben Skvarca auf eine Forschungswanderung über Patagoniens Gletscher begleitet. Sie haben die wilde Schönheit der blauweißen Eismassen erlebt und Skvarca bei seiner Arbeit beobachtet. Vom Städtchen El Caláfate aus fährt Pedro Skvarca mit dem Schiff über den Lago Argentino zu seinem Basislager am Rand des Moreno Gletschers. Hier lebt er, manchmal tagelang, allein und genießt die einsame Stille der gefrorenen Natur. Wenn das in Patagonien immer unberechenbare Wetter es erlaubt, steigt er mit seinen Helfern früh morgens mit Steigeisen und Pickel ins Eis und dokumentiert die Veränderungen auf dem Gletscher. Der deutsche Professor Ekkehard Jordan von der Universität Düsseldorf begleitet ihn gelegentlich dabei. Jeder Ausflug ist ein Abenteurer, denn der Gletscher verändert sich ständig. Wo gestern noch ein Kletterpfad war, können heute schon tiefe Spalten oder hohe Barrieren den Weg versperren. Ein weiteres Ziel ist der Upsala-Gletscher. Mit 870 Quadratkilometern ist er der größte Gletscher Südamerikas. Er ist am ehesten nach einer langen Fahrt auf dem Lago Argentino zu erreichen. (Text: BR Fernsehen) Deutsche TV-Premiere So. 19.11.2006 SWR Fernsehen von Christine Kruchen und Thomas HoepkerEismissionare – Bei den Inuit von Nunavut
Deutsche TV-Premiere Mi. 27.03.2002 Südwest Fernsehen von Marcel BauerElefanten
Zwischen Mensch und Elefant gibt es eine uralte Beziehung. Er wurde lange als Gott verehrt und erst in jüngster Vergangenheit wegen des Elfenbeins gejagt. (Text: BR Fernsehen)Elefantenparadies Südindien – Die Mahouts von Kerala
Im südindischen Bundesstaat Kerala gibt es mehr als 1500 gezähmte Elefanten. Sie befinden sich im Besitz von Tempeln und wohlhabenden Geschäftsleuten, die sich die Tiere als Statussymbol halten. Betreut werden sie von Mahouts, Pflegern, die rund um die Uhr für das Wohl der Dickhäuter verantwortlich sind und oft viele Jahre, wenn nicht das halbe Leben mit dem gleichen Elefanten verbringen. Regisseur Andreas Voigt war auf seinen Indienreisen immer wieder beeindruckt, wenn er mitten im lärmenden Verkehrschaos Elefanten entdeckte, die sich – gelenkt von drahtigen Mahouts, die auf ihren Rücken reiten – fast lautlos durch die Straßen bewegten.Für seine Dokumentation hat er zwei der Elefantenführer von Kerala in ihrem Berufsalltag porträtiert. Mahout Kuttan stammt aus einer Familie, die seit mehreren Generationen die Elefanten der Maharadschas von Thivandrum, der Hauptstadt Keralas, betreut. Sein Schützling ist eine 50-jährige Elefantendame namens Darshini, die für religiöse Zeremonien in einem Vishnu-Tempel ausgebildet ist. Sie ist der Liebling von Prinzessin Lakshmi, einer Nichte des Maharadschas, die den Elefanten täglich besucht, ihn mit Unmengen von Obst verwöhnt und zum Dank Streicheleinheiten mit dem Rüssel erhält. Für Inder sind Begegnungen mit Elefanten erstrebenswert, denn im Hinduismus ist für Glück und Erfolg der elefantengesichtige Gott Ganesha zuständig. Mahout Unni betreut einen Jungelefanten, der einem Minister gehört und normalerweise auf einer Kautschukplantage zum Roden eingesetzt wird. Wenn einmal im Jahr in Thivandrum die „Königliche Jagd“ gefeiert wird, bringt Unni den Arbeitselefanten auf einem Lastwagen dorthin. Denn kein Fest ohne religiöse Zeremonien, keine große religiöse Zeremonie ohne Elefanten. Die prachtvoll geschmückten Tiere nehmen an Ritualen teil, zeigen sich den Gläubigen und führen Prozessionen an. Ihre Besitzer können sie für solche Zwecke vermieten. Doch so populär der Kult um Ganesha in Indien, speziell in Kerala, auch ist, die Welt der Mahouts ist im Umbruch. Kuttan und Unni sind sich einig, dass sie in ihrem Berufsstand zur letzten Generation gehören. Der Film führt in eine exotische Welt, die im modernen Indien nicht mehr lange zum Alltagsbild gehören wird. (Text: rbb) El Hierro – Die Insel am Ende der Welt
„Vor Kolumbus war westlich der Kanareninsel El Hierro das Ende der Welt, die man bis dahin für eine Scheibe hielt“, sagt Maite, die Archäologin von El Hierro. Sie schwärmt von ihrem Eiland: Für sie ist es ein Paradies und dort zu leben ein Privileg. Kaum jemand kennt El Hierro, obwohl Teneriffa nur etwa drei Schiffs- und eine halbe Flugstunde nah ist. Dort gibt es keinen Massentourismus, keinen Lärm, keine Kriminalität, keinen Nepp, keinen Stau, keine Betonburgen und Biermeilen. El Hierro hat, wonach sich immer mehr Menschen sehnen: atemberaubende Natur die Insel ist UNESCO-Biosphärenreservat – charmante Unterkünfte, ein hervorragendes Straßen- und Wanderwegenetz, nette Insulaner , genannt Herrenos, die sich über Gäste freuen, eine gute Küche mit viel Fisch und frischem Gemüse, exotischen Früchten, inseleigenem Käse und Käsekuchen, Rum aus Südamerika und guten Wein von den eigenen vulkanischen Hanglagen – und das alles zu zivilen Preisen.Die Herrenos empfinden bis heute, abseits der Hektik und Massenströme Europas, irgendwie „anders“, könnte man sagen. Nicht rückständig. Im Gegenteil, sie denken sozial und ökologisch, lieben und schützen ihre Natur und pflegen ihre Kultur und Tradition. Sie sind offen und freundlich, eigenwillig und selbstbewusst. Musik ist ihnen wichtig. Sie klingt „weltmusikalisch“, nach dem Mutterland Spanien, aber auch nach dem nahen Afrika und dem fernen Venezuela, Cuba und Mexiko, denn dorthin zog es viele Insulaner in schweren Zeiten. Das kleine aber feine „Bimbache openART Festival“ bringt jeden Sommer Musiker aus aller Welt nach El Hierro. Die etwa 10.000 Insulaner setzen seit Jahrzehnten auf sanften Tourismus und ökologisches Wirtschaften in Fischerei und Landbau: Für Menschen, die Natur und Ruhe suchen und für Wanderer und Taucher ist diese Insel, die 1.500 Meter in die Passatwolken aufsteigt und 2.000 Meter zum Meeresgrund abfällt, ein echtes Paradies. Aus dem weiten Atlantik kommen Wale, Mantas, Delfine, Thunfische und Schildkröten dicht vor die von uralten Lavaströmen und Vulkankratern geprägte Inselküste. Steile Felswände sind das Reich der Kolkraben und einer Rieseneidechse, die es nur auf El Hierro gibt. Auf den Hochebenen grasen die Rinder des Ökobauern Paco in einer sattgrünen, von Natursteinmauern durchzogenen Landschaft, die an Irland erinnert. Die Landschaft wird spektakulär ausgeleuchtet von der Sonne, die fortwährend durch die jagenden Passatwolken aus dem azurblauen Himmel bricht. Hier ist es nie heiß und nie kalt. Auf El Hierro ist immer irgendwie Frühling, und der Besucher findet immer eine Sonnenseite auf der kleinen Insel. Das Filmteam begleitet Maite, die Archäologin, zum Heiligen Baum und den Versammlungsplätzen der geheimnisvollen Bimbaches, der Ureinwohner, die vor 2.000 Jahren aus Afrika kamen, erlebt bei Ananas- und Gemüsebauern den alltäglichen Kampf um eine ökologische Landwirtschaft, folgt Tauchern zu den Walen und Mantas in die blaue Tiefe vor der Insel und zeigt eine Superlative El Hierros, die gerade weltweit Aufsehen erregt: Seit diesem Sommer versorgt ein Wind-Wasser-Kraftwerk die gesamte Insel mit sauberer Energie und macht sie vom Rest der Welt unabhängig. Auch das macht die kleine Insel El Hierro einzigartig. (Text: WDR) Engadin – Im Garten des Inn
Engadin – wie das klingt. Das liegt nicht allein am legendären St. Moritz, dem glamourösen Tummelplatz des Jetset. Im Sommer ist ohnehin kaum Prominenz in St. Moritz. Bustouristen und Reisegruppen teilen sich dann das Terrain und die berühmte Engadiner Nusstorte. Das Engadin besticht vielmehr durch fantastische Weitblicke auf die Bernina-Gruppe und eine atemberaubend reine Luft. Man spricht nicht von ungefähr vom „Champagnerklima“ auf 1.800 Metern Höhe. Wanderer aller Fitness-Grade finden hier die entsprechenden Routen. Der Name Engadin ist rätoromanisch und bedeutet „im Garten des Inn“. (Text: rbb)Engini – Feuertänzer auf der Gazelle-Halbinsel
Deutsche TV-Premiere Sa. 04.12.1982 S3 von Paul SchlechtEngland: Adel verpflichtet – Der Baron und sein Dorf
Tissington ist ein kleines Dorf im englischen Peak District, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Wörtlich genommen ist das auch so, denn die Dorf-Uhr am Schloss ist so altersschwach, dass sie nur selten richtig geht. Die Bewohner nennen diese Erscheinung „Tissington Time“, und sie bringt niemanden aus der Ruhe. Im 144-Seelen-Dorf Tissington gehen die Uhren ohnehin anders: Hier regiert noch der Schlossherr, Sir Richard. Er hat kaum Geld, auch wenn ihm das ganze Dorf gehört. Aber auch das ist für ihn mehr Last als Privileg: denn Adel verpflichtet. Und so würde kaum einer aus der bunten Schar der Dorfbewohner wirklich mit ihm tauschen wollen. Weder der neu in den Ort hinzu gezogene Besitzer des alten Süßigkeiten-Ladens, der seinen von Arthritis geplagten Hund in einem rollenden Körbchen spazieren führt, noch die ansässigen Bauern, die sich auf den alljährlichen Höhepunkt des Dorflebens vorbereiten.Bei diesem Ereignis handelt es sich um das in ganz England berühmte Well Dressing, ein altes keltisches Ritual, bei dem die Dorfbrunnen mit großen Bildern aus Blütenblättern geschmückt werden. Die Dorfgemeinschaft ist eingeschworen gegenüber Fremden. Dazu zählt auch das Kamerateam des deutschen Fernsehens. Aber: Wer einmal beim Abfohlen der Lieblingsstute dabei ist, öffnet doch ganz langsam die Herzen der Tissingtoner. Ein Sittengemälde über ein Dorf, in dem die moderne Welt noch nicht angekommen ist, deren Bewohner aber damit ganz zufrieden sind. (Text: BR Fernsehen) England – Im Königreich der Gärtner
Für die Engländer ist das Gärtnern mehr als nur ein Hobby. Es ist Volkssport und eine Königsdisziplin. Queen Elizabeth II. adelt die Pflanzenkunst jedes Jahr mit ihrem Besuch der berühmten „Chelsea Flower Show“. (Text: NDR)Englands Lake District
Im Nordwesten Englands liegen zwischen sanft ansteigenden Bergen dutzende Seen mit klarem Wasser. Per Dampfeisenbahn macht sich der Filmautor Frank Jahn auf Entdeckungsreise. Per Dampfeisenbahn macht sich Korrespondent Frank Jahn auf Entdeckungsreise nach Windermere in den Nordwesten Englands. Mit Bergkletterern erobert er die höchsten Hügel: Von hier kann man auf die Irische See und bis nach Schottland schauen. Am Honister Pass können Mutige neben der Aussicht auch Abenteuer erleben. An einem Stahlseil hängend schweben Besucher über die Schlucht.Der „Zip Wire“ ist die Attraktion des Berges, in dem auch eine alte noch aktive Schiefermine liegt. Lange hat der Lake District vom Schiefer gelebt, von hier aus wurde er ins ganze Land transportiert. Mit Schiefer sind auch die Dächer der Häuser in der Region bedeckt. Im alten Ort Grasmere sticht das Grau der Häuser aus dem Grün der Landschaft hervor. Der schönste Ort der Erde, urteilte der große englische Poet William Wordsworth, der hier begraben liegt. (Text: BR Fernsehen) Englands Nordseeküste – Von Edinburgh bis Harwich
Der Zweiteiler „Schottlands Nordseeküste“ und „Englands Nordseeküste“ bietet einen Blick auf die britische Küste aus der Vogelperspektive und ein Porträt der Inselbewohner. Diese Regionen der Nordseeküste, angefangen am Leuchtturm von Dunnet Head, dem nördlichsten Punkt des schottischen Festlandes, bis hinunter zur englischen Grafschaft Suffolk sind keine klassischen Reiseziele für Touristen wie beispielsweise Cornwall, Somerset oder Devon. Es sind landschaftliche und historische Schätze, die auf einer abenteuerlichen Reise durch unbekanntes Terrain aus atemberaubender Perspektive mit Cineflex-HD-Luftaufnahmen vorgestellt werden. Englands Nordseeküste, das sind auf 1.000 Kilometern Natur und Geschichte.Die Küstenlinie steigt wie gemeißelt, schroff und bizarr aus der Nordsee auf. Monumente zeugen von der Größe der einst bedeutendsten Seemacht Europas. Keine andere Nation pflegt ihre Spleens und Traditionen mit ähnlicher Ernsthaftigkeit wie die Engländer. In Scarborough begegnet das Filmteam einem skurrilen Künstlerpaar, das Weltliteratur und Wellenbad in einem außergewöhnlichen Schwimmerlebnis in der Nordsee vereint. Das Team bangt zusammen mit Imker Willie Robson in einem typisch verregneten Sommer um seine Bienenstöcke, begleitet den Lokführer der North Yorkshire Moors Railway, der ältesten Dampfeisenbahn der Welt, und lässt sich vom Chefgärtner in den prächtigen Rosengarten des ältesten Barockschlosses in England entführen. (Text: BR Fernsehen) Entlang der Großen Seen
Die Großen Seen gehören zu den mythischen Landschaften Nordamerikas. Man trifft auf endlose Wasserflächen, endlose Wälder. Viele Indianerstämme lebten hier. Den weißen Jägern und Fallenstellern folgten später die Siedler aus Europa. Sie jagten in den Wäldern und transportierten ihre Felle und Waren über das Wasser nach Süden. Von dort führt ein kleiner Fluss am Südzipfel des Lake Michigan weiter in Richtung Süden der USA. Die Siedlung, die dort entstanden ist, nannten die Indianer Checagou. Daraus wurde viel später die erste Hochhausstadt der Welt: Chicago, die Megacity am Großen See.Die Route beginnt am Lake Huron mit der Überfahrt nach Manitoulin Island. Beide Namen sind indianischen Ursprungs. Die „Insel des Großen Geistes“ ist immer die Heimat mehrerer Stämme gewesen. Dort trifft das Filmteam Grant und Neil, die beide erfolgreich ein modernes Leben mit der Tradition ihrer Vorfahren verbinden. Die Seeenge von Little Current wird passiert. Hier stößt man auf Gordon, den Herrn über eine der ältesten Drehbrücken Nordamerikas. Das kanadische Festland nördlich der Insel ist bis heute reich an Bären und Elchen. Auf dem Weg zur der Stelle, wo sich der Lake Huron und der Lake Superior treffen und Kanada und die USA aufeinanderstoßen, wird das Land immer weiter, Felder und Wälder wechseln sich ab zu beiden Seiten des Highways. Die Stadt Sault Ste. Marie in der Nähe von Ontario und die Schleusen sind der Kreuzungspunkt der Seen und der Länder. Weiter geht es am Ufer des Lake Michigan entlang. Nach der Passage über die gewaltige Mackinac Bridge, die die Querung des Lake Huron und Lake Michigan überspannt, führt die Tour nun immer weiter nach Süden. Es ist eine Urlaubsgegend, es mutet landschaftlich an wie in Skandinavien, die Farben Blau und Grün dominieren. Die Orte an den Großen Seen verweisen auf die vielen europäischen Einflüsse, englische, niederländische, deutsche. Das ist am Stil der Häuser zu erkennen. In Empire, einem kleinen Urlaubsort direkt neben den größten Sanddünen der USA, den Sleeping Bear Dunes, den „Dünen des schlafenden Bären“, trifft das Filmteam Ella. Weiter geht es im Bundesstaat Michigan durch Frankfort in die Stadt Holland im Westen. Die Stadtvertreter sandten einst im Andenken an die Gründerväter eine Delegation in die Niederlande, die dort eine Windmühle aus dem 18. Jahrhundert kauften. Diese wurde in ihre Einzelteile zerlegt per Schiff an das Ufer des Lake Michigan transportiert. So wurde Alisa in Holland/Michigan die einzige Müllerin in der einzigen original niederländischen Windmühle der USA. Dieses Handwerk setzt sie erfolgreich als Geschäft im 21. Jahrhundert fort. Von Holland aus sind es weniger als 200 Kilometer, ehe man am Horizont die erste Megacity der Welt erblickt: Chicago, die Stadt, in der das Hochhaus aus Stein und Beton erfunden wurde, der erste große Melting Pot der jungen USA. Deutsche und Polen waren unter den Ersten, die hier Arbeit und eine neue Heimat suchten. Dann kamen Italiener und Griechen, später viele farbige Amerikaner, die dem Rassismus im Süden ihres Landes entkommen wollten. Sie brachten ihre Musik mit und machten Chicago zur Welthauptstadt des Blues. (Text: ARD alpha)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.