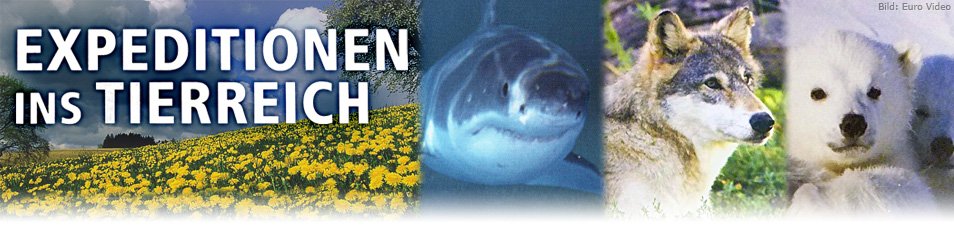unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 3)
Der blaue Planet – Unbekannte Ozeane (One Ocean)
Die Kamerateams unternahmen 125 Expeditionen, verbrachten 1.500 Tage auf See, davon mehr als 1.000 Stunden in der Tiefsee. Sie filmten in jedem Ozean und vor jedem Kontinent. Sie besuchten Korallenriffe, Küsten, Unterwasserwälder und tauchten hinab in unbekannte Tiefen. Mit revolutionärer Technik gelingt ein Einblick in völlig neue Welten. Walhaie, Delfine und viele andere Tiere sind mit kleinen Kameras versehen und zeigen mit den damit aufgezeichneten Bildern direkt ihren Alltag. Helikopterkameras vermitteln eine Ahnung von der unendlichen Weite des Meeres.Mit Rebreather- oder Kreislauftauchgeräten kommen die Filmer so nah an viele Tiere wie nie zuvor, da weder Luftblasen noch Geräusche die Darsteller vertreiben. So gelingen ihnen nicht nur einzigartige Aufnahmen, sondern sie decken Verhaltensweisen auf, die selbst Forschern unbekannt sind und sogar zu neuen wissenschaftlichen Veröffentlichungen führen. Axel Milberg, bekannt als „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski, erzählt zu den atemberaubenden Bildern unglaubliche Tiergeschichten, spannender als jeder Krimi. Tatort: die Ozeane der Welt. So betreiben beispielsweise Delfine präventive Selbstmedikation. Sie reiben sich an einer Hornkoralle mit deren antiseptischer Schleimschicht ein. Schon die Jüngsten in der Delfingruppe werden in das uralte Heilwissen eingeführt. Solche zielgerichteten Verhaltensweisen sind jedoch kein Monopol von intelligenten Meeressäugern. Im australischen Great Barrier Reef gelingt es zum ersten Mal, einen Fisch bei einer äußerst ungewöhnlichen Aktion zu filmen. Diese stellt alles, was bislang über Fischverhalten bekannt war, in den Schatten: Wenn ein Großzahnlippfisch nach langer Suche seine Lieblingsnahrung gefunden hat, eine Muschel, steht er vor einem Problem: Wie soll er an das saftige Fleisch darin gelangen? Zielstrebig schwimmt er zu einer abgestorbenen Hirnkoralle, die sich rasch als seine „Werkbank“ entpuppt. Unermüdlich schlägt er die Schale so lange darauf, bis sie, oft erst nach 20 Minuten, zerbricht. Damit gehört der Großzahnlippfisch zum „Club der werkzeugmachenden Tiere“, dem sonst eher nur illustre Mitglieder wie Affen oder kluge Rabenvögel angehören. Fische sind also weitaus smarter als gedacht. Ungewöhnliches Verhalten ganz anderer Art dokumentiert ein Team vor Neuseeland. Dort jagt der Kleine Schwertwal den Großen Tümmler. Die Namen täuschen darüber hinweg, dass die Jäger mit ihren sechs Metern Länge deutlich größer sind als ihre Beute. Und trotzdem wagen es die Großen Tümmler, sich plötzlich ihren Verfolgern zuzuwenden und sie mit speziellen Lauten zu begrüßen. Und statt sie zu zerreißen, bilden die Schwertwale mit ihren kleineren Verwandten eine riesige Gemeinschaft, aus Jägern und Gejagten werden Jagdkumpane. Nachdenklich stimmt die Geschichte einer Walrossmutter, die verzweifelt einen Rastplatz für ihr Kind sucht. Ihre Welt schmilzt dahin. In den letzten Jahren ist das Sommereis um 40 Prozent in der Arktis verschwunden. Bei den einfühlsam gedrehten Bildern ist förmlich zu spüren, wie das Team mitempfindet und erleichtert aufatmet, als Mutter und Kind schließlich auf einer Scholle zur Ruhe kommen, wie Kameramann Ted Gifford später berichtet. Doch ob das Kleine später für sein eigenes Junges noch einen Platz finden wird, ist mehr als fraglich. Und nicht nur das. Denn das arktische Meer ist mit allen anderen Meeren der Welt verbunden. Was hier passiert, wird irgendwann überall Wirkung zeigen. Die Koproduktion von BBC, WDR, NDR, BR und SWR „Der Blaue Planet“ macht eine faszinierende Reise und taucht in unbekannte Ozeane an. (Text: NDR) Der blaue Planet – Unterwasserdschungel (Green Seas)
45 Min.Wenn die Sonne im Frühjahr das Meer erwärmt, setzt sie eine riesige Veränderung in Gang, karger Meeresboden verwandelt sich in einen Unterwasserdschungel. Überall streben Tangwedel dem Licht entgegen, emporgezogen von ihren Schwimmbojen, gasgefüllten Blasen. Ausgewachsen erreichen diese Riesenalgen eine Länge bis zu 60 Meter. Sie bilden die Tropenwälder der Meere. Erstmals gelangen den Teams der BBC Aufnahmen von einem wahren Verwandlungskünstler: Der Oktopus ist dafür bekannt, dass er sich farblich geschickt seiner Umgebung anpassen kann.Was aber tut er, wenn er sich einem Räuber gegenübersieht, der auf elektrische Felder reagiert und der sich zudem in fast jede Ritze zwängen kann? Der Oktopus zieht sich in Windeseile eine Rüstung an: aus Muschelschalen. Zwar verdeckt er damit nicht sein elektrisches Feld, doch der Hai ist so verwirrt von den Muscheln, die plötzlich vor seinem Maul auseinanderstieben, dass der Oktopus in dem Durcheinander fliehen kann. Betrogen wird auch unter Speer-Fangschreckenkrebsen. Deren Jagdmethode ist einzigartig: Schwimmt ein Fisch vorbei, schnellt das Männchen blitzschnell aus seiner Höhle und bohrt seine zu kleinen Harpunen umgewandelten Vorderbeine in das Opfer. Die Beute verzehrt es aber nicht allein, sondern füttert seine in der Höhe wartende Partnerin. Es gibt Paare, die über 20 Jahre zusammenleben. Sie kümmert sich um die Eier, er jagt. Solange er immer wiederkommt, geht die Rechnung auf. Doch eines Tages bleibt er aus, denn ein verlockender Duft hat ihn aus seinem Bau gelockt. Er stiehlt sich davon und schlüpft in einen anderen Bau zu einer größeren Partnerin. Größer heißt mehr Eier, heißt mehr Nachkommen. Was ihm aber wohl erst später aufgehen wird: Größere Weibchen haben auch größeren Hunger. Eine Seegraswiese nimmt 35 Mal mehr Kohlendioxid auf als eine vergleichbare Fläche Regenwald. Auf den ersten Blick erscheint es da fatal, dass eine einzige Grüne Meeresschildkröte an nur einem Tag über zwei Kilo davon abweidet. Zwar verbreitet sie mit ihrem Kot auch die Seegrassamen. Doch noch etwas anderes sorgt dafür, dass die marinen Rasenmäher nicht alles kahlscheren: Tigerhaie. Mit ihrem gewaltigen Gebiss können sie die gepanzerten Reptilien wie Nüsse aufknacken. Deshalb dürfen die Schildkröten nie lange an einem Ort bleiben, ständig müssen sie auf der Hut vor ihrem Feind sein. Die Haie arbeiten also indirekt durch den Erhalt der Seegraswiesen auch für den Klimaschutz. Jedes Jahr sorgt die Frühjahrsonne in den Meeren der gemäßigten Zonen für immense Algenblüten. Diese grünen Massen sind der Beginn einer langen Nahrungskette. Sie dienen kleinsten Tierchen als Nahrung. Und die wiederum locken unzählige Sardellenschwärme an. Delfine, Seelöwen, Seevögel, sie alle sind hinter den kleinen Fischen her. Letztendlich hängt alles Leben im Meer von diesen winzigen grünen Organismen ab, bis hin zu Meeresriesen. Die größten Gäste bei dem vor Kalifornien gedrehten Festbankett sind Buckelwale. Bei jedem Auftauchen verschwinden mehrere Hundert Kilogramm Fisch in ihrem Maul. Mit diesen eindrucksvollen Bildern enden die Geschichten aus dem Unterwasserdschungel, die Sprecher Axel Milberg spannend und poetisch zugleich erzählt. Eine Koproduktion von BBC, WDR, NDR, BR und SWR. (Text: NDR) Borneos Zwergelefanten
Filmemacher Michael Wong zeichnet ein berührendes Porträt der scheuen Zwergelefanten Borneos und des Mannes, den die Herde in ihrer Nähe akzeptiert. In den dichten Regenwäldern im Norden Borneos leben die Zwergelefanten. Lange Zeit vermutete man, dass es sich bei ihnen um verwilderte Arbeitselefanten handelt – doch DNA-Analysen lieferten ein sensationelles Ergebnis: Die asiatischen Zwergelefanten sind tatsächlich eine eigene Unterart. Gerade von der Wissenschaft entdeckt, droht diesen Tieren Gefahr durch die Abholzung des Regenwaldes und durch Wilderer. Spurensucher Bert Dausip begibt sich auf eine Expedition ins Unbekannte. Zum Schutz der Tiere will er wichtige Informationen sammeln, mehr über die scheuen Waldbewohner herausfinden, ihr Leben kennenlernen und erforschen, welche Bedürfnisse sie haben.In Begleitung des Kameramanns Michael Wong konnte Dausip bisher nie gesehene Verhaltensaufnahmen sowie eindrucksvolle Begegnungen zwischen ihm und seinen Elefanten festhalten. Er gewinnt schließlich nach vielen Monaten das Vertrauen einer Elefantenherde. Anrührende Szenen zeigen, wie sensibel und intelligent die Dickhäuter sind. Schockiert muss Bert Dausip feststellen, dass viele der Elefanten durch Fallen und Schlingen der Wilderer tiefe Wunden haben. Er alarmiert Tierärzte und Wissenschaftler, die in einer spektakulären Rettungsaktion die Tiere ärztlich versorgen und anschließend mit Sendern versehen. (Text: BR Fernsehen) Bulgarien – Durch den wilden Balkan
Steile Klippen, malerische Sandstrände und glasklares Wasser: Das ist die Schwarzmeerküste Bulgariens. Sie ist Anziehungspunkt für sonnenhungrige Touristen aus ganz Europa. Am Abend fröhlich klingende Musik, feurige Tänze und farbenfrohe Trachten, das ist Balkanklischee pur! Bulgarien hat mehr zu bieten als nur Meer und Strand: über 2.500 Meter hohes Gebirge, in dem Bären und Wölfe leben, schroffe Felsformationen, in denen Geier ihre Nahrung finden, sowie die malerische Donautiefebene mit Bienenfressern und Blauracken. Das alles macht den anderen, eher unbekannten Teil des Landes aus. Während im Pirin- und Rilagebirge Wölfe und Bären noch im letzten Schnee des Winters nach Nahrung suchen, beginnt am Schwarzen Meer und in der Donautiefebene bereits der Frühling.Tausende Weißstörche ziehen nach Norden in ihre Brutgebiete. Entlang der Donau geben Frösche und Unken ihr „Frühjahrskonzert“. In unzugänglichen Auwäldern paaren sich seltene Sumpfschildkröten. Bulgarien ist ein Land im Umbruch zwischen Tradition und Moderne. Eselskarren und eine vielerorts archaisch anmutende Landwirtschaft sind keine Seltenheit. In dem dünn besiedelten Balkanstaat zwischen Europa und Asien konnte bis heute eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erhalten werden. (Text: NDR) Costa Rica – Das pralle Leben
45 Min.Das Lebensmotto der Menschen von Costa Rica lautet nicht umsonst pura vida (pralles Leben). Das kleine Land Mittelamerikas zählt zu einem der Hotspots der Artenvielfalt der Erde. Grund hierfür sind sicher die vielen Nationalparks und Schutzgebiete, die gut ein Viertel der Landesfläche ausmachen. In der ungezähmten Natur Costa Ricas hat sich seit Jahrmillionen eine artenreiche Tierwelt mit bemerkenswerten Überlebensstrategien entwickelt, vom winzigen Kolibri bis zum riesigen Hammerhai, vom hohen Blätterdach des Dschungels bis in die Tiefen des Pazifischen Ozeans.Weite Teile des Landes in Lateinamerika sind bis heute von dichtem tropischem Regenwald bedeckt. Ein Paradies für exotische Tiere wie Elefantenkäfer, Dreifingerfaultier, Ozelot oder Diese Dokumentation zeigt die einzigartige Fauna Costa Ricas in beeindruckenden Bildern und deckt dabei spannende Geheimnisse des Tierreichs auf: nächtliche Raubzüge, skurrile Balztänze und ungewöhnliche Paarungsrituale eingeschlossen. Auch das ist das „pralle Leben“, das dieses Land zwischen Karibik und Pazifik mit seinen bis heute aktiven Vulkanen so einzigartig macht. (Text: NDR) Dachse – Unsere unbekannten Nachbarn
45 Min.In Deutschlands Wäldern lebt eine bunte Vielfalt an Tieren. Manche sind den Menschen sehr vertraut, andere weniger. Eines dieser Tiere glaubt jeder zu kennen. Doch nur wenige bekommen es zu Gesicht: den Dachs. Der Nachtjäger verschläft den Tag unter der Erde. Der Meister im Tiefbau kann seine Bauten auf über 30 Meter ausdehnen und bis zu fünf Meter tief graben. Nur in Sommernächten wagt er sich auch bei Helligkeit heraus, zu kurz, um ausreichend Nahrung aufzunehmen. Der Film begleitet eine Dachsfähe mit ihren beiden Jungtieren. Die großen Marder sind Spätentwickler, erst mit neun Wochen lernen sie laufen.Noch unsicher auf den Beinen wagt sich einer der beiden aus dem Bau und begibt sich damit in Gefahr. Im Revier nebenan lebt ein ganzer Dachsclan. Neben einem erwachsenen Männchen sind die meisten Tiere Weibchen und Jungtiere aus mehreren Jahrgängen. Zwischen den Tieren bestehen enge Familienbande. So helfen sie sich gegenseitig, Schmutz und Parasiten aus dem Pelz zu entfernen. Dachse sind also, entgegen ihrem Ruf als mürrische Einzelgänger, ausgesprochen soziale Tiere. Die Dachse teilen sich ihren Lebensraum mit einem Rauhfußkauzpaar, einer Wildkatzen- und einer Fuchsfamilie. Auch sie sind voll damit beschäftigt, ihre Jungen großzuziehen. Auf die Dachsfähe wartet im Spätherbst noch eine anstrengende Arbeit: Stundenlang polstert sie ihren Bau mit Laub und altem Gras aus, damit sie und ihre Jungen es schön bequem haben während ihrer monatelangen Winterruhe. Bis sie im Frühjahr darauf wieder zeigen können, wie sie wirklich sind: schlaue Allesfresser, geschickte Baumeister und soziale Familientiere. (Text: NDR) Deutschlands wilde Küste – Vorpommerns Naturwunder
An der Ostsee liegt eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands mit ihren berühmten Wahrzeichen: die Kreidefelsen von Rügen. Sie ragen knapp 120 Meter in den Himmel empor und bieten den seltenen Wanderfalken geschützte Brutmöglichkeiten. In den Buchenwäldern von Jasmund am Rande der weißen Klippen ziehen Dachse und Damhirsche ihre Jungen auf. Die Bodden auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sind nur durch schmale Meerengen mit der Ostsee verbunden. Mit ihrem türkisfarbenen Wasser gleichen sie karibischen Lagunen und bieten Nist- und Rastplätze für eine Vielzahl von Vögeln.Im Herbst rasten bis zu 60.000 Kraniche in der Region und Seeadler gehen auf die Jagd. Im Darßer Urwald kommen die Hirsche bis in die Dünengürtel der Strände, wo sich die Bullen zur Brunft erbitterte Kämpfe liefern. Ein Anblick, den man so nur an Vorpommerns Küste erlebt. Während viele Menschen die Küste kennen, ist die dahinter liegende Auenlandschaft weitgehend unbekannt. Doch Vorpommerns verborgene Wasserwelt aus Flüssen, Niedermooren und Wiesen beherbergt eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. In den unzugänglichen Flusstälern Vorpommerns lebt der seltenste Adler Deutschlands: der Schreiadler. Von den Einheimischen wird er auch liebevoll „Pommernadler“ genannt. Nur noch 100 Paare gibt es davon in Deutschland, 80 von ihnen kehren aus den Winterquartieren zurück nach Vorpommern. Eine intensive Landwirtschaft und der immer weiter steigende Holzbedarf haben dem Schreiadler weitgehend den Lebensraum genommen. Nun lassen umfangreiche Renaturierungen entlang der Flüsse Peene, Rechnitz, Tollense und Trebel die Niedermoore wieder wachsen und geben auch anderen Tieren eine neue Heimat. Die Natur Vorpommerns ist außergewöhnlich, und das hat einen Grund: viele der einzigartigen Landschaften stehen unter strengem Schutz. Allein der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft ist mit über 80.000 Hektar neben den beiden Parks am Wattenmeer das größte Schutzgebiet Deutschlands, das vielfältigste Gebiet ist es allemal. (Text: NDR) Deutschlands Wilder Norden – Schleswig-Holsteins Naturschätze
45 Min.Wer mit Schleswig-Holstein nur Badeurlaub am Meer verbindet, liegt falsch. Denn abseits der Küste gibt es ungeahnte Naturschätze. Deutschlands nördlichstes Bundesland ist dicht besiedelt und stark von der Landwirtschaft geprägt, überrascht dennoch mit einer unerwarteten Artenvielfalt. In der Nähe von Neumünster wird im Herbst eine Waldlichtung zum Turnierplatz der Rothirsche. Dort kommt es zu dramatischen Kämpfen, untermalt vom tiefen Röhren der Hirsche und dem Geräusch aufeinanderprallender Geweihstangen. Die Westseite Schleswig-Holsteins hingegen besteht aus Land, das der Mensch seit Jahrhunderten dem Meer abgetrotzt hat, den Kögen.Die Marschböden dort sind fruchtbar und werden intensiv beackert. Es gibt auch zahlreiche Windräder, so bleibt nicht viel Platz für die Natur. Bisweilen taucht hier ein Weltenbummler auf: die seltene Sumpfohreule. Sie ist ein eleganter Flieger, doch brütet sie nur, wenn es viele Mäuse gibt. Die Euleneltern sind extrem wachsam und vertreiben Feinde mit spektakulären Angriffsflügen. Weites, offenes Land ist ihr Lebensraum, so wie ihn die Köge oder auch die Flussauen in Nordfriesland und Dithmarschen bieten. Die seltenen Zauneidechsen und scheuen Kreuzottern hingegen bevorzugen Heide und Moore, aber auch „Natur aus zweiter Hand“ wie das Naturschutzgebiet Geltinger Birk ganz im Norden Schleswig-Holsteins oder das Stiftungsland Schäferhaus, einem Naturschutzgebiet westlich von Flensburg. In ihnen halten Galloway-Rinder und Konik-Pferde die Landschaft offen. Über zwei Jahre war Tierfilmer Uwe Anders für seine Dokumentation in Schleswig-Holstein unterwegs. Entstanden ist ein überraschendes Naturporträt von Deutschlands wildem Norden. (Text: NDR) Deutschlands wilde Wölfe – Wie sie wirklich sind
Sie gelten als die Herrscher der Wildnis: Wölfe. Die einen sehen sie als reißende Bestien, die anderen verklären sie zu mythischen Wesen. Viele Menschen sind fasziniert von der oft beschriebenen strikten Rangordnung, die Forscher bei Wolfsrudeln in Gehegen beobachtet haben; scheint sie doch Hierarchien am Arbeitsplatz und in anderen Bereichen unserer Gesellschaft widerzuspiegeln. Doch gibt es eine umkämpfte Rangordnung auch bei Wolfsrudeln in Freiheit? Wie leben wilde Wölfe wirklich? Über 150 Jahre lang war es unmöglich, diese Fragen in Deutschland zu beantworten.Doch seit gut zehn Jahren gibt es bei uns wieder freilebende Wölfe. Inzwischen leben ein gutes Dutzend Rudel in Deutschland, Tendenz steigend. Fast von Beginn an hat der Biologe und Tierfilmer Sebastian Koerner die Rückkehr der Wölfe mit der Kamera dokumentiert und die Arbeit von Deutschlands renommiertesten Wolfsforscherinnen begleitet: Gesa Kluth und Ilka Reinhardt vom Wildbiologischen Büro LUPUS. Mit deren Unterstützung und unendlich viel Geduld gelangen Sebastian Koerner einzigartige Filmaufnahmen vom Familienleben wildlebender Wölfe, wie es sie bisher in Europa noch nicht gegeben hat. Der Film folgt der leicht schielenden Jungwölfin Silberblick und ihren vier Geschwistern des Seenland-Rudels und zeigt, wie sie ein Jahr später ihren Eltern bei der Aufzucht der neuen Welpen helfen. Extrem seltene Aufnahmen, die man bisher noch nicht gesehen hat. Dank moderner GPS-Sendehalsbänder konnten auch die Wanderwege einiger Jungwölfe verfolgt werden. Einige suchten ganz in der Nähe Platz, um ein neues Rudel zu gründen, manche versuchten sogar, ein Territorium eines Konkurrenten zu erobern. Ganz woanders als in Deutschlands größtem Wolfsgebiet, der Lausitz, wollte Jungwolf Alan eine Familie gründen: Er ist gut 1.500 Kilometer nach Nordosten gelaufen, um in Weißrussland sein Glück zu versuchen. Sebastian Koerner wollte noch eine andere Frage klären: Können nur mehrere Wölfe zusammen wehrhafte Wildschweine, Rothirsche und sogar Elche und Wisente töten und leben sie deshalb in einem Rudel? Zur Beantwortung dieser Frage musste er Deutschland verlassen. Denn in der Lausitz wollte es Koerner einfach nicht gelingen, wilde Wölfe bei der Jagd zu filmen. Erst im Yellowstone-Nationalpark in Nordamerika gelang ihm das. Der Film „Deutschlands wilde Wölfe“ zeigt, wie ähnlich sich die Sozialstrukturen von Menschen und Wölfen sind, und was die Wölfe so geeignet machte, zum treuesten Haustier des Menschen zu werden. Der Film räumt auf mit modernen Märchen über ein faszinierendes Wildtier, das dank strenger Schutzmaßnahmen wieder eine wichtige Rolle in Deutschlands Natur spielt. (Text: NDR) Die Dolomiten – Im Garten der Helden
Die Dolomiten sind die bekannteste Region der Südalpen und ein Naturparadies; eine Landschaft wie geschaffen für Mythen und Helden, auch für Helden aus der Tierwelt. Kurt Mayer und Judith Doppler haben die Dolomiten mehr als ein Jahr lang bereist und zeigen in ihrer Dokumentation eine Wildnis im Aufbruch. Abseits touristischer Pfade hat das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten Überraschungen zu bieten, die kein Sommer- oder Wintergast je zu Gesicht bekommt. Erstmals seit 100 Jahren durchqueren wieder Großraubtiere die Dolomiten. Das Filmteam beobachtet einen Wolf auf der Suche nach neuem Lebensraum und macht dabei eine spannungsgeladene Reise durch die wilden Bergwelten.Dabei wird gleichzeitig mit hartnäckigen Mythen aufgeräumt. Der Wolf ist keine reißende Bestie, der Luchs kein Räuber außer Rand und Band und der Fuchs, das erfolgreichste Raubtier Europas, entpuppt sich hier als teilweise sogar vegetarischer Gourmet. Steinadler haben das Land der „bleichen Berge“, wie man die Dolomiten früher nannte, wieder unter sich aufgeteilt. In einzigartigen Flugaufnahmen verfolgt die Naturdokumentation ihre Paarung und beobachtet ihre bemerkenswerte Jagdtechnik. Junge Bären, die von ihrer Mutter verlassen wurden, erobern seit einiger Zeit auch die Passstraßen Südtirols. Im September 2014 kam es in Cortina d’Ampezzo zu einer gefährlichen Situation: Eine Bärenmutter war beim Versuch, sie zu fangen, zu Tode gekommen. Die Gemeinde hatte in der Folge den Jungen geschütztes Gelände geboten und die Kosten dafür übernommen. Sie sollten in ihrem natürlichen Lebensraum aufwachsen. Bären sind Allesfresser, können also unter Schutz auch allein von der natürlichen Vegetation leben. Von Wasser und Eis zerfurchte Felsspitzen, leuchtende Zirben und Lärchenwälder, markante Gebirgsstöcke wie fossile Archipele einer versunkenen Zivilisation: Aus dem Blickwinkel eines Steinadlers durchstreift das Filmteam König Laurins Rosengarten. Schneehase, Gams und Murmeltier, gewitzte Ernährungsstrategen und erprobte Hungerkünstler, faszinieren durch ihre Höchstleistungen. Als Relikt der Eiszeit lebt das Schneehuhn dort, wo es kühl geblieben ist. Wer sich in wenigen Sekunden nahezu überall sein Schneebett richten kann, ist in Höhen über 2.000 Meter der König. Der einsam umherziehende Wolf trifft zu guter Letzt nahe einer verwaisten Stellung des österreichisch-italienischen Alpenkrieges auf eine Gefährtin, die ihrerseits den langen Weg von den südlichen Apenninen bis in die Alpen gefunden hat. (Text: NDR) Die Elbe – Vom Riesengebirge zur Sächsischen Schweiz
45 Min.Die Elbe fließt durch schroffe Täler, vorbei an Burgen, malerischen Städten und Schlössern bis zum Hamburger Hafen und schließlich in die Nordsee. 1.100 Kilometer zieht sie sich quer durch Tschechien und Deutschland. Der Fluss hat sich seine Ursprünglichkeit in großen Teilen bewahrt. An der Elbe leben Tierarten, die in anderen Regionen Europas selten geworden sind. Nebel liegt über dem Riesengebirge, weiße Schwaden ziehen durch die Wälder. Ein kleiner Steinring auf 1.386 Metern markiert symbolisch die Quelle der Elbe, die hier Labe genannt wird.Nur einen Kilometer entfernt stürzt der Strom 40 Meter in die Tiefe und fließt dann durch felsige Landschaft mit dunklen Wäldern und tiefen Schluchten. Auf offenen Waldlichtungen röhren im Herbst die Rothirsche. Im zeitigen Frühjahr balzen Birkhähne im Nationalpark Riesengebirge, während in den tieferen Lagen Fischotter im Eiswasser nach Beute tauchen. Bei Špindleruv Mlýn wird die Elbe zum ersten Mal von einem Stauwehr „gezähmt“. Die Anwohner sollen vor Hochwasser geschützt werden. Auf ihrem Weg durch das Böhmische Becken ist die Elbe voller Naturschätze. Vorbei an den Städten Hradec Králové und Pardubice windet sie sich zunächst nach Süden. Vielerorts leben Fischotter direkt am Fluss, während sich Rotbauchunken in den Gewässern ehemaliger Truppenübungsplätze heimisch fühlen. Besondere Lebensräume sind die Altarme der Elbe: An stillen Orten mit viel Röhricht lebt eines der kleinsten Nagetiere Europas, die Zwergmaus. Im sauberen Wasser pflegen Bitterlinge eine einzigartige Symbiose: Die kleinen Karpfenfische legen ihre Eier in Süßwassermuscheln und verbreiten dafür deren Nachwuchs. Bezeichnend für die Böhmische Schweiz und die Sächsische Schweiz sind malerische Felsen und Tafelberge, bizarre Schluchten und Felslabyrinthe, Sandsteinnadeln und urwüchsige Buchenwälder. Bei Dresden mit dem berühmten Beinamen Elbflorenz endet die erste Folge des aufwändigen Elbe Porträts, das entlegene Naturparadiese vorstellt, in überraschend vielfältige Landschaften entführt und Einblicke gibt in die außergewöhnlichen Verhaltensweisen der Tiere am großen Strom. (Text: NDR) Die Elbe – Von Sachsen zum Wattenmeer
45 Min.Die Elbe fließt durch schroffe Täler, vorbei an Burgen, malerischen Städten und Schlössern bis zum Hamburger Hafen und schließlich in die Nordsee. 1.100 Kilometer zieht sie sich quer durch Tschechien und Deutschland. Der Fluss hat sich seine Ursprünglichkeit in großen Teilen bewahrt. An der Elbe leben Tierarten, die in anderen Regionen Europas selten geworden sind. Die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke sind dem Lauf der Elbe zwei Jahre lang gefolgt, haben bekannte und weniger bekannte Regionen besucht und die Tiere der einzigartigen Flusslandschaft porträtiert. Die zweite Folge der aufwendigen Dokumentation folgt der Elbe vom sächsischen Torgau bis nach Cuxhaven, wo der Fluss in die Nordsee mündet.Der Winter ist bitterkalt an der sächsischen Elbe. Füchse zeigen sich am helllichten Tag auf der Suche nach Partnern und Beute von verendeten Tieren. Das zieht auch Raben und Greifvögel an: ein Kampf ums Überleben in einer vereisten Traumlandschaft. Die Elbe in Deutschlands Osten ist so naturbelassen und vielfältig, dass sie über 400 Kilometer unter besonderem Schutz steht. Das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe erstreckt sich von Sachsen-Anhalt bis Schleswig-Holstein. Zehntausende Zugvögel nutzen die Elbauen zum Überwintern oder als Rastplatz während des Durchzuges. Im Frühling werden Moorfrösche und Urzeitkrebse in die Tümpel der Auen gelockt. Wie wild die Elbe sein kann, zeigt sie bei Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. In der Nähe erstreckt sich Europas größter Auwald mit seinem Kernstück, dem Steckby-Lödderitzer Forst.1.000 Pflanzenarten, 135 Vogel- und 40 Säugetierarten leben hier, eine einzigartige Vielfalt, geschaffen von der Elbe und ihren ständig wechselnden Wasserständen. Auf ihrem Weg vorbei an Tangermünde und dem Wendland in Niedersachsen bleibt die Elbe einer der natürlichsten Flüsse Europas und bietet Platz für Seeschwalben, Rothirsche und Waschbären, die dort wieder siedeln. Bei Geesthacht wird der Strom auf deutscher Seite zum ersten Mal „gezähmt“, denn der Hamburger Hafen ist nicht mehr weit. Kurz hinter der Freien und Hansestadt, in den Elbmarschen des Kehdinger Landes, kommt es jeden Herbst zu einem gewaltigen Schauspiel: 80.000 Nonnengänse bevölkern die Wiesen, bis der Frühling kommt. Cuxhaven und die Weiten des Wattenmeeres sind bereits in Sichtweite. Dort mündet die Elbe, Europas wilder Strom, nach 1.100 Kilometern in die Nordsee. (Text: NDR) Elefanten hautnah: Giganten mit Gefühl
45 Min.Afrikas Elefanten sind Giganten und die größten Säugetiere, die über die Erde ziehen. Einst waren sie weit über den Kontinent verbreitet, doch die „Grauen Riesen“ werden immer seltener. Nur in Botsuana gilt ihr Bestand mit über 130.000 Tieren als gesichert, strengem Schutz und einer konsequenten Anti-Wilderei-Politik sei Dank. Elefanten sind majestätisch und kraftvoll, die Herrscher der Savanne. Ihr Gedächtnis ist sprichwörtlich: Ein Elefant vergisst nie, heißt es. Aber die Tiere sind auch einfühlsam, hilfsbereit und sanftmütig. Ihre Fähigkeiten sind erstaunlich: Wie kommunizieren Elefanten miteinander? Und warum tauchen sie wie auf ein geheimes Kommando zu Hunderten zeitgleich an bestimmten Orten auf? Monatelange Dürre, glühende Hitze und ein paar trockene Gräser.Um in der ausgedörrten Savanne zu überleben, legen Elefanten unglaubliche Strecken zurück. Dank ihrer hochsensiblen Sinne spüren sie über Kilometer entfernte Wasserstellen auf und wandern tagelang, um aus schlammigen Wasserstellen zu trinken. Ihre Intelligenz und der ausgeprägte Familiensinn, ihr starker Zusammenhalt und die Fähigkeit, über weite Distanzen miteinander zu kommunizieren, helfen ihnen beim Überleben. Afrikas Elefanten sind viel intelligenter als man je vermutet hätte. Bis heute geben die „Grauen Riesen“ der Menschheit Rätsel auf. Was weiß man tatsächlich über sie? Mehr als zwei Jahre lang reisten die vielfach ausgezeichneten Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen durch das südliche Afrika und waren den „Giganten mit Gefühl“ stets auf den Fersen. Mit dem Zweiteiler „Elefanten hautnah“ zeichnen die Autoren ein komplexes Bild der „Ikone Afrikas“ und geben intime Einblicke in das Leben der größten Landsäugetiere der Erde. (Text: NDR) Elefanten hautnah: Ungewöhnliche Nachbarn
Das Emsland – Niedersachsens wilder Westen
45 Min.Dort gibt es Deutschlands seltenste Tiere und die größten Moore Westeuropas: Das Emsland ist „Niedersachsens wilder Westen“. In keinem anderen Landkreis der Bundesrepublik Deutschland leben mehr Säugetierarten. Seine Vielfalt macht das Emsland so einzigartig: wilde Flüsse und weite Wälder, eingebettet in eine traditionelle Kulturlandschaft, die noch Platz lässt für Menschen und Tiere. Der Winter im Emsland ist mild: Scharen von Sing- und Zwergschwänen bevölkern die Ufer der Ems. Im Frühling scheint die Natur an Ems und ihrem wichtigsten Nebenfluss Hase zu explodieren.Biber und Europäische Nerze, die seltensten Säuger Deutschlands, leben hier neben winzigen Zwergmäusen und gnomenhaften Steinkäuzen. So bemerkenswert wie die Tierwelt sind auch die Menschen, die in diesem Landstrich mit und von der Natur leben, vom Kornbrenner bis zum alten Gutsherren, der seit Jahrzehnten die vom Aussterben bedrohten Bentheimer Landschafe züchtet. Die Landschafe passen zum Emsland, so bodenständig, genügsam und robust wie sie sind. Der Film begleitet die Natur des Emslandes im Jahresverlauf und gewährt hautnahe Einblicke in das Verhalten und Familienleben der heimischen Tiere: Winzige Fingerkameras zeigen die Kinderstube der Zwergmäuse, per Fernsteuerung gelingen Aufnahmen der Nerze und ihrer Jungen, Unterwasserkameras beobachten sie bei der Jagd auf Fische. Superzeitlupenaufnahmen von Schmetterlingen und Uferschwalben ermöglichen Bilder, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen bleiben. Mehr als zwei Jahre lang drehten die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke im Emsland; entstanden ist außergewöhnliches Naturporträt über Niedersachsens wilden Westen. (Text: NDR) Das Ende der Insekten? – Maria Furtwängler auf Spurensuche
45 Min.1969 hat Dr. Wulf Gatter die Forschungsstation am Randecker Maar gründet. Sie ist sein Lebenswerk.Bild: NDR/Doclights GmbHFür mich ist der Rückgang der Insektenvielfalt das weltweit besorgniserregendste Problem, dem wir uns stellen müssen“: Dr. Bodil Cass, Insektenforscherin aus Kalifornien. „Tatort“-Star Maria Furtwängler war schon immer ein glühender Insektenfan. Als Kind verbrachte sie ihre Sommer regelmäßig an den Seen Bayerns, rettete ertrinkende Bienen aus dem Wasser und baute ihnen kleine Krankenhäuser aus Blättern, um sie wiederzubeleben. Die Leidenschaft für die unscheinbaren Krabbeltiere ließ sie seither nicht mehr los. Heute besitzt die Hobby-Imkerin eine Reihe von Bienenstöcken, die sie das ganze Jahr über versorgt.„Durch das Imkern habe ich gelernt, welche Blüten Honigbienen am liebsten anfliegen und was Wildbienen oder Schmetterlinge besonders anzieht. Obwohl ich meinen Garten immer mehr danach ausgerichtet habe, ist auch hier offensichtlich, wie es Jahr um Jahr immer weniger Hummeln und Schwebfliegen gibt.“ Die Zahlen sind alarmierend: Von fast 600 Wildbienenarten in Deutschland ist die Hälfte in Gefahr, mindestens 60 einheimische Schmetterlingsarten sind bereits verschwunden und ein Drittel der Schwebfliegenarten Europas schwebt am Rande des Aussterbens. Insgesamt gelten 42 Prozent der heimischen Insektenarten als gefährdet, extrem selten oder bereits ausgestorben. Insekten sind die unscheinbaren Helden des Planeten. Sie bestäuben Nutzpflanzen, recyceln Abfälle und dienen als Nahrungsquelle für unzählige andere Tiere. Damit sind sie auch unverzichtbar für den Menschen. Doch in den letzten Jahrzehnten hat sich ihre Zahl dramatisch verringert. Warum? Das möchte Maria Furtwängler auf ihrer Spurensuche herausfinden. Dafür trifft sie Menschen aus Forschung und Agrarindustrie, Hersteller von Pflanzen- und Insektenschutzmitteln, ökologisch und konventionell arbeitende Landwirte vom Alten Land in Norddeutschland bis zur Schwäbischen Alb. In den USA wiederum ist alles XXL: die Größe der Felder, die damit einhergehenden Probleme, aber auch die Kreativität mit Hightechlösungen im von Robotern und Computern gesteuerten Pflanzenanbau. Kenntnisreich begibt sich die studierte Medizinerin Furtwängler als Anwältin der Insekten für „Erlebnis Erde“ auf eine aufrüttelnde Reise: „Was mich bei den Dreharbeiten am allermeisten berührt hat, ist, wie viele der Wissenschaftlerinnen und Experten von einem drohenden Kollaps der weltweiten Insektenpopulation sprechen. In dieser Deutlichkeit habe ich das vorher noch nicht gehört und mir auch nicht vorstellen wollen. (Text: NDR) Englands Wald der Könige
45 Min.Im Süden Englands liegt einer der ältesten Wälder Europas mit einer außergewöhnlichen Geschichte: Vor fast 1000 Jahren stellte König Wilhelm der Eroberer den New Forest für die Hirschjagd unter Schutz. Seither darf dort kein Ackerbau betrieben werden. Im Gegenzug dürfen die Anwohner ihr Vieh im Wald weiden lassen. Genau das prägt diesen Wald seit Jahrhunderten. Im Mittelpunkt der Naturdokumentation stehen die wohl bekanntesten tierischen Bewohner des Waldes: die New Forest Ponys. Sie leben das ganze Jahr über wild und frei in dem über 500 Quadratkilometer großen Gebiet.Der Film zeigt die ersten Lebensmonate eines Ponyfohlens und anderer Tierkinder in einer der artenreichsten Landschaften des Vereinigten Königreichs. Der New Forest ist eine besondere Landschaft, ein Mosaik lichter Wälder, ausgedehnter Heideflächen, durchzogen von einem Netzwerk von Sümpfen und Mooren. Füchse ziehen ihre Jungen unter Eichen groß, Habichte sind hierher zurückgekehrt und brüten in den Wipfeln hoher Bäume, die schon ausgestorbenen Zauneidechsen wurden wieder angesiedelt und über 30 Libellenarten fliegen über den Tümpeln. Besonders deutlich wird in dem Naturfilm die außergewöhnliche Rolle der Ponys für den New Forest, der längst Nationalpark ist: Gemeinsam mit Rindern, Hirschen und Schweinen, die im Herbst zur Eichelmast in den Wald getrieben werden, gestalten die kleinen Pferde als „Landschaftsarchitekten“ den New Forest. Dank dieser jahrhundertealten Tradition der Waldweide ist der historische Wald Vorbild: Auf diese Weise könnten auch in Zukunft naturnahe und artenreiche Landschaften mitten in Europa geschaffen und erhalten werden. (Text: NDR) Erdmännchen – Ein starkes Team
45 Min.Mehrere Erdmännchenfamilien müssen sich, einst als Haustiere ausgewildert in der Kalahari, Südafrika, bewähren. Sie kennen die Gefahren noch nicht, wissen nicht, wie sie sich gegenüber wilden Artgenossen verhalten müssen vor allem, wie sie zu einem echten Team zusammenwachsen können. Allein sind die Erdmännchen Räubern hilflos ausgeliefert. Deshalb müssen sie begreifen, wie Teamarbeit funktioniert. Und zwar schnell. Angeführt wird eine Erdmännchengruppe immer von einem erwachsenen Weibchen. Nur dieses paart sich mit dem ranghöchsten Männchen.Geschwister und erwachsene Kinder des Paares helfen bei der Welpenaufzucht und bei der Wache. Es stehen immer ein Tier oder gleich mehrere auf einem erhöhten Posten, halten nach Feinden Ausschau und warnen die anderen. Eine Gruppe hat es schon recht weit gebracht: Sie zieht bereits den zweiten Wurf in Freiheit auf. Doch das dominante Weibchen ist vom Pech verfolgt: Erst verliert es seinen Partner und ist allein auf die Hilfe der älteren Kinder angewiesen. Dann gräbt ein Honigdachs die Familie aus. Nur das Erdmännchenweibchen kann fliehen. Es hat all seine Kinder verloren. Wird es allein überleben können? Ein junges Männchen ist freiwillig allein losgezogen, typisch für rangniedere Tiere, die keine Chance haben, in ihrer Familie Nachwuchs zu bekommen. Immer wieder scheitert der Ausreißer bei dem Versuch, von einem wilden Erdmännchenclan aufgenommen zu werden. Doch ein junges Weibchen aus der Gruppe hat ein Auge auf ihn geworfen. Werden die beiden allerdings erwischt, werden sie vertrieben und ihre Jungen getötet. Sie müssen warten, bis die Luft rein ist. Ein weiteres ausgewildertes Paar hat einen ersten Wurf in Freiheit gut durch die ersten Wochen gebracht und ist nun dabei, den Kleinen beizubringen, wie man jagt. Eine besondere Herausforderung sind Skorpione. Gleich der erste Biss des Erdmännchens muss sitzen, um den Stachel abzubeißen. Wer das nicht schafft, riskiert, verletzt oder gar getötet zu werden. Besonders knifflig wird es, als eine Maulwurfsnatter in ihr Revier eindringt. Sie beißt blitzschnell zu. Nun müssen alle zusammen unter Beweis stellen, ob sie inzwischen zu einem starken Team geworden sind. (Text: NDR) Erdmännchen – Ein unschlagbares Team
45 Min.Die kleinen Erdmännchen sind völlig erschöpft von ihrem anstrengenden Erkundungsgang. Schon 12 Wochen nach ihrer Geburt werden sie sich selbst versorgen können.Bild: ZDF und NDR/NDR Naturfilm 2010Erdmännchen „ weltweit sind sie die absoluten Zuschauerlieblinge des Tierfilms. Sie leben in den Wüsten und Steppen des südlichen Afrikas, in einer Welt aus Sand und Stein. Über Jahrtausende haben sie sich perfekt an ihre lebensfeindliche Umgebung angepasst, ernähren sich von allem, was ihnen vor die spitzen Schnauzen gerät: Echsen, Skorpione, vor allem aber Käfer und andere Insekten. Doch auch sie selbst stehen auf dem Speisezettel zahlreicher Raubtiere wie Adler und Schakale. Nur ein ausgefeiltes System unterschiedlicher Alarmrufe sichert das Überleben der Familie. In der Wüste zählt vor allem eines: Teamarbeit, und die haben Erdmännchen perfektioniert.Den Rahmen dieser spannenden Tiergeschichte bilden die grandiose Landschaft Namibias und ihre reiche Tierwelt, darunter die seltenen Wüstenelefanten. Die Dickhäuter bilden zwar keine eigene Unterart, aber ihr Verhalten unterscheidet sich deutlich von dem ihrer Verwandten in der Savanne. Zwei Jahre folgten die Tierfilmer Telse Meyer und Dirk Blumenberg den Erdmännchen in der Wüste Namib und waren hautnah dabei, als die Jungen geboren wurden, erlebten ihre ersten Ausflüge unter den wachsamen Blicken der Eltern und die ersten tapsigen Jagdversuche. Sie wurden aber auch Zeuge dramatischer Situationen: Schakale bedrohten die Erdmännchenfamilie, und ein Weibchen der Gruppe wird von den anderen verstoßen. Extreme Dürre und die sintflutartigen Niederschläge der Regenzeit sind weitere Herausforderungen für die kleinen Kämpfernaturen. Am Ende überstehen sie alle Widrigkeiten und eine neue Generation Erdmännchen erblickt das Licht der Welt. Wieder wird sich die Gruppe um die Kleinen kümmern, sie vor Feinden beschützen und ihnen zeigen, wie man gemeinsam in der Wüste Namibias überlebt „ denn nur zusammen sind sie ein unschlagbares Team. Deutsche TV-Premiere Mo. 01.03.2010 Das Erste Erstmalige Ausstrahlung innerhalb der Reihe 'Expeditionen ins Tierreich': 11.05.2011 (NDR)Expedition Himalaja (1) – Auf der Fährte der Tiger
45 Min.Tiger: verehrt, gefürchtet und gnadenlos gejagt. In nur wenigen Jahrzehnten könnten sie für immer von der Erde verschwunden sein. Doch Großkatzenexperte und Artenschützer Alan Rabinowitz ist davon überzeugt, dass es Hoffnung für sie gibt. An den Südhängen des Himalajas könnten Tiger eine Chance haben, auch in Zukunft zu überleben. Eine internationale Expedition aus Wissenschaftler*innen und Tierfilmer*innen, darunter der Deutsche Henry Mix, macht sich auf den Weg in das lang verschlossene Königreich von Bhutan. Das Team will mithilfe von versteckten Kameras erste Filmaufnahmen von Tigern in diesem Gebiet machen und herausfinden, wie viele Tiger dort leben und vor allem wo. (Text: NDR)Expedition Himalaja (2) – Im Dschungel der Raubkatzen
45 Min.Tiger: verehrt, gefürchtet und gnadenlos gejagt. In nur wenigen Jahrzehnten könnten sie für immer von der Erde verschwunden sein. Doch Großkatzenexperte und Artenschützer Alan Rabinowitz ist davon überzeugt, dass es Hoffnung gibt. An den Südhängen des Himalajas könnten Tiger eine Chance haben, auch in Zukunft zu überleben. Eine internationale Expedition des NDR und der BBC aus Wissenschaftler*innen und Tierfilmer*innen, darunter der Deutsche Henry Mix, macht sich auf den Weg in das lang verschlossene Königreich von Bhutan. Die Regenwälder an der Grenze zu Indien zählen zu den artenreichsten der Erde.Das Team hat in der ersten Folge „Expedition Himalaja“ mithilfe von versteckten Kameras erste Filmaufnahmen von Tigern in dem Gebiet machen können. Die Suche wird ausgeweitet. Modernste Kameras kommen zum Einsatz, darunter neueste Nachtsichtgeräte, Infrarot- und Wärmebildkameras. Mithilfe dieser Technik wird die Nacht zum Tag, und das Team kann auch in kompletter Finsternis im Dschungel der Raubkatzen auf die Suche gehen. Tierfilmer Henry Mix und die englische Kamerafrau Justine Evans versuchen von einer Baumplattform aus ihr Glück. Aus 30 Meter Höhe haben sie freien Blick über eine Ebene. Werden sie dort endlich selber Tiger vor die Kamera bekommen? Fährtenleser Steve Backshell will ein Flusstal erkunden. Die Berghänge sind allerdings so steil, dass er nur mithilfe von Kajaks vorankommen kann. Ein gefährliches Unterfangen, da der Fluss nach der Schneeschmelze wild und unberechenbar ist. Wird sich die abenteuerliche Wildwassertour am Ende lohnen und Steve Tigerspuren finden? Wie die Teile eines Puzzles tragen die Mitglieder der Expedition Informationen zusammen, die dazu beitragen könnten, eine Tiger-Schutzzone zwischen Nepal und China einzurichten. Bhutan wäre innerhalb dieses Korridors das Herzstück. Nur wenn das gelingt, haben die charismatischen Großkatzen eine Zukunft. (Text: NDR) Faszinierende Flieger – Das Geheimnis der Zugvögel
- Alternativtitel: Zugvögel - Ein Jahr vergeht im Flug
45 Min.Der Vogelzug ist eines der größten Naturwunder der Erde. Er bringt die Menschen zum Staunen und regt die Fantasie an. Vogelzug steht für Freiheit, Weite, Aufbruch und Fernweh. Jahr für Jahr ziehen Milliarden Vögel um die Erde, fliegen dorthin, wo das Leben gut für sie ist. Der Vogelzug dient vor allem der Nahrungssuche. Um zu überleben, müssen Insektenfresser im Winter Richtung Süden fliegen. Sie kehren erst dann in ihre Brutgebiete zurück, wenn die Witterung für ein optimales Nahrungsangebot sorgt. Manche Arten sind rastlose Wanderer. Die Küstenseeschwalbe etwa ist ein Rekordhalter: Sie fliegt zwischen der Antarktis und der Arktis hin und her, genießt so immer den Sommer und findet stets ausreichend Nahrung.Auf ihren weiten Flugrouten navigieren Zugvögel, indem sie das Magnetfeld der Erde erspüren und sich am Sternenbild, aber auch an Landmarken wie Küstenlinien, Flüssen und Gebirgszügen orientieren. Für viele Zugvögel Europas ist der Neusiedler See in Österreich Drehkreuz auf ihrem Weg von und nach Afrika. Im Frühjahr ist er eine wichtige Station für Kampfläufer, die in Westafrika überwintert haben und nun in ihre arktischen Brutgebiete ziehen. Welche Routen sie genau wählen, erforschen Wissenschaftler, indem sie einzelne Vögel mit Sendern versehen. Auch die rote Felseninsel Helgoland ist ein Mekka für Ornithologen, denn dort rasten viele Vogelarten beim Überfliegen der Nordsee. Eine Gelegenheit, auch Steinschmätzer zu besendern, um herauszufinden, ob sie zum Brüten nach Grönland oder Skandinavien ziehen. Der Vogelzug hat viele Facetten: Etwa 90 Prozent der Brandgänse Europas verbringen den Sommer im Wattenmeer vor der Elbmündung. Sie suchen dort Schutz, um ihre Schwungfedern zu wechseln. Während dieser Zeit sind sie vollkommen flugunfähig. Der Film begleitet Zugvögel bis in die Savanne Namibias, die Tundra Norwegens, die Puszta Ostungarns und die Lagune von Venedig. (Text: NDR) Finnland – Bären, Elche, Riesenmarder
45 Min.Die Finnen nennen ihn „Felsenkatze“, denn er sieht aus wie ein kleiner Bär und hat mächtige Kiefer. Viele Mythen ranken sich um den Vielfraß, den größten Marder der Welt. Er lebt verborgen in Finnlands Wäldern, reißt Elch- und Rentierkälber und soll es sogar mit ausgewachsenen Braunbären und Elchen aufnehmen. Kaum einer bekommt ihn zu Gesicht. Naturfotograf Antti Leinonen konnte das Vertrauen der bärbeißigen Riesenmarder gewinnen, die seit vielen Jahren seine ganze Leidenschaft sind. Nur äußerst selten wagen sich die Bärenmarder, wie sie auch heißen, in die Nähe von Häusern. Sie verbringen ihr Leben als unwirsche Einzelgänger tief im Wald. Nur mit Zähigkeit, Ausdauer und ausgeklügelten Verstecken kann Antti Leinonen ihnen so dicht auf den Pelz rücken, dass ihm atemberaubende Aufnahmen gelingen.Bilder, die die hohen Ansprüche des „National Geographic“ erfüllen; mehrfach hat er bereits den ersten Preis des renommierten BBC Wildlife Fotowettbewerbs gewonnen. Antti Leinonen nimmt Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg mit in die finnische Taiga bei Kuhmo nahe der russischen Grenze und gewährt ihnen bislang ungefilmte Einblicke in das Leben der Riesenmarder. Erstmals gelingen für diese Tierdokumentation Aufnahmen und Verhaltensdokumentationen von ungezähmten Vielfraßen im Freiland. Entstanden ist ein Film, der selbst erfahrenen Freilandforschern zu neuen Erkenntnissen verhilft. (Text: NDR) Die fünf Geparde – Gemeinsam durch die Serengeti
Geparde sind die Hochgeschwindigkeitsjäger der Savanne. Nur wenige von ihnen wagen sich an größere Beutetiere. Doch manchmal zeigen sich die Raubkatzen von einer überraschend anderen Seite. In der nördlichen Serengeti tauchen fünf Männchen auf, die alles auf den Kopf stellen. Es ist das größte Bündnis, das jemals beobachtet wurde. Eine erfahrene Mutter bringt ihren Söhnen die letzten Feinheiten der Jagd bei, bevor sie den Nachwuchs in die Unabhängigkeit entlässt. Das Weibchen hat sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Geduldig wartet sie, bis die Gnus dicht genug bei ihr sind. Ein junges Weibchen steht vor ganz anderen Problemen – sie hat vier Junge zu versorgen. Die Kleinen müssen jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegen.Lange mustert die Mutter die Umgebung – doch die Löwin in den Büschen hat sie nicht bemerkt. Die Löwin beobachtet sie dagegen schon lange: Fleischfresser sind untereinander Konkurrenten. Die fünf Männchen beschatten nach mehreren erfolglosen Jagdversuchen eine Herde. Nachdem einer der Jäger gestartet ist, bricht unter den Gnus Panik aus. In diesem Chaos den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung für die Geparde. Ihr Opfer ist ein 200 Kilogramm schweres Gnu – Beute, die für ein einzelnes Männchen viel zu groß wäre. Jetzt zahlen sich die vielen Monate des gemeinsamen Trainings aus. Dem Tierfilmer Reinhard Radke gelangen in der nördlichen Masai Mara in Kenia Aufnahmen, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hat. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 30.10.2019 NDR Galapagos (1) Im Bann der Meeresströmungen
Mitten im Pazifik, etwa 1.000 Kilometer westlich des südamerikanischen Kontinents, liegt eine Gruppe von vulkanischen Inseln: der Galapagos-Archipel. Die Inseln gelten als Arche der Evolution. Nirgendwo sonst gibt es ein solch seltsames Sammelsurium an Tieren. Tauchende Echsen, Riesenschildkröten mit Schlangenhälsen und Albatrosse, die man sonst eher aus der Antarktis kennt. Das Geheimnis dieser Artenvielfalt liegt verborgen im Ozean. Zwei gewaltige Meeresströmungen haben die Galapagosinseln fest im Griff.Der eiskalte Humboldtstrom aus der Antarktis brachte Tiere nach Galapagos, die sonst nur in kalten Regionen vorkommen. Er dominiert die Vegetation in der einen Jahreshälfte, während in der anderen der tropisch warme Panamastrom die archaische Inselwelt beeinflusst und ebenfalls Tiere auf die abgeschiedene Inselwelt brachte. Alle sechs Monate wechseln sich diese gewaltigen Strömungen ab und stellen damit das Leben auf den Galapagosinseln regelrecht auf den Kopf! Tropische Ozeane sind für gewöhnlich nährstoffarm. Die Folgen sind meist ein großer Artenreichtum, aber nur kleine Fischbestände. Auf den Galapagosinseln ist alles anders: Wenn für sechs Monate im Jahr der Humboldtstrom aus der Antarktis bis nach Galapagos kommt, bringt er Unmengen von Nährstoffen mit sich. Das führt zu einem enormen Algenwachstum. Dieses Naturphänomen ernährt in dieser Periode riesige Fischschwärme und sucht in den Tropen seinesgleichen. Nur dank der Algen kann auf Galapagos die Meerechse überleben. Durch die Evolution wurde mit ihr das einzige Reptil der Erde erschaffen, das sich ausschließlich von Algen ernährt und danach tauchen kann. So sehr die Meeresbewohner vom Humboldtstrom profitieren, so stark bringt er die Landbewohner*innen an ihre Grenzen: Regen gibt es in dieser Zeit kaum. Das kalte Wasser des Stroms sorgt für eine seltsame Wetterlage. Nur auf den Vulkangipfeln der jüngeren Inseln gibt es Feuchtigkeit. Dort herrscht jetzt der Garua, ein Dauernebel. Die für Galapagos so typischen Riesenschildkröten machen sich nun auf eine gefahrvolle Wanderung in die nebligen Höhenlagen, um dort Nahrung zu finden. Nach sechs Monaten wendet sich das Blatt auf den Galapagosinseln: Der tropisch warme Panamastrom bringt Regen satt. Finken, Riesenschildkröten, Landleguane und Galapagos-Bienen finden nun Nahrung im Überfluss. Den Meeresbewohnern hingegen ergeht es ganz anders, denn mit dem Panamastrom kehren wieder tropische Bedingungen in die Unterwasserwelt zurück. Die meisten Fischarten ziehen wieder ab, denn ohne Nährstoffe fehlen die Algen. Ein Großteil der Meeresbewohner kann jedoch nicht einfach vor dem Einfluss des Panamastroms fliehen. Die Meerechsen trifft ein hartes Los, denn ihre bevorzugte Nahrung, die Algen, sind nun Mangelware. Zudem bringt die gewaltige Brandung die geschwächten Echsen ans absolute Limit ihrer Kraft. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Dem Bann der Meeresströmungen kann sich auf den Galapagosinseln keiner entziehen, weder Mensch und Tier an Land noch Meerestiere. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 08.11.2017 NDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail