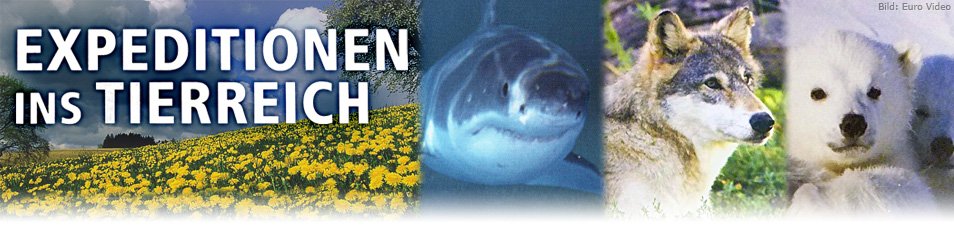unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 4)
Galapagos (2) Zwischen Himmel und Hölle
Galapagos ist ein kleiner Archipel mitten im Pazifik. Der vulkanische Ursprung, die überwiegend geringe Vegetation und die für die Tropen extremen klimatischen Bedingungen machen ein Überleben auf diesen Inseln zu einer Herausforderung. Allen Umständen zum Trotz gibt es gerade hier viele der wohl ungewöhnlichsten Tiere der Erde. Der Engländer Charles Darwin beobachtete sie und konnte dadurch seine Evolutionstheorie entwickeln. Heute weiß man, warum es gerade auf Galapagos so viele seltsame Tiere gibt. Sie kamen aber keineswegs freiwillig, die meisten von ihnen sind „Schiffbrüchige“ und wurden durch Stürme oder starke Meeresströmungen dorthin gebracht.So brachte der aus der Antarktis kommende Humboldtstrom Pinguine bis nach Galapagos. Über die Jahrtausende hat sich deren Körperbau verändert, damit sie auf den Inseln überleben konnten. Heute ist der Galapagos-Pinguin nicht nur der einzige Pinguin, der in den Tropen überleben kann, er ist auch die kleinste Pinguinart überhaupt. Kaum größer als eine Ente, ist er nur durch diese Minimalisierung seiner Größe in der Lage, den tropischen Temperaturen zu trotzen. Eine solche Meisterleistung ist der Evolution auch beim Galapagos-Kormoran gelungen: Während andere Kormorane oft große Strecken fliegen, um Fische zu entdecken, verlor der Galapagos-Kormoran diese Fähigkeit komplett. Nicht nur weil er die Nahrung in Galapagos direkt vor der Haustür findet, sondern vor allem weil es keine Feinde gibt, vor denen man fliehen müsste. Heute hat der Galapagos-Kormoran nur noch Stummelflügel, mit denen er nicht fliegen kann. Doch diese Entwicklung geschah nicht ohne Grund: Die fehlenden Flügel machen ihn unter Wasser extrem stromlinienförmig. Zudem wurde er immer kräftiger und größer, um länger und tiefer nach Fischen tauchen zu können. Heute ist der Galapagos-Kormoran der größte Kormoran der Welt. Für alle Tiere auf den Galapagosinseln waren darüber hinaus Verhaltensanpassungen ein weiterer wichtiger Schritt, um auf den Vulkaninseln überleben zu können. Kaum ein Tier zeigt das eindrucksvoller als der Vampirfink. Er kommt ausschließlich auf den Inseln Darwin und Wolf vor. Mehr als 100 Kilometer von allen anderen Inseln des Archipels entfernt, gibt es auf den Miniinseln kein Wasser und kaum Nahrung. Der Vampirfink musste erfinderisch sein: Mit seinem skalpellartigen Schnabel öffnet er die Haut an den Federkielen der Nazca-Tölpel und trinkt ihr Blut. Dabei ist er so geschickt und vorsichtig, dass das Opfer nicht die Flucht ergreift. Nur manchmal, wenn zu viele Vampirfinken durstig sind, kommt es zum Blutrausch. Die meisten Bewohner der Galapagosinseln sind heute so extrem an die Bedingungen auf dieser isolierten Inselwelt angepasst, dass sie nirgendwo sonst überleben könnten. Für sie ist der Galapagos-Archipel ein zwiespältiger Ort: Manchmal leben sie wie im Himmel, manchmal nahezu in der Hölle. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 15.11.2017 NDR Das geheime Leben der Rothirsche
45 Min.Er gilt als der „König der Wälder“: der Rothirsch, ein Mythos! Oft schon wurde er gefilmt, meist als liebestoller, röhrender Brunfthirsch, der im Herbst um die Weibchen kämpft. Wie die Art aber den Rest des Jahres „tickt“, wird oft übersehen. Während der Brunft ist ein Platzhirsch stark, gibt an, präsentiert sich und schreit sich fast die Seele aus dem Hals. Ein richtiger Macho eben! Sein ganzes Streben ist nur auf das weibliche Geschlecht fixiert. Am Ende der Paarungszeit ist er im wahrsten Sinne des Wortes abgekämpft und muss den Rest des Jahres extremen Aufwand betreiben, um die körperlichen Reserven wieder aufzufüllen. In den kommenden Monaten ziehen die männlichen Tiere in Junggesellenrudeln umher und haben nur Fressen im Sinn.Ihre Nachkommen und die Weibchen interessieren sie kaum. Auch die Hirschkühe leben zunächst in Rudeln. Ende Mai vertreiben sie den Nachwuchs aus dem Vorjahr und bringen im Verborgenen ihre Jungen zur Welt. Anschließend führen sie ihre Kälber an versteckte Spielplätze und beschützen sie vor drohenden Gefahren. Ehe ein Hirschkalb die Chance bekommt, ein Platzhirsch zu werden, vergehen mindestens fünf Jahre, eine Zeit, die aufregende Begegnungen und entspannte Momente mit sich bringt. Rothirsche sind keine langweiligen Wiederkäuer. Versteckte Kameras an Suhlen oder anderen „Rendezvous-Plätzen“ geben ungewöhnliche und seltene Einblicke in das geheime Leben der Rothirsche. (Text: NDR) Geheimnisvoller Garten (1): Frühlingserwachen
45 Min.Ein wunderschöner Garten galt schon immer als Abbild des Paradieses, das bezeichnenderweise auch „Garten Eden“ genannt wird. Nicht allein die Natur führt hier Regie, sondern auch der Mensch. Er schafft sich in einem Garten seine eigene Welt voller betörender Formen, Farben und Düfte. Aber auch jede Menge Pflanzen und Tiere, von denen man wenig weiß oder manchmal auch gar nichts wissen will, siedeln sich dort an. Die Natur prasst gerade in einem Garten nahezu verschwenderisch mit Farben und Formen. Aber nichts wird wirklich verschwendet.In der Natur wird alles wiederverwertet. Zum Beispiel das leere Schneckenhäuschen, das eine seltene Mauerbiene als Gehäuse für ihre Bienenlarve ausbaut. Im Garten leben noch viel mehr Tiere, die kaum einer kennt. Das Mauswiesel, das kleinste Raubtier der Welt, macht Jagd auf lästige Wühlmäuse. Ebenso der Turmfalke, der mancherorts unter dem Dachfirst nistet. Die Kohlmeise verfüttert an die Jungen einer einzigen Brut etwa 10.000 Raupen. Ein Garten ohne tierische Helfer ist also undenkbar. Allein der Komposthaufen, auf dem die Küchenabfälle entsorgt werden, ist ein Ort, an dem es vor Leben nur so wimmelt. Aber neben all diesen Nützlingen sind Gärten auch Refugien für viele seltene und sogar bedrohte Tiere. Kuriose Hummelschweber, prächtige Zauneidechsen, anmutige Schmetterlinge oder einige Zugvögel haben in naturnahen Gärten ein Zuhause gefunden. Diese Vielfalt zeigt die erste Folge des Zweiteilers „Geheimnisvoller Garten“ dank neuester Technik in außergewöhnlichen Bildern, die so noch nie zu sehen waren. (Text: NDR) Geheimnisvoller Garten (2): Erntezeit
45 Min.Seit über 5.000 Jahren werden vom Menschen Gärten angelegt. Zunächst waren es reine Nutzgärten. Dort wurde angepflanzt, was man für die tägliche Ernährung brauchte. Aber schon die alten Römer kultivierten Pflanzen allein wegen ihrer Schönheit. So wurde der Nutzgarten allmählich zum Ziergarten. Schönheit und Nutzen sind im Garten oft zwei Seiten derselben Medaille. Ein Obstbaum etwa produziert jedes Jahr im Frühling Abertausende Blüten und trägt später ein paar Hundert Äpfel. Die werden im Herbst von einer Vielzahl von Tieren erwartet, wie etwa den Igeln und Wachholderdrosseln.Allein in Deutschland gibt es Millionen von Gärten. Viele von ihnen bieten zahllosen Lebewesen eine Zuflucht: Singvögeln, Siebenschläfern und seltenen Reptilien etwa. Und nicht wenige der Gartenbewohner sind Verbündete des Gärtners im Kampf gegen Schädlinge. Feldwespen zum Beispiel vertilgen unzählige Schadinsekten. Wenn das Nest in Ruhe gelassen wird, fangen und töten Feldwespen im Laufe eines Sommers mehrere Hundert Raupen, um sie an ihre Brut zu verfüttern. Auch die von vielen Gärtnern gehegten Rosen haben einen natürlichen Helfer im Kampf gegen Blattläuse. Wo keine Gartengifte zum Einsatz kommen, fühlen sich Marienkäfer wohl. Jeder einzelne davon verschlingt in einem Sommer bis zu 10.000 Blattläuse. Die letzte Folge des Zweiteilers „Geheimnisvoller Garten“ folgt den großen und kleinen Dramen vom Sommer über den Winter bis zum erneuten Frühlingserwachen und zeigt auf spannende Weise, wie die verschiedenen Arten in heimischen Gärten zusammenleben. Und warum es gut und wichtig ist, wenn man der Natur im Garten etwas mehr Raum gibt. (Text: NDR) Geheimnisvoller Garten: Erntezeit
45 Min.Seit über 5000 Jahren werden vom Menschen Gärten angelegt. Zunächst waren es reine Nutzgärten. Dort wurde angepflanzt, was man für die tägliche Ernährung brauchte. Aber schon die alten Römer kultivierten Pflanzen allein wegen ihrer Schönheit. So wurde der Nutzgarten allmählich zum Ziergarten. Schönheit und Nutzen sind im Garten oft zwei Seiten derselben Medaille. Ein Obstbaum etwa produziert jedes Jahr im Frühling Abertausende Blüten und trägt später ein paar Hundert Äpfel. Die werden im Herbst von einer Vielzahl von Tieren erwartet wie etwa den Igeln und Wacholderdrosseln.Allein in Deutschland gibt es Millionen von Gärten. Viele von ihnen bieten zahllosen Lebewesen eine Zuflucht: Singvögeln, Siebenschläfern und seltenen Reptilien etwa. Und nicht wenige der Gartenbewohner sind Verbündete des Gärtners im Kampf gegen Schädlinge. Feldwespen zum Beispiel vertilgen unzählige Schadinsekten. Wenn das Nest in Ruhe gelassen wird, fangen und töten Feldwespen im Laufe eines Sommers mehrere Hundert Raupen, um sie an ihre Brut zu verfüttern. Auch die von vielen Gärtner*innen gehegten Rosen haben einen natürlichen Helfer im Kampf gegen Blattläuse. Wo keine Gartengifte zum Einsatz kommen, fühlen sich Marienkäfer wohl. Jeder einzelne davon verschlingt in einem Sommer bis zu 10.000 Blattläuse. Die letzte Folge des Zweiteilers „Geheimnisvoller Garten“ folgt den großen und kleinen Dramen vom Sommer über den Winter bis zum erneuten Frühlingserwachen und zeigt auf spannende Weise, wie die verschiedenen Arten in heimischen Gärten zusammenleben. Und warum es gut und wichtig ist, wenn man der Natur im Garten etwas mehr Raum gibt. (Text: NDR) Geheimnisvoller Garten: Frühlingserwachen
45 Min.Ein wunderschöner Garten galt schon immer als Abbild des Paradieses, das bezeichnenderweise auch „Garten Eden“ genannt wird. Nicht allein die Natur führt hier Regie, sondern auch der Mensch. Er schafft sich in einem Garten seine eigene Welt voller betörender Formen, Farben und Düfte. Aber auch jede Menge Pflanzen und Tiere, von denen man wenig weiß oder manchmal auch gar nichts wissen will, siedeln sich dort an. Die Natur prasst im Frühjahr in einem Garten nahezu verschwenderisch mit Farben und Formen. Aber nichts wird wirklich verschwendet.In der Natur wird alles wiederverwertet. Zum Beispiel das leere Schneckenhäuschen, das eine seltene Mauerbiene als Gehäuse für ihre Bienenlarve ausbaut. Im Garten leben noch viel mehr Tiere, die kaum einer kennt. Das Mauswiesel, das kleinste Raubtier der Welt, macht Jagd auf lästige Wühlmäuse. Ebenso der Turmfalke, der mancherorts unter dem Dachfirst nistet. Die Kohlmeise verfüttert an die Jungen einer einzigen Brut etwa 10.000 Raupen. Ein Garten ohne tierische Helfer ist also undenkbar. Allein der Komposthaufen, auf dem die Küchenabfälle entsorgt werden, ist ein Ort, an dem es vor Leben nur so wimmelt. Aber neben all diesen Nützlingen sind Gärten auch Refugien für viele seltene und sogar bedrohte Tiere. Kuriose Hummelschweber, prächtige Zauneidechsen, anmutige Schmetterlinge oder einige Zugvögel haben in naturnahen Gärten ein Zuhause gefunden. Diese Vielfalt zeigt die erste Folge des Zweiteilers „Geheimnisvoller Garten“ dank ausgereifter Technik in außergewöhnlichen Bildern, die so zuvor noch nicht zu sehen waren. (Text: NDR) Geheimnisvolles Mittelmeer: Von Berberaffen und Feuerfischen
45 Min.Deutsche TV-Premiere Mi. 12.12.2018 NDR Geheimnisvolle Welten – Nachts in Dschungel und Pampa
45 Min.Ein internationales Team aus Biologen und Naturfilmern, darunter die Biologin Susanne Seltmann und der Max-Planck-Wissenschaftler Bryson Voirin, will die Geheimnisse nachtaktiver Tiere lüften. Mithilfe von neuartigen Nachtsichtgeräten und Spezialkameras spüren die Forscher den Tieren nach. Die Expedition führt das Team durch Mittel- und Südamerika, vom tropischen Dschungel Costa Ricas über die überschwemmten Wälder Amazoniens bis in die schroffe Bergwelt Patagoniens. Ihr Ziel ist es herauszufinden, warum die Tiere nachts statt tagsüber aktiv sind und wie sie sich in der Dunkelheit orientieren. (Text: Phoenix)Geister der Arktis – Eishaie und Narwale
45 Min.NORDDEUTSCHER RUNDFUNK: „Geister der Arktis – Eishaie“ – Unterwasserkamerafrau und Tierfilmerin Christina Karliczek ist in Grönland auf der Spur der faszinierenden Eishaie.Bild: NDR/DOCLIGHTS GMBH/BLACK CORAL FILMS AB/Uli KunzDie preisgekrönte Naturfilmerin und Extremtaucherin Christina Karliczek Skoglund begibt sich auf eine waghalsige Expedition in die Tiefen der Arktis. Ihre Suche gilt zwei ganz besonderen Bewohnern der Polarwelt: den Narwalen, den legendären „Einhörnern des Meeres“, und den uralten Grönlandhaien. Die Tiere mit dem eigenwilligen Stoßzahn haben schon die Menschen im Mittelalter in den Bann gezogen. Das „Horn“ der Narwale war einst so kostbar, dass es mit Gold aufgewogen wurde. Narwale leben das ganze Jahr über in Packeisnähe und sind durch den Klimawandel inzwischen extrem bedroht.Mithilfe der Inuit stößt Christina immer weiter ins nördliche Grönland vor, um die letzten ihrer Art zu finden. Die Tiere unter Wasser zu erleben, ist ein langgehegter Traum von ihr. Dass die Mutter von zwei Kindern dafür ihr Leben riskiert, wird ihr einmal mehr auf der Reise bewusst. Die geheimnisvollen Grönlandhaie werden auch Eishaie genannt. Forscher rückten im Jahr 2016 die Riesen der Meere in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Der Biologe Dr. Julius Nielsen und sein Team fanden heraus, dass der älteste von ihnen gefundene Hai unglaubliche 272 bis 512 Jahre alt sein könnte. Zudem gehen sie davon aus, dass weibliche Tiere vermutlich erst ab einem Alter von 150 Jahren Nachwuchs bekommen können. Eishaie sind neben Schwämmen damit vermutlich die ältesten Tiere der Erde. Ihr Leben verbringen sie vor allem in tiefer See. An die Oberfläche kommen sie, wenn sie Beute riechen. Mit bis zu fünfeinhalb Metern Länge können Eishaie auch Robben erbeuten und sind keineswegs immer so träge wie sie scheinen. Christina möchte nicht nur mit einem der „Methusalems der Meere“ tauchen, sondern aus erster Hand mehr über sie erfahren. Dazu spricht sie mit den führenden Eishaiforschern über ihre bahnbrechenden neuen Entdeckungen: Die Meeresbiologin Dr. Brynn Devine ließ mit ihrem Team Kameras in die Tiefen der kanadischen Arktis hinab. Sie konnte mehr als 250 Stunden einzigartiges Videomaterial aufzeichnen, und das an 31 Standorten. Christina trifft außerdem den Biologen Dr. Julius Nielsen in Kopenhagen. Er möchte eine Grundlage schaffen, um die faszinierenden Meeresbewohner effektiver davor zu schützen, als Beifang zu enden. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Suche nach den bisher unbekannten Geburtsstätten der Eishaie. Neugeborene werden äußerst selten entdeckt. Wie kann das sein? Am Ende gelingt es Christina, mit einem dieser gespenstischen Riesenwesen hautnah zu tauchen. Ein magisches und seltenes Erlebnis. (Text: NDR) Geisterkatzen: In den Bergen der Pumas
45 Min.Giganten im Mittelmeer – Pottwalen auf der Spur
Etwa 200 Pottwale leben heute noch im westlichen Mittelmeer (2009) – sie zu finden ähnelt der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Mit Unterwasser-Mikrofonen gelingt es, die Pottwale zu orten. Doch Pottwale im Mittelmeer zu filmen, wird für Thomas Behrend und sein Team zur Herausforderung. Pottwale sind die größten Raubtiere der Erde. Sie jagen in den Tiefen der Ozeane und im Mittelmeer. Erst seit einigen Jahren erforscht der griechische Wissenschaftler Alexandros Frantzis die isolierte Population, Filmaufnahmen gibt es kaum. Gemeinsam mit dem deutschen Tierfilmer Thomas Behrend bricht er in die Gewässer vor Griechenland auf, um die heimlichen Giganten zu filmen.Mit Unterwasser-Mikrofonen gelingt es, die Pottwale zu orten. Es ist schwierig, aber schließlich gelingt es Behrend, Zusammenkünfte von Pottwal-Weibchen zu filmen – einzigartige Bilder entstehen, die selbst den langjährigen Unterwasser-Kameramann berühren. Doch als er sich einer scheinbar friedlichen Gruppe im Wasser nähert, geschieht das Unfassbare: Die mächtigen Wale versuchen plötzlich, ihn zu vertreiben. Behrend schwimmt mit aller Kraft zurück – ein einziger Flossenschlag könnte ihn töten. Was dann folgt, werden Behrend und Frantzis nie in ihrem Leben vergessen: Mit atemberaubenden Aufnahmen dokumentiert dieser Film Verhaltensweisen von den seltenen Pottwalen. (Text: BR Fernsehen) Gorillas hautnah
45 Min.In den entlegenen Regenwäldern von Gabun in Zentralafrika verfolgt Wissenschaftlerin Martha Robbins ein außergewöhnliches Ziel: Sie erforscht das Leben Westlicher Flachlandgorillas in freier Wildbahn. In einer der letzten nahezu unberührten Regionen Afrikas wird ein Gorillababy geboren: Diese ungewöhnliche Dokumentation verfolgt das erste Jahr des kleinen Westlichen Flachlandgorillas und zeigt in intimen Bildern das Leben seiner Familie im Loango Nationalpark Gabuns, direkt an der Atlantikküste. Eine Vielzahl von Wildtieren, Waldelefanten, Rotbüffel und die wohl buntesten Schweine der Welt, kommt hier regelmäßig aus dem Regenwald an die über 100 Kilometer langen Traumstrände.Die scheuen Gorillas der sogenannten Atananga-Gruppe bleiben meist im Dickicht des Waldes. Ihr Anführer ist der starke Silberrücken Kamaya, der Vater des Neugeborenen. Die Primatenforscherin Martha Robbins und ihr Team vom renommierten Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben über viele Jahre hinweg das Vertrauen der großen und scheuen Menschenaffen in einem für die Wissenschaftler herausfordernden Lebensraum erlangt. Um zu den Gorillas zu kommen, müssen sie täglich durch Mangroven und Sümpfe waten. Ihre Ausdauer und Geduld haben diesen einzigartigen Film ermöglicht. Darin wird erstmals das Sozialverhalten der großen Menschenaffen in freier Wildbahn dokumentiert, die aus Zoos bekannt sind. Sie unterscheiden sich jedoch stark von den Berggorillas aus Ostafrika, ihren nahen Verwandten. Auch diese Art erforscht Martha Robbins seit Jahrzehnten. Das Ergebnis ist eine ungewöhnlich nahe und spannende Mischung aus Blue-Chip-Naturdokumentation, Abenteuer, Expedition und aktueller Forschung und zeigt, wie wenig Wissen über die nahen und doch so bedrohten Verwandten des Menschen vorhanden ist. (Text: NDR) Die größten Flüsse der Erde – Der Amazonas
45 Min.Als Strom der Superlative durchquert der Amazonas beinahe auf 7.000 Kilometern Länge den südamerikanischen Kontinent. Zehntausende von Zubringern speisen das größte Flusssystem der Erde, ein gigantisches Netz. Allein der Hauptstrom hat über 1.000 Seitenarme, 17 davon sind länger als der Rhein. Der Amazonas führt ein Fünftel des gesamten Süßwassers und nährt den größten Regenwald der Erde. Ein artenreiches Universum voller skurriler Kreaturen: das stinkende Schopfhuhn, auch Hoatzin genannt, dessen Küken an den Urvogel Archaeopteryx erinnern.Der rosafarbene Flussdelfin. Oder Boto, der in der Regenzeit durch die Wipfel des amazonischen Waldes schwimmt, wo ansonsten Vögel nisten. Hier leben gesellige Riesenotter, alleinerziehende Kolibrimütter, giftige Froschväter, die ihren Nachwuchs huckepack in die Bäume tragen, und bunte Aras, die Tagebau betreiben. Einmal im Jahr ist Land unter, Waldflächen doppelt so groß wie Deutschland stehen dann mehrere Monate lang zehn, 15 Meter unter Wasser. Bis heute hat der Amazonas eine Fülle an Geheimnissen bewahrt: 3.000 Fischarten sind bereits bekannt, ständig werden neue entdeckt. Die Dokumentation zeigt erstmals das mutige Familienleben eines bislang unbekannten Buntbarsches. Erst vor wenigen Jahren wurde ein siedender Fluss erforscht, von dem bereits spanische Eroberer erzählten. Über sechs Kilometer schlängelt er sich brodelnd durch den Urwald, so heiß, dass Tiere, die hineinfallen, bei lebendigem Leib gekocht werden. Die größte Sensation lauert vor der Mündung, wo der Amazonas sekündlich die Menge Wasser in den Atlantik schüttet, die dem Volumen von einer Million gefüllten Badewannen entspricht. Niemand ahnte bis vor Kurzem, dass unter dem schlammigen Wasser des gewaltigen Stroms ein großes Riff existiert. Dieses wurde erst jüngst entdeckt, ein 1.000 Kilometer langes Riff voller gigantischer Schwämme, aufgebaut aus kalkproduzierenden Algen. Erstmals zeigt diese Dokumentation die wissenschaftliche Sensation, ein völlig neues, bislang unbekanntes Ökosystem, gespeist vom mächtigsten Fluss der Erde. Die aufwendige BBC-Dokumentation begleitet den Strom der Ströme von seinem Ursprung in den Gletschern der Anden bis zur Mündung im Atlantik. (Text: NDR) Die größten Flüsse der Erde – Der Mississippi
45 Min.Der Mississippi wird von einem gewaltigen Netz an Quell- und Nebenflüssen gespeist. Die Flüsse durchziehen die USA von den Rocky Mountains im Westen bis zum Gebirgszug der Appalachen ganz im Osten. Aus fast der Hälfte der Fläche der Vereinigten Staaten fließt das Wasser komplett schließlich in den Mississippi und dann Richtung Süden in den Golf von Mexiko. Seinen Ursprung hat der riesige Mississippi in schmalen, oft wenig bekannten Quellflüssen in den Ausläufern der Rockies. Hier dauert der Winter oft fünf Monate. Dann sind Milliarden Tonnen Wasser zu Eis und Schnee erstarrt und bis zum Frühling gefangen, bis die Schmelze beginnt.Der Filmemacher Simon Blakeney erzählt in dieser aufwendigen BBC-Produktion die Geschichte dieser so vielseitigen Lebensader der Vereinigten Staaten in einmaligen Bildern und schildert die spannendsten Geschichten der Welt des Mississippi atmosphärisch dicht, anrührend und spannend. Die Reise beginnt am Ufer des Gallatin River. Allerdings sieht man jetzt diesen kleinen Quellfluss des Missouri, der später in den Mississippi mündet, gar nicht: Seine Eisfläche verschwindet im Weiß des Schnees. Nur die Fischotter wissen ganz genau, wo hier noch offenes Wasser ist. Sie brauchen Löcher in der Eisdecke, um Beute machen zu können. Die Kojoten im Yellowstone Nationalpark haben es da besser: Hier sorgen die heißen Fontänen der Geysire dafür, dass der Madison River selbst bei minus 40 Grad eisfrei bleibt. Auch der Madison ist ein Quellfluss des Missouri und indirekt damit ein Quellfluss des Mississippi. Auch er lässt bald die Hügellandschaft der Vorgebirge hinter sich und fließt durch die Prärien in den großen Ebenen. Wenn bei St. Louis der Missouri River in den Mississippi fließt, wird der Fluss zum Strom: Ein träger, schlammbrauner Goliath, der zur Speisekammer der USA wird. Auf seinem breiten Rücken werden Millionen Tonnen Güter in Richtung New Orleans und von dort in die ganze Welt befördert. Bald beginnen die Sümpfe des Südens, in denen sich der Strom in einem Labyrinth aus Wasserwegen, Inseln, Buchten und Feuchtgebieten zu verlieren scheint. Sie sind die Heimat von 270 Vogelarten und rund 65 Amphibien- und Reptilienarten. Dieser letzte Abschnitt des Flusses ist weltberühmt: das Tor zum tiefen Süden der USA. In New Orleans liegen der wichtigste Hafen der westlichen Hemisphäre und das gewaltige Mississippi-Delta mit seinen Geheimnissen und allen heutigen Problemen. (Text: NDR) Die größten Flüsse der Erde – Der Nil
45 Min.Mit über 6.800 Kilometern Länge gehört der Nil zu den Giganten. Sein Weg führt durch ganz Nordafrika, vom Äquator bis zum Mittelmeer – eine Reise durch einige der letzten ungezähmten Landschaften des Kontinents. Um den Rang des weltweit längsten Flusses wetteifert der Nil mit dem Amazonas – je nach Art der Definition. Eines steht fest: Mit über 6.800 Kilometern Länge gehört er zu den Giganten. Sein Weg führt durch ganz Nordafrika vom Äquator bis zum Mittelmeer. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts ist bekannt, dass der Fluss aus einer Vielzahl von Oberläufen gebildet wird.Sie entspringen in den Bergen Ruandas und der legendären Mondberge in West-Uganda. Am Fuße dieser Berge lebt der seltene Schuhschnabel. Der clevere Vogel tritt in die großen Fußstapfen von Nilpferden, um sich seinen Weg durch schwimmende Papyrusinseln zu bahnen. Unterhalb der Murchison-Fälle sammeln sich die größten Krokodile Afrikas, um tote Fische aufzusammeln. Eine Krokodilmutter jedoch fastet schon seit zwei Monaten. Aufopfernd bewacht sie ihr Gelege im Sand vor Eierdieben. Im Süd-Sudan verliert sich der Nil in einem riesigen Sumpf. Zur Regenzeit ist der Sudd größer als Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Durch dieses Meer aus Wasserpflanzen gab es jahrhundertelang kein Durchkommen – deshalb blieben die Nilquellen so lange ein Geheimnis. Für Elefanten ist es ein Paradies – hierhin kann ihnen kein Wilderer folgen. Ausgelaugt von der Verdunstung im Sudd hätte der Fluss keine Chance, die letzte Etappe durch die Sahara bis zum Mittelmeer zu schaffen. Doch in Karthum, der Hauptstadt des Sudan, bekommt er Verstärkung: Nach 1.700 Kilometern vereinigt sich der Blaue Nil mit dem Weißen Nil. Gemeinsam ziehen sie sich wie ein schmales blaues Band durch die endlosen Sanddünen – das einzige Wasser weit und breit. Ohne den Nil hätten die alten Ägypter ihr Imperium nicht errichten können, ohne ihn könnte heute Kairo, die 20-Millionen-Stadt, nicht florieren. Schließlich endet die Reise des gewaltigen Stroms im Mittelmeer. Der Nil, der einst als Rinnsal begann, tritt nun endgültig ein in den großen Kreislauf des Wassers. (Text: NDR) Die größten Wasserfälle der Erde – Naturwunder Iguacu
45 Min.Im Grenzland von Argentinien und Brasilien liegen sie wie ein Juwel eingebettet im undurchdringlichen Regenwald: die Wasserfälle von Iguaçu. Sie sind die größten der Erde, breiter als die Victoriafälle und höher als die berühmten Niagarafälle. Über eine Breite von rund 2.700 Metern stürzen die Wassermassen mit ohrenbetäubendem Lärm bis zu 80 Meter in die Tiefe. Feiner Sprühnebel steigt über dem tosenden Spektakel auf, Sonnenlicht und schillernde Regenbögen tauchen die Szenerie in ein unwirkliches Licht. In atemberaubenden Bildern porträtiert Filmemacher Christian Baumeister die wohl schönsten Wasserfälle der Erde.Die Katarakte sind mehr als ein beeindruckendes Naturschauspiel: Das „große Wasser“, wie sie die Guarani-Indianer nennen, ist eindrucksvolle Kulisse für eine Vielzahl von Tieren. Hinter dem Vorhang aus Wasser brüten elegante Rußsegler im Fels, ein scheinbar sicherer Ort, einzig bedroht durch die Hochwasser während der Regenzeit. Wo sich der Dunst der Wasserfälle über den Urwald legt, bringen Nasenbären in selbst gebauten Baumnestern ihren Nachwuchs zur Welt. Auch ihnen folgt Christian Baumeister und berichtet von ihren ersten, tollpatschigen Kletterversuchen, Begegnungen mit giftigen Schlangen oder Spielen in den Baumkronen. Doch das Paradies Iguaçu ist bedroht. Immer häufiger zieht es Wilderer in den Nationalpark. In riskanten Aktionen stellen die Parkranger den illegalen Jägern nach. Daneben versuchen Biologen alles, um die letzten Jaguare und Kaimane zu schützen oder verschollene Riesenotter aufzuspüren. Der Film zeichnet ein beeindruckendes Porträt von einer der schönsten Regionen der Erde und berichtet von der Tierwelt und den Menschen, die sich dem Schutz der einzigartigen Wasserfälle und des Nationalparks von Iguaçu verschrieben haben. (Text: NDR) Der große Kaukasus
45 Min.Im unmittelbaren Hinterland von Sotschi, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2014, ist ein beeindruckender Naturfilm entstanden: die letzten Bergwisente, Kaukasische Steinböcke, schroffe Gipfel und extreme Wetterschwankungen. Die Bergwelten des Kaukasus markieren eine magische Grenze zwischen Europa und Asien. Über ein Jahr hat Filmemacher Henry M. Mix mit seinem Team in Russlands höchstem Gebirge verbracht. Entstanden ist eine eindrucksvolle Dokumentation über die Naturwunder zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer.Die wilde Berglandschaft mit ihrem extremen Klima hat eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt geformt. Sie macht den Kaukasus zu einem der weltweit 25 bedeutendsten Zentren biologischer Vielfalt. Bergwisent, Kaukasuskönigshuhn und kaukasischer Tur sind nur hier zu finden. Im Regenschatten des schneereichen Hauptkammes leben Saiga-Antilopen, Ohrenigel und Schlangenadler. Im Westen des Gebirgszuges sind die einst ausgerotteten Bergwisente zu Hause. Mühsam, über Jahrzehnte hinweg, wurde der heutige Wildbestand aus Rückzuchten wiederaufgebaut. Die Wisente mit ihren bis zu 800 Kilogramm Lebendgewicht sind die größten Landsäugetiere Europas. Zweimal im Jahr verlassen sie die Bergwälder und ziehen hinauf in die alpinen Zonen auf knapp 3000 Meter. Nirgendwo sonst leben Tiere dieser Gewichtsklasse in derartigen Höhen. Was treibt sie in die ungeschützten Gipfelregionen? Mit ihrem rüsselartigen Nasensack wirken Saiga-Antilopen wie Wesen aus einer anderen Welt. In den winterkalten Kalmückensteppen dient das erweiterte Organ als Wärmetauscher und Klimaanlage. Eiskalte Atemluft wird vorgewärmt, bevor sie die Lungen erreicht. Wer im Kaukasus überleben will, darf nicht zimperlich sein. Wetterkapriolen sind dort an der Tagesordnung. Oft scheinen sich die vier Jahreszeiten an einem Tag abzuwechseln. Schwarze Wolken verdunkeln die Sonne und bringen Hagel-, Regen- oder Schneestürme. Lawinen donnern zu Tal. Erdrutsche können binnen Sekunden ganze Landstriche neu gestalten. Epische Bilder, atemberaubende Flugaufnahmen und nie zuvor dokumentiertes Verhalten seltener Tiere: dieser Naturfilm über den Großen Kaukasus fesselt von der ersten Minute an. (Text: NDR) Der Große Kaukasus – Russlands Dach der Welt
45 Min.Im unmittelbaren Hinterland von Sotschi, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2014, ist ein beeindruckender Naturfilm mit fesselnden Bildern, atemberaubenden Flugaufnahmen und nie zuvor dokumentiertem Verhalten seltener Tiere entstanden: die letzten Bergwisente, Kaukasische Steinböcke, schroffe Gipfel und extreme Wetterschwankungen. Die Bergwelten des Kaukasus markieren eine magische Grenze zwischen Europa und Asien. Über ein Jahr hat Filmemacher Henry M. Mix mit seinem Team in Russlands höchstem Gebirge verbracht.Entstanden ist eine eindrucksvolle Dokumentation über die Naturwunder zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Die wilde Berglandschaft mit ihrem extremen Klima hat eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt geformt. Sie macht den Kaukasus zu einem der weltweit 25 bedeutendsten Zentren biologischer Vielfalt. Bergwisent, Kaukasuskönigshuhn und kaukasischer Tur sind nur hier zu finden. Im Regenschatten des schneereichen Hauptkammes leben Saiga-Antilopen, Ohrenigel und Schlangenadler. Im Westen des Gebirgszuges sind die einst ausgerotteten Bergwisente zu Hause. Mühsam, über Jahrzehnte hinweg, wurde der heutige Wildbestand aus Rückzuchten wiederaufgebaut. Die Wisente mit ihren bis zu 800 Kilogramm Lebendgewicht sind die größten Landsäugetiere Europas. Zweimal im Jahr verlassen sie die Bergwälder und ziehen hinauf in die alpinen Zonen auf knapp 3.000 Meter. Nirgendwo sonst leben Tiere dieser Gewichtsklasse in derartigen Höhen. Was treibt sie in die ungeschützten Gipfelregionen? Mit ihrem rüsselartigen Nasensack wirken Saiga-Antilopen wie Wesen aus einer anderen Welt. In den winterkalten Kalmückensteppen dient das erweiterte Organ als Wärmetauscher und Klimaanlage. Eiskalte Atemluft wird vorgewärmt, bevor sie die Lungen erreicht. Wer im Kaukasus überleben will, muss zäh sein. Wetterkapriolen sind dort an der Tagesordnung. Oft scheinen sich die vier Jahreszeiten an einem Tag abzuwechseln. Schwarze Wolken verdunkeln die Sonne und bringen Hagel-, Regen- oder Schneestürme. Lawinen donnern zu Tal. Erdrutsche können binnen Sekunden ganze Landstriche neu gestalten. (Text: NDR) Das grüne Wunder – Unser Wald
Noch bis weit in das Mittelalter hinein war die Mitte Europas von dichtem Wald bedeckt. Trotz des Raubbaus durch die Jahrhunderte sind bis heute großflächige Waldgebiete erhalten geblieben, die oft unzugänglich für Spaziergänger und Wanderer sind. Der aufwändige Kinofilm von Jan Haft bietet nach seinem weltweiten TV-Erfolg „Mythos Wald“ weitere sensationelle Einblicke in das geheime Leben von den Pflanzen und Tieren in unserer Heimat. Durch den Einsatz von modernsten Spezialtechniken wie HD-Highspeed-Kameras, die bis zu 2.000 Bilder pro Sekunde produzieren, computergesteuerten Zeitraffern, Minikameras für Makroaufnahmen, Kränen und Seilzügen für „fliegende“ Kamerabewegungen, sind betörend schöne Bilder entstanden.Es sind Aufnahmen aus der heimischen Natur, wie man sie vorher noch nicht gesehen hat. Sie zeigen den Lauf eines Jahres im Wald, sind hautnah bei den vielen Lebewesen in allen Ebenen aufgenommen: von den Baumkronen bis zur „Unterwelt“. Das „grüne Wunder“ wird erst im Zusammenspiel der unzähligen Organismen, die im Film aus allen Perspektiven gezeigt werden, offenbar: Der Wald ist ein wohl organisiertes System von den kleinsten Lebewesen, den Ameisen und Pilzen, bis hin zu den größten Gewächsen, den Bäumen. Jan Haft stellt in diesem Film aber auch die Frage: Was ist ein guter Wald? Ist er ein dichtes, allumspannendes Blattwerk, so wie es noch die alten Römer von Germanien berichteten? Tatsächlich enthüllt der Film ein sehr viel differenzierteres Bild vom Wald und nimmt den Zuschauer am Ende auf eine Zeitreise bis vor die letzte Eiszeit mit. Darin sieht man den wirklichen Urwald, so wie er in unseren Breiten ohne den Einfluss des Menschen wuchs. (Text: WDR) Haie eiskalt! Jäger zwischen Nordsee und Grönland
45 Min.Seit Millionen von Jahren beherrschen sie die Meere: Haie. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennt man sie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordens und ihre faszinierenden Überlebensstrategien aber weiß man nur sehr wenig. Christina Karliczek will das ändern und begibt sich auf eine spannende Expedition. Die erfahrene Unterwasserkamerafrau ist eine der wenigen in ihrem Metier und für Tauchgänge unter dem Eis und in extremer Tiefe speziell ausgebildet. Die Suche nach den kaltblütigen Meeresbewohnern führt das Team von sonnigen schwedischen Inselwelten entlang Norwegens Fjorde bis an die grönländische Arktis.Die Kamerafrau begleitet verschiedene Meeresbiologen. Einer von ihnen kann Haie gefahrlos nur durch Berührung in eine hypnoseähnliche Starre versetzen. Andere Forscher versehen Haie mit Satellitensendern und bekommen damit Einblicke in die unerforschte Lebensweise der oft missverstandenen Jäger und ihre wichtige Rolle im Lebensraum Meer. Hautnah trifft Christina Dorn- und Katzenhaie und lüftet einige Geheimnisse der legendären Riesenhaie vor der Atlantikküste Schottlands. Sie kommen dort zu mysteriösen Gruppentreffen zusammen. Andere ihrer Protagonisten mit scharfen Zähnen leuchten in der Finsternis. Erstmals gelang es, die Biolumineszenz des Schwarzen Laternenhai zu filmen, der durch besondere Leuchtorgane am Bauch blaugrün funkelt. Wenig erforscht, sind diese Herrscher der Meere trotz ihren außergewöhnlichen Anpassungen an extreme Lebensräume inzwischen fast überall ernsthaft bedroht. Millionen von ihnen sterben in Fischernetzen, landen als Schillerlocken, Seeaal und Fish and Chips auf dem Teller der Verbraucher. Viele Haie verenden zudem als ungenutzter Beifang. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, hat für manche Arten längst ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Unter der Eisdecke Grönlands trifft Christina schließlich auf den ultimativen Hai des Nordens. Zum ersten Mal gelingt es ihr, einen Eishai filmen. Der über sechs Meter lange Knorpelfisch kann über 400 Jahre alt werden, manche sagen gar ein halbes Jahrtausend. Eine Begegnung, die Christina sicher nie vergessen wird. (Text: NDR) Haie leben gefährlich
45 Min.Pyjamahaie lauern ihrer Beute auf. Kommt der richtige Moment, schlagen sie zu.Bild: NDR/Doclights GmbH Naturfilm/Charles MaxwellHaie gelten als die unbestrittenen Herrscher der Ozeane und leben zwischen Eismeer und Tropen. Sie sind als blutrünstige, gnadenlose Killer verschrien, die um des Tötens willen töten. Das Bild der Haie wurde geprägt von Schauermärchen und Hollywood-Blockbustern, die alle eines gemeinsam haben: Es sind Fiktionen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und genau dieser spürt dieser Film nach: der Inbegriff des Raubfisches ist überraschenderweise öfter Gejagter als Jäger, öfter gefährdet als Gefährder. Und selbst wenn der Hai jagt, tut er dies nicht immer mit Erfolg. Dabei haben z. B. Graue Riffhaie und Weißspitzen-Riffhaie sogar Wege gefunden, artenübergreifend gemeinsam zu jagen, um ihre Chancen zu erhöhen.Oder sie sind zum perfekten Meister der Tarnung geworden, sind nicht zu unterscheiden vom sie umgebenden Riff mit seinen Korallen wie etwa der äußerst bizarre Fransenteppichhai, der seinem Namen alle Ehre macht. Von kleinen Arten wie dem Epaulettenhai bis zum gewaltigen Walhai, der nur zu bestimmten Anlässen aus der Tiefsee emportaucht, ihre Vielfalt ist genauso groß wie die Bandbreite der Methoden, mit denen sie ihren Nachwuchs auf die Welt bringen. Vom Ei, das an Pflanzen befestigt wird und in dem der Nachwuchs erst heranreifen muss, bis hin zum fertig ausgebildeten kleinen Hai, der einsatzbereit das Licht der Meere erblickt. Der Filmemacher Didier Noirot hat die faszinierenden und extrem unterschiedlichen Lebewesen in bemerkenswerten Bildern festgehalten und bringt in seiner Naturdokumentation ihre Welt so nah wie kaum je zuvor, weit entfernt von jeglicher Sensationslust. Noirot thematisiert ihre Besonderheiten, ihre Schönheit und ihre Überlebensstrategien. Diese Meister der Anpassung werden heute allerdings vor allem aufgrund der Gefährdung durch den Menschen immer neu und immer extremer auf die Probe gestellt. (Text: NDR) Hannah goes Wild: Abenteuer Artenschutz
45 Min.Die junge Tierärztin Hannah Emde ist unterwegs in Namibia: Artenschutz, Abenteuer und persönlicher Einsatz stehen im Mittelpunkt des Zweiteilers „Hannah goes wild“. Tagelang begleitet Hannah Emde die Tierschützer*innen an verschiedene Orte und darf als Tierärztin bei mehreren Organisationen mithelfen. Hannah Emde, Jahrgang 1992, ist Tierärztin und Artenschützerin aus Leidenschaft. Seit Jahren ist sie mit den Regenwäldern dieser Welt vertraut. Namibia hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern auch mit einigen der zentralen Tier- und Umweltprobleme wie Artensterben, Klimawandel, Wilderei und dem Konflikt zwischen Tieren und Menschen um Lebensraum zu kämpfen.Im ersten Teil trifft Hannah Emde berühmte Artenschützer*innen, die sich leidenschaftlich für das Leben von gefährdeten Geparden und Elefanten einsetzen. Die Tierärztin Maaike de Schepper führt gemeinsam mit Hannah einen Gesundheitscheck an Geparden durch, die im großen Naturreserverat von N/a’an ku sê leben. Die Gründerin des Reservats, Marlice van Vuuren, durchstreift mit ihr das Schutzgebiet auf der Suche nach Wildtieren. Und der weltweit führende Elefanten-Tracker Hendrick Munembome führt sie auf die Spuren der Wüstenelefanten. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 07.09.2022 NDR Hannah goes Wild: Die letzten ihrer Art
45 Min.Die junge Tierärztin Hannah Emde, Jahrgang 1992, ist unterwegs in Namibia: Artenschutz, Abenteuer und persönlicher Einsatz stehen im Mittelpunkt des Zweiteilers „Hannah goes wild“. Hannah trifft in Namibia unterschiedlichste Menschen, die sich zeitlebens für das Leben von Elefanten, Nashörnern, Geparden und anderen Arten einsetzen und die Natur schützen wollen. Tagelang begleitet sie die Tierschützer*innen an verschiedene Orte und darf als Tierärztin bei mehreren Organisationen mithelfen. Hannah Emde, Namensgeberin der Serie, ist Artenschützerin aus Leidenschaft. Sie ist seit Jahren mit den Regenwäldern dieser Welt vertraut und hat bereits über das Leben von Nebelpardern und Orang-Utans auf Borneo, Großpapageien in Guatemala und Lemuren auf Madagaskar geforscht.Namibia hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern mit einigen der zentralen Tier- und Umweltprobleme zu kämpfen wie Artensterben, Klimawandel, Wilderei und dem Konflikt zwischen Tieren und Menschen um Lebensraum. Im zweiten Teil begegnet Hannah den aussterbenden Spitzmaulnashörnern und begleitet ein Nashorn-Tracking-Team bei ihrer harten Arbeit zum Schutz dieser Tiere. Außerdem geht sie dem Sinn und Unsinn der Trophäenjagd nach und beleuchtet das Thema auf vielen Ebenen: Sie spricht mit Einheimischen, aber auch mit kommerziellen Trophäenjäger*innen. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 07.09.2022 NDR Der Harz – Eisige Gipfel, wilde Täler
45 Min.Verwunschene Wälder, Großkatzen, wilde Schafe und ein langer, harter Winter: Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge hat vieles zu bieten. Der Harz ist sagenumwobener Treffpunkt der Hexen, war einst Inselreich von Urzeitechsen und ist heute ein Naturjuwel mit einer Tierwelt, die man in Deutschland anderswo kaum noch findet. Über 1.000 Meter hoch ragt der Brocken, der höchste Berg des Harzes, aus der flachen norddeutschen Landschaft. Kahl und windumpeitscht ist sein Gipfel, dunkel und wasserreich sind seine bewaldeten Hänge. Der Harz ist ein Regenfänger. Hier fällt zwei bis dreimal so viel Niederschlag wie im Umland.Im Winter kommt der Niederschlag als Schnee und verwandelt das Gebirge in eine erstarrte, weiße Traumlandschaft. Dabei kann es in den Hochlagen ungemütlich werden. Am Brocken erreichen Stürme nicht selten Orkanstärke und die Temperaturen fallen regelmäßig unter minus 20 Grad Celsius. Wildkatze und Luchs streifen durch die nebelverhangenen Wälder, Mufflon und Rothirsch haben hier ihr Revier. Der Luchs ist längst zum Symboltier der Region geworden. Er zeigt, dass Naturschutz und Tourismus erfolgreich nebeneinander existieren können. Manchmal kommt er den Harztouristen sogar sehr nah. Doch die gut getarnte Großkatze wird fast nie bemerkt. Eine weitere Besonderheit in den Tälern des Ostharzes sind die Mufflons. Wildschafe, die ursprünglich aus Sardinien und Korsika stammen und vor 100 Jahren im Harz angesiedelt wurden. Seltene Aufnahmen zeigen die kleinen Wildschafe in den Wäldern des Harzes. Berühmt ist der Harz nicht nur für seine Natur, sondern auch für seine Mythen: Hexen sollen sich in der Walpurgisnacht auf dem Brocken versammeln, dem höchsten Berg Norddeutschlands. Weniger bekannt ist die Vorgeschichte des Gebirges: Jurassic Harz, sensationelle Dinosaurierfunde am Harzrand, Tausende Knochen einer nah verwandten Art des Brontosaurus, der bis zu 22 Meter lang war. Die Harzer Saurier allerdings waren nur etwa acht Meter lang und erhielten so den Spitznamen „Harzer Zwerg“. Der erste Teil der Dokumentation „Der Harz“ beginnt im schneereichen Winter und endet im milden Sommer des 2000 Quadratkilometer großen Mittelgebirges. Über zwei Jahre lang war Tierfilmer und Harz-Kenner Uwe Anders für seine zweiteilige Naturdokumentation im Harz unterwegs. Ihm ist ein besonderes Naturporträt gelungen mit einzigartigen Landschaftsaufnahmen und überraschenden Verhaltensweisen der wilden Harzbewohner. (Text: NDR) Der Harz – Felsenreich und Wasserwelten
45 Min.Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge hat viel zu bieten. Der Harz, das ist raue Natur mit Schneestürmen im Winter und regennassen Wäldern im Sommer, den beiden einzigen wilden Katzenarten Deutschlands, röhrenden Hirschen, wilden Schafen und vielen anderen Tieren, die sich nur selten zeigen. Auf den Wiesen und in den Wäldern des Harzes jagen Deutschlands einzige Großkatzenarten. Die Wildkatze kann leicht mit einer Hauskatze verwechselt werden. Sie war aus vielen Regionen Deutschlands verschwunden. Durch die Mischung aus dichten Wäldern, die Verstecke für den Nachwuchs bieten, und Wiesen für die Mäusejagd, konnte die Wildkatze in der Harzregion überleben.Der Luchs war in ganz Deutschland ausgerottet. Im Nationalpark Harz wurden erstmalig wieder Tiere in die Freiheit entlassen. Von 2000 bis 2006 waren es 24 Luchse. Seit 2002 gibt es regelmäßig Nachwuchs im Harz. Inzwischen leben hier die meisten Luchse Deutschlands, etwa 55 ausgewachsenen Exemplare und 35 Jungtiere. Einige tragen ein Sendehalsband. Die Forscher*innen des Luchsprojekts wollen herausbekommen, wie der Luchs seinen Lebensraum nutzt und vor allem wie er sich ausbreitet. Vom Harz ausgehend besiedeln Luchs und Wildkatze wieder ihre angestammten Lebensräume. Das braucht Zeit. Die größte Gefahr für die Tiere dabei sind die zahlreichen Straßen und Autobahnen, durch die Deutschlands Landschaften zerschnitten werden. Die zweite Folge „Der Harz“ beginnt im milden Sommer und endet im Winter. Mehr als zwei Jahre lang war Tierfilmer Uwe Anders im Harz unterwegs. Es entstanden einzigartige Aufnahmen von überfluteten Wäldern, zauberhaften Schneelandschaften und den heimlichen Harzbewohnern wie Luchs, Wildkatze, Tannenhäher und Mufflon sowie von vielen weiteren Überraschungen, die die Natur im Harz bereithält. (Text: NDR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail