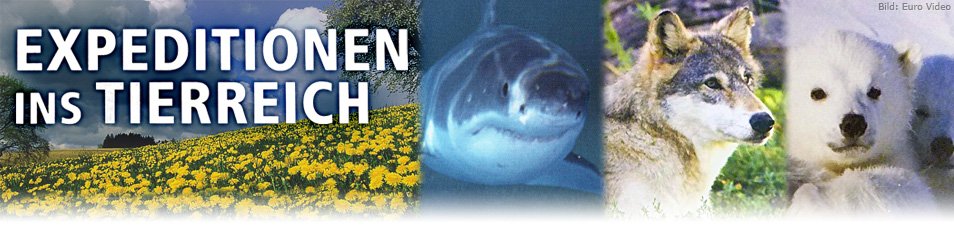unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 2)
Andalusien – Land zwischen Himmel und Hölle
45 Min.Andalusien ist ein Ort der Gegensätze: Der trockenste Landstrich Europas, die Wüste von Tabernas, und die gewaltigen Sümpfe des Doñana-Nationalparks gehören ebenso zu der südlichsten spanischen Provinz wie die riesigen lichten Eichenwälder. Für den alten Leithengst in den Sümpfen der Doñana ist das letzte Jahr angebrochen. Er ist schwach und muss die Stuten und Fohlen einem Rivalen überlassen. Am Ende eines langen und unbarmherzigen Sommers verstößt die Herde ihren einst so stolzen Anführer. Nicht weit von den Sümpfen entfernt erstrecken sich Stein- und Korkeichenwälder. Sie sind die Heimat der weltberühmten andalusischen Kampfstiere.Im Schatten der knorrigen Bäume führen sie ein Leben wie im Paradies. Doch im Alter von drei Jahren findet ihr friedvolles Dasein ein jähes Ende: In der Stierkampfarena treten sie zu einem aussichtslosen, tödlichen Duell an. Himmel und Hölle, in Andalusien liegen sie nah beieinander. In der Wüste von Tabernas ist Wasser Mangelware. Hier überleben nur Kreaturen, die sich der Trockenheit anpassen können: Schwarzkäfer, Perleidechse und Skorpione kommen nur in den frühen Morgenstunden aus ihren Verstecken. Hier, wo erbarmungslose Hitze herrscht, müssen alle mit ihren Reserven haushalten. Bis der erlösende Winterregen fällt und die Ödnis für kurze Zeit zum Paradies wird, vergeht noch einige Zeit. Extreme Gegensätze zeigen sich auch im Wesen der Bewohner Andalusiens: Die andalusische Bevölkerung lebt in Stimmungen zwischen ausgelassener Lebensfreude und tiefer Religiosität. So ist zum Beispiel alljährlich zu Pfingsten der kleine Ort El Rocío die Kulisse für die größte Wallfahrt Spaniens. Zwei Jahre lang war das Team um Jan Haft unterwegs, um die Natur und die prunkvollen Feste in wundervollen Aufnahmen und Perspektiven einzufangen. (Text: NDR) Atlantik – Ozean der Extreme: Berge der Tiefsee (From Heaven to Hell)
Im Westen Europas liegt ein Meer, das von Extremen beherrscht wird. Hier finden gigantische Tiere ein Schlaraffenland, seltene Tiere Schutz und Nahrung, brauen sich lebensbedrohliche Stürme zusammen, kämpfen Menschen mit gefährlich hohen Wellen. Mitten im Atlantik, weitab von jeder Küste, erstreckt sich eine Wasserwüste. Hier wachsen keine Pflanzen, bilden sich keine Korallen. Weit und breit gibt es kein Lebenszeichen. Dennoch tauchen an manchen Orten wie aus dem Nichts riesige Fischschwärme auf. Und mit ihnen ihre Räuber, Delfine etwa. Die intelligenten Tiere jagen in Teams, treiben ihre Beute zusammen und schlagen zu.Geht man Hochseeoasen wie dieser auf den Grund, stößt man nahezu immer auf Unterwasserberge. Ihre Geschichte hat vor 16 Millionen Jahren begonnen: Einst waren Amerika und Eurasien vereint. Als ihre Kontinentalplatten auseinanderdrifteten, bildete sich ein gewaltiger Spalt, der bis heute auseinanderstrebt. Meereswasser ergoss sich in die Lücke: der Atlantik, das jüngste Meer der Erdgeschichte, war geboren. Magma quoll aus dem Riss im Erdmantel empor und formte das längste Gebirge der Welt: den Mittelatlantischen Rücken. 16.000 Kilometer erstreckt er sich von der Arktis bis in die Antarktis. Mancherorts erhebt sich die Gebirgskette bis über das Wasser: Island, die Azoren, Ascension Island oder die Inselgruppe von Fernando de Noronha vor Brasilien sind sichtbare Beispiele. Allen ist eines gemeinsam: an ihren unterseeischen Bergflanken staut sich das Wasser und wird nach oben gepresst. Mit ihm gelangen auch die Nährstoffe der Tiefsee an die Meeresoberfläche. Die wiederum sind Nahrung für all die Tiere, die nicht in die Tiefen tauchen können, und sorgen an den Berghängen für eine reiche Meeresvielfalt. Für das Leben an Land spielen das Alter und die Lage der Inseln eine Rolle: Ascension Island, noch jung und mitten im Meer, bot vor dessen Kolonialisierung gerade einmal einem einzigen größeren Landtier Lebensraum: der Ascension-Krabbe. Unermüdlich wandern Heerscharen der Krustentiere jedes Jahr kilometerweit ans Meer, um ihre Eier abzulegen. Auf Fernando de Noronha dagegen herrscht üppiges Grün. Tausende Meeresvögel brüten dort. Dank der Nähe zu Brasilien konnten Pflanzensamen und Vogelarten sich hier gut einnisten. Nirgendwo aber ist der Nahrungsreichtum so unermesslich wie rund um Südgeorgien, mitten im sturmumtosten Südatlantik. Auf Südgeorgien gibt es die größten Pinguinkolonien der Erde. 90 Prozent der Weltpopulation an Südlichen Mähnenrobben bringen dort ihre Jungen zur Welt. Hier zeigt sich, wie Berge, die aus dem Feuer entstanden sind, die Wasserwelt verwandeln: von einer Wüste in eine Oase. Zu verdanken ist all das jener gewaltigen geologischen Kräfte, die einst auch ihn entstehen ließen: den Atlantik, den Ozean der Extreme. (Text: NDR) Atlantik – Ozean der Extreme – Hitze und Hurrikans
45 Min.Im Westen Europas liegt ein Meer, das von Extremen beherrscht wird. Hier finden gigantische Tiere ein Schlaraffenland, seltene Tiere Schutz und Nahrung, brauen sich lebensbedrohliche Stürme zusammen, kämpfen Menschen mit gefährlich hohen Wellen. Die Karibik ist das Sonnenparadies im Atlantik. In Korallenriffen, Seegraswiesen und Mangrovenwäldern entwickelt sich üppiges Leben. Unzählige Fische haben hier ihre Kinderstuben, seltene Kolosse wie die Manatis finden alles, was sie zum Leben brauchen. Atlantische Fleckendelfine bringen hier ihre Jungen zur Welt. Der Februar ist der kälteste Monat in der Karibik, dennoch ist das Wasser bereits 23 Grad warm.Von Monat zu Monat wird es dann wärmer, richtig heiß, die Macht der Sonne wird immer stärker, immer gnadenloser. Im Juli ist die Sonne bereits so intensiv, und damit auch die UV-Strahlung, dass einige Korallen ihre hitzeempfindlichen Algen abstoßen, die sie normalerweise mit Nährstoffen versorgen. Einige strahlen als eine Art Sonnenschutz Licht ab. Doch diese Fähigkeit haben längst nicht alle Korallen. Viele Tiere suchen Schutz im Schatten. 5.000 Kilometer entfernt bahnt sich eine Katastrophe an. Heiße Winde aus der Sahara wehen hinaus auf den offenen Atlantik und sorgen dafür, dass enorme Mengen an Wasserdampf aufsteigen. Wolken bilden sich, das Wasser kondensiert. Riesige Wolkenwirbel drehen sich über dem Atlantik, brausen immer weiter gen Westen und wachsen mit jedem Kilometer: ein Hurrikan entsteht. Hat er schließlich die Karibik erreicht, kann er an einem Tag so viel Energie entladen wie bei der Explosion von 640.000 Atombomben vom Typ Hiroshima freigesetzt würde. All die Energie stammt nur aus der Verwandlung von Dampf in Wasser. Zurück bleiben zerstörte Orte, überflutete Küsten und im Meer abgebrochene Korallenstöcke, verschlammte Mangrovenwälder, Delfinfamilien, die getrennt wurden. Doch im tropischen Atlantik hat sich das Leben an diese Naturgewalten angepasst. Das verzweigte Dickicht der Mangrovenwurzeln schützt nicht nur Küsten, sondern bietet unzähligen Tieren ein Rückzugsgebiet während des Sturms. Wellen und Wind sorgen dafür, dass sich die Sämlinge der amphibischen Bäume verbreiten. Und bei den Delfinen gibt es nach Hurrikanen oft einen Babyboom. Wer in den Atlantikregionen zu Hause ist, muss lernen, mit den beiden Extremen im Ozean zurechtzukommen. (Text: NDR) Atlantik – Ozean der Extreme: Strom des Lebens
45 Min.Im Westen Europas liegt ein Meer, das von Extremen beherrscht wird. Hier finden gigantische Tiere ein Schlaraffenland, seltene Tiere Schutz und Nahrung, brauen sich lebensbedrohliche Stürme zusammen, kämpfen Menschen mit gefährlich hohen Wellen. Alljährlich ereignet sich im Winter vor der Küste Nordnorwegens ein Naturspektakel: Milliarden Heringe kommen zusammen, um zu laichen. Ein Paradies für viele Tiere, die sich von den Fischen ernähren. Eine Buckelwalkuh ist 4.000 Kilometer mit ihrem jungen Kalb quer durch den Atlantik gezogen, um an dem großen Fressen teilzuhaben.Sie haben dabei quasi ein ozeanisches Transportmittel genutzt: den Golfstrom, einen der wärmsten und mächtigsten Ströme der Weltmeere. In der Karibik kommt er, getrieben von den Passatwinden, in Gang und lädt sich in den flachen Gewässern rings um die Inseln mit Sonnenwärme auf. Die Dimensionen sind gewaltig: Jede Sekunde gelangt Wärme, die einer Milliarde Megawatt entspricht, aus der Karibik bis in den Nordwestatlantik, mehr als das 2.000-fache der gesamten Kraftwerksleistung Europas. Nicht nur die Wale nutzen das gigantische Förderband, auch Fächerfische, Lederschildröten, Thunfische und Delfine reisen energiesparend ein Stück weit mit. Ihr Ziel sind stets nahrungsreiche Regionen wie die Ostküste Kanadas oder die Westküsten der Britischen Inseln. Durch Strömungsturbulenzen und starke Winde werden massenweise Nahrungspartikel aus der Tiefsee in obere Wasserschichten transportiert. Auch der Mensch profitiert vom Golfstrom. Auf der Höhe von Neufundland wechselt die Meeresströmung ihren Kurs von Nord nach Ost, eine Folge der Erdumdrehungskraft. Ideal für Händler, die nach der Entdeckung Amerikas Waren von der Neuen in die Alte Welt transportierten. Doch bringt der Golfstrom auch Tod und Zerstörung. Die durch ihn entfachten Westwinde bauen im Nordatlantik oft haushohe Wellen auf. Die Schiffe der vielen Atlantikfischer sind ihnen völlig ausgeliefert. Auf dem stürmischen Nordatlantik ist jede Fangfahrt eine Herausforderung und oft ein Spiel mit dem Leben. Der Film zeigt, welche enorme Wirkung der Golfstrom auf den gesamten Nordatlantik hat. Ohne ihn wäre der Ozean zwischen Amerika und Europa nicht das, was er ist: das nährstoffreichste und zugleich wildeste Meer der Welt. (Text: NDR) Auf Leben und Tod (1/4): Das Meer
Diese Folge aus der Serie „Auf Leben und Tod“ des Produzenten Alastair Fothergill begibt sich in die endlosen Weiten der Ozeane. Das offene Meer ist eine gewaltige Wildnis, die mehr als 70 Prozent der Oberfläche des Planeten Erde bedeckt. Doch der Großteil davon ist eine Wasserwüste, in der es kaum Nahrung gibt. Das Leben konzentriert sich an nur wenigen Stellen. Wie aber findet man solche Hotspots? Raubtiere sind ständig mit der Suche und der Verfolgung ihrer Beute beschäftigt. Gerade weil die Jagd im Ozean so schwierig ist, haben sich dort einige der bemerkenswertesten Jäger der Welt entwickelt.Nur die Spezialisten unter ihnen haben eine Chance zu überleben. Selbst wenn die Räuber der Meere Nahrung gefunden haben, bringt das Fangen der Beute eine Fülle neuer Probleme mit sich. Das gilt besonders für den Blauwal, den größten Jäger der Erde. Er schwimmt Tausende Kilometer durch die Ozeane auf der Suche nach Krill, einem der kleinsten Lebewesen im Meer. Dank seiner enormen Größe kann der Wal auf einmal einen ganzen Schwarm dieser Krebstiere verschlingen. Denkbar anders, aber ebenfalls ein bemerkenswerter Jäger ist der Fregattvogel. Da seine Federn nicht wasserdicht sind, darf er nicht nass werden. Trotzdem jagt er auf dem offenen Meer. Die Vögel verlassen sich dabei auf die Hilfe von Goldmakrelen, deren Beute bei der Flucht aus dem Wasser springt. Es sind fliegende Fische, die bis zu 100 Meter durch die Luft gleiten können. Sie wähnen sich außerhalb ihres eigentlichen Elements, dem Wasser, in Sicherheit, werden aber schon von den Fregattvögeln erwartet und abgefangen. Doch auch Haie, Seelöwen, Ostpazifische Delfine, Albatrosse und der skurrile Sargassofisch haben außergewöhnliche Methoden entwickelt, um im offenen Ozean zu jagen. (Text: NDR) Auf Leben und Tod (2/4): Die Savanne
Diese Folge der Serie „Auf Leben und Tod“ vom Produzenten Alastair Fothergill wagt sich ins offene Gelände. Die Hälfte der Kontinente ist von Wüste oder Grasland bedeckt. In diesen ungeschützten Lebensräumen ist es für Gepard, Weißkopfseeadler und Löwe leicht, ihre Beute zu entdecken. Aber auch die Beutetiere können die Gefahr frühzeitig erkennen. Ausdauer, Geschwindigkeit und Cleverness führen zumindest bei mancher Jagd zum Erfolg. „Die Savanne“ zeigt die Strategien von Jägern und Gejagten, die permanent auf dem Präsentierteller sitzen. Auch in diesem Gelände gibt es Spezialisten: Der Gepard, das schnellste Landtier der Erde, jagt seine Beute mit enormer Geschwindigkeit, aber auch, indem er ihre Ausweichmanöver perfekt nachahmt.Andere Tiere haben aus der minimalen Deckungsmöglichkeit in dieser Landschaft das Beste gemacht. Die Fellfarbe des Karakals zum Beispiel verschmilzt perfekt mit der des hohen, trockenen Grases der afrikanischen Savanne. Die Löwen der Etosha-Salzpfanne haben gelernt, dass Wüstenstürme nicht nur ihren Geruch verwehen und sie sich dadurch besser anschleichen können; die Wetterlage versetzt ihre Beute zusätzlich noch in Panik. Auch einige der kleinsten Raubtiere greifen zu Tricks. Ameisen in der Wüste Namib zum Beispiel. Durch die Sonne wird deren Beute, Insekten, quasi gegrillt und die Ameisen müssen nur noch die Kadaver einsammeln. In Brasilien locken die Larven von Schnellkäfern Termiten mithilfe eines gespenstischen Leuchtens in den Tod. Trotz allem sind die Gejagten ihren Feinden nicht ausgeliefert. Sie entwickelten über Jahrhunderte wirkungsvolle Schutzmechanismen. Sie graben tiefer, rotten sich dichter zusammen oder kämpfen härter, bis zum letzten Atemzug. Um in der offenen Savanne zu überleben, müssen Jäger und Gejagte ständig ihre Strategien verbessern. Denn in dieser erbarmungslosen Wildnis werden weder Fehler noch Schwächen verziehen. (Text: NDR) Auf Leben und Tod (3/4): Die Küste
Der Teil „Die Küste“ aus der Reihe „Auf Leben und Tod“ vom Produzenten Alastair Fothergill berichtet vom Leben und Überleben der Tiere an den Küsten zwischen Australien und Thailand, zwischen den USA und Chile. Diese Grenzbereiche zwischen Wasser und Land bieten vielfältige Jagdmöglichkeiten, jedoch oft nur über einen kurzen Zeitraum. Chancen bleiben nicht lange bestehen. Für die Jäger bedeutet das ein immerwährender Wettlauf gegen die Zeit. Viele Jäger verlassen ihre bevorzugten Lebensräume und kommen an die Küsten der Weltmeere, um ihre Beute zu erlegen. Sie nehmen dabei oft große Risiken auf sich, in der Hoffnung, ausreichend Nahrung zu finden. Manche Jagdmöglichkeiten sind von Ebbe und Flut abhängig und bieten sich zweimal am Tag, andere nur für wenige Stunden im Jahr.Um an der Küste Erfolg bei der Jagd zu haben, müssen die Tiere Geduld haben und sehr clever sein. Delfine zeigen eine erstaunliche Jagdstrategie, bei der sie jedes Mal ihr Leben aufs Spiel setzen. An der Küste können Oktopusse laufen, Wölfe fischen, Affen haben einen ausgeklügelten Speiseplan entwickelt, ihr „Seafood-Restaurant“ öffnet allerdings nur bei Ebbe. Auch der kleinste Meeressäuger, der Küstenotter, und die weltweit größte Ansammlung von Buckelwalen jagen an der Küste. Für sie alle entscheidet vor allem das richtige Timing über Leben und Tod, in einem Lebensraum, der sich ständig verändert. (Text: NDR) Auf Leben und Tod (4/4): Retter der Raubtiere
Diese Folge „Retter der Raubtiere“ aus der Serie „Auf Leben und Tod“ vom Produzenten Alastair Fothergill lässt den Betrachter die Welt der Raubtiere durch die Sichtweise von Forschern erleben. Sie stehen an vorderster Stelle, was den Schutz der großen Jäger angeht. Man erfährt viel über den uralten Konflikt zwischen Mensch und Natur. David Attenborough fragt zu Recht, ob die Natur überhaupt noch eine Chance hat, wenn der Mensch nicht einmal in der Lage ist, die Tiere zu schützen, die so faszinierend sind. Eine Welt ohne Löwen, Wildhunde und Eisbären ist kaum vorstellbar.Und doch ist die Situation so bedrohlich wie nie. Die letzten wilden Refugien der Erde schrumpfen, die Weltbevölkerung wächst unvermindert weiter. Immer häufiger kommt es zu tödlichen Begegnungen von Menschen und Raubtieren. Gerade Löwen und Wildhunde geraten in den Savannen Afrikas immer stärker in die Schusslinie. Die größte Bedrohung für den Harpyie, dem größten Greifvogel Südamerikas, ist die fortschreitende Abholzung des tropischen Regenwaldes. Blauwale vor der Küste Kaliforniens kreuzen bei ihrer Nahrungssuche viel befahrene Schifffahrtsrouten, was zu Kollisionen führt, die mit dem Tod enden. Am bedrohlichsten ist vielleicht die Situation für die Eisbären der Arktis. Ihnen schmilzt ihr Lebensraum buchstäblich unter den Pranken weg. Wenn die Sommer immer länger und wärmer werden, wird die Jagdsaison der Eisbären immer kürzer. Viele von ihnen verhungern einfach. Es gibt aber auch Erfolgsgeschichten: In Indien ist die Zahl der Tiger in den letzten Jahren dank intensiver Schutzbemühungen wieder auf 2.500 Exemplare gestiegen. Die Zahl der Raubtiere in einem Lebensraum ist auch immer ein Indikator dafür, wie gesund ein Ökosystem ist und dass die Bestände der Beutetiere stabil sind. In „Retter der Raubtiere“ trifft das Filmteam Wissenschaftler rund um den Globus, die das Verhalten der großen Jäger untersuchen und sich für deren Schutz und den Erhalt ihrer Lebensräume einsetzen. Ein Kampf, bei dem es auch für die Naturschützer manchmal um Leben und Tod geht. Geschichten voller Dramatik, aber auch voller Hoffnung, dass sich die Situation von Raubtieren verbessern lässt, wenn der Mensch bereit ist, diese faszinierenden Tiere zu retten, und lernt, mit ihnen zu leben. (Text: NDR) Auf Leben und Tod – Der Wald (Hide and Seek (Forests))
Die dritte Folge aus der Serie „Auf Leben und Tod“ des Produzenten Alastair Fothergill dringt in den Wald vor und zeigt das über Jahrtausende perfektionierte Versteckspiel zwischen Jägern und Gejagten. Wälder bedecken ein Drittel aller Kontinente. In ihnen verborgen, lebt mehr als die Hälfte aller Tierarten. Hautnah werden Tiger, Harpyien, Schimpansen und Treiberameisen beobachtet, wenn sie sich den Herausforderungen stellen, die die Jagd im Wald mit sich bringen. Eine enge, verwirrende und dreidimensionale Welt, eine Welt, in der allein das Auffinden von Beute extrem schwierig ist.Wenn ein Raubtier endlich Beute entdeckt hat, fangen die Probleme erst an: Ein freies Blickfeld gibt es nicht, genauso wenig wie Raum, um die Beute mit hoher Geschwindigkeit zur Strecke zu bringen. Zudem gibt es zahllose Fluchtwege, um im Dickicht zu verschwinden. Doch der Gewinn in diesem großen Versteckspiel ist für die Jäger jede Mühe wert. Jeder Wald hat seine eigenen Regeln und in jedem gibt es Spieler, die diese perfekt beherrschen. Dazu gehört der Tiger. Er kennt jeden Winkel seines Reviers und ist ein Meister der Jagd aus dem Hinterhalt. Aber auch in Nordamerika gibt es Spezialisten: Baummarder. Sie stöbern Mäuse unter dem Schnee auf, wo sich ein Labyrinth aus Tunneln gebildet hat. Dort beginnt ein Katz- bzw. Marder-und-Maus-Spiel. In den Laubwäldern Europas fangen Sperber kleinere Vögel in der Luft. Der Dschungel schließlich ist wahrscheinlich eines der schwierigsten aller Reviere. Dort ist die Kamera dabei, wenn springende Spinnen, Koboldmakis, Harpyien und Schimpansen auf die Jagd gehen. Sie alle bewältigen die Schwierigkeiten ihres besonderen Lebensraumes mit bemerkenswerten Strategien. (Text: NDR) Auf Leben und Tod – Die Arktis (In the Grip of the Seasons (Arctic))
Die zweite Folge aus der Serie „Auf Leben und Tod“ des Produzenten Alastair Fothergill dringt in die Arktis vor. Kein Ort der Welt verändert sich über die Jahreszeiten dramatischer und stellt Jäger wie Polarfuchs, Eisbär und Polarwolf vor größere Herausforderungen. Das Jahr ist in dieser unwirtlichen Region für die Raubtiere voller Entbehrungen, nur gelegentlich bietet ein kurzes Zeitfenster einfachere Jagdmöglichkeiten und damit bessere Überlebenschancen. Nicht nur das Wetter verändert sich, sondern auch der gesamte Lebensraum. Wo eben noch endloses Eis das Meer bedeckte, entsteht im Sommer ein Labyrinth aus Eisschollen.Aus eisigen Ebenen, auf denen im Winter Temperaturen von unter minus 50 Grad Celsius herrschen und der Schnee meterhoch liegt, werden üppig blühende Wiesen, die Millionen von Zugvögeln anlocken. Die Jäger müssen daher ständig ihre Strategien anpassen: Im Winter haben Eisbären die besten Bedingungen, um auf der geschlossenen Meereisdecke nach Robben zu jagen, im Frühjahr wird es schon schwieriger. Dann pirschen sie sich unter Wasser an ihre Beute heran. Wenn das Nordpolarmeer im Sommer offen ist, beginnen für die größten Landjäger Zeiten des Hungers. Doch einige von ihnen haben erstaunliche Tricks entwickelt, um selbst dann noch Beute zu machen. Polarwölfe müssen sich im Frühjahr mit Schneehasen begnügen, die sich versammeln, um ihre Jungen aufzuziehen. Diesen Meistern im Hakenschlagen auf den Fersen zu bleiben, ist allerdings alles andere als einfach. Im Herbst, wenn die Hasenjagd zu schwierig wird, greift das Rudel auch größere Beute an: Moschusochsen. Die wehrhaften Tiere mit ihren spitzen Hörnern sind allerdings gefährliche Gegner. Polarfüchse ernähren sich während des Winters nur von Aas. Erst mit der Rückkehr abertausender Zugvögel im Frühjahr beginnen für sie fette Zeiten. Die kleinen Jäger brauchen sehr viel Geschicklichkeit, um Krabbentaucher zu fangen. Dank ihres grauen Sommerfells können sie sich perfekt zwischen Steinen verstecken und lauern dort ihrer Beute auf. Einen dieser Seevögel zu fangen, ist trotzdem nicht einfach. Jeder einzelne Jäger hat sich perfekt auf den ständigen Wandel in der Arktis angepasst, nutzt die Zeiten des Überflusses, um die des Mangels zu überstehen. (Text: NDR) Auf Leben und Tod – Die große Jagd (The Hardest Challenge)
Der ewige Wettstreit zwischen Jäger und Gejagten bietet seit jeher die dramatischsten Szenen in der Natur: „Die große Jagd“ aus der Serie „Auf Leben und Tod“ des Produzenten Alastair Fothergill enthüllt die außergewöhnlichsten Strategien von Raubtieren, um Beute zu machen. Jede dieser Taktiken ist durch den Lebensraum geprägt, in dem sie auf die Pirsch gehen. Für einen Leoparden hängt der Jagderfolg davon ab, wie gut er jede Deckung zu nutzen weiß, um möglichst nah an seine Beute heranzukommen. Geduld ist dabei die oberste Prämisse.Wildhunde haben ganz andere Probleme zu meistern: Wie bringen sie ihre Beute in einer Gegend zur Strecke, in der es kaum Möglichkeiten gibt, sich zu verstecken, in der offenen Savanne Afrikas? Ihre Lösung heißt Ausdauer, genug Ausdauer, um ihre Beute bis zur Erschöpfung über große Distanzen zu jagen. Orcas wiederum verlassen sich auf Teamwork und Intelligenz. Gemeinsam nehmen sie es sogar mit 40 Tonnen schweren Buckelwalen auf. Jäger müssen sich vielen Herausforderungen stellen: Ob es die riesigen Krokodile der Serengeti sind, die geduldigsten Raubtiere der Erde, die ein ganzes Jahr lang auf eine Mahlzeit warten können. Oder der Amurfalke, der auf seiner Suche nach Nahrung über 22.000 Kilometer Flugstrecke im Jahr zurücklegt. Doch welche Strategien die Raubtiere auch immer verfolgen, die überraschende Wahrheit ist, dass sie in den meisten Fällen erfolglos sind. Selbst für den versiertesten Jäger ist der Ausgang stets offen. Für jede Mahlzeit müssen sie kämpfen und oft sogar ihr Leben aufs Spiel setzen. (Text: NDR) Auf Wiedersehen Eisbär! – Mein Leben auf Spitzbergen
45 Min.Seit 20 Jahren ist das arktische Inselreich von Spitzbergen die zweite Heimat des Norwegers Asgeir Helgestad. Den Naturfilmer zieht es immer wieder zu dem abgelegenen Archipel im Nordpolarmeer. Kaum ein anderer kennt die eisige Welt so gut wie er. Das erstaunliche Licht, die weite Landschaft, die Stille und das Gefühl, allein mit der Natur zu sein, faszinieren den Naturfilmer immer wieder aufs Neue. Im Jahr 2013 begegnete Asgeir Helgestad zwei kleinen Eisbären und ihrer fürsorglichen Mutter. Vom ersten Moment an eroberte die kleine Familie sein Herz. Der liebevollen Bärenmutter gab er den Namen Frost.Im Laufe der nächsten vier Jahre suchte Asgeir immer wieder nach ihr und ihren Jungen. Doch mit steigenden Temperaturen sorgt der Klimawandel für dramatische Änderungen im Lebensraum von Eisbärin Frost und ihrer Familie. Die ehemaligen Jagdgründe der Eisbären werden immer seltener, denn das Eis schmilzt in extremem Tempo dahin. Fjorde, die einst monatelang von einer Eisdecke überzogen waren, sind nun eisfrei. Mit dem Rückgang des Eises verschwinden die Ruheplätze und Kinderstuben der Robben und mit ihnen die Nahrungsgrundlage der Eisbären. Bärenmutter Frost muss nun immer längere Strecken zurücklegen, um Robben für sich und ihre Jungen zu jagen. In dieser Welt im Umbruch ist Asgeir fest entschlossen, „seine“ Eisbärin wiederzufinden. Auf der Suche nach Eisbärmutter Frost dokumentiert er in beeindruckenden Bildern, wie Gletscher schmelzen und ganze Landschaften aus Eis immer schneller schwinden und wohl schon bald ganz verloren gehen werden. Noch zeigt sich die eisige Natur Spitzbergens in überwältigender Schönheit. Magisch erleuchten Mond, Sterne und spektakuläre Polarlichter die langen Winternächte. Nach vier langen Monaten zeigt sich die Sonne wieder über dem Horizont und die Inselgruppe Svalbard erwacht zum Leben: Mit den länger werdenden Tagen entwickeln sich winzige Algen unter dem Eis. Sie ernähren Krebse, von denen wiederum Vögel und Wale leben. Krabbentaucher, Dickschnabellummen, Dreizehenmöwen, Gänse und Seeschwalben bevölkern nun die Inseln. Die Polarbären, die der Eisgrenze nicht nach Norden gefolgt und geblieben sind, müssen sich bei der Nahrungssuche nun mit Eiern und Vogelküken begnügen. Einfühlsam und anrührend erzählt dieser Naturfilm, wie wundervoll und zerbrechlich die eisige Welt der Arktis ist. Der Film erinnert eindringlich in fantastischen Bildern, was die Menschheit verliert, wenn nicht bald ein Umdenken stattfindet. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen in der Zukunft. Allein im Winter 2017/2018 hat die Arktis etwa 100.000 Quadratkilometer Meereis verloren im Vergleich zum Winter davor. Die Ursachen dieser rasanten Veränderungen sind nicht restlos erforscht. Sicher aber ist, dass die Menschen die globale Erwärmung forcieren. Es liegt damit auch an ihnen, welche Zukunft Eisbären auf der Erde haben. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 08.01.2020 NDR Australien (1): Im Reich der Riesenkängurus
Die Wüste ist ihr Reich: Im Herzen Australiens leben die größten Beuteltiere der Erde, Rote Riesenkängurus. Monatelange Trockenheit, glühende Hitze und ein paar trockene Gräser: Um hier überleben zu können, muss man sich etwas einfallen lassen. An skurrilen Strategien mangelt es Australiens Tierwelt nicht, wie dieser Film mit außergewöhnlichen Tieraufnahmen beweist. Die „Roten Riesen“ hüpfen muskelbepackt und auf kräftigen Hinterbeinen durchs Outback. Das ist tatsächlich eine äußerst energiesparende Methode, sich in der Wüste fortzubewegen.Selbst dann, wenn ein Weibchen Nachwuchs mitschleppt: Gut geschützt verbringt das junge Känguru die ersten Lebensmonate in Mutters Beutel mit direktem Zitzenanschluss. Wie bequem oder unbequem es für den Nachwuchs im Kängurubeutel ist, zeigen eindrucksvolle Aufnahmen aus seinem Innern. Wellensittiche sind ebenfalls Anpassungskünstler ans Wüstenleben. Auch ihre Heimat sind die Weiten Australiens. Zu Hunderttausenden stürmen die leuchtend grünen Minipapageien die wenigen Wasserlöcher. Ein seltenes Naturschauspiel! Aufgrund der Masse haben Raubvögel kaum eine Chance, einen einzelnen Vogel zu attackieren. Es beginnt eine spannende Jagd. Australien ist nicht nur berühmt für seine Beuteltiere, auf dem roten Kontinent leben auch extrem viele äußerst giftige Tiere. Vor der unscheinbaren Braunschlange sollte man sich nicht nur als Echse oder Maus in Acht nehmen: Ein einziger Biss ist auch für Menschen tödlich. Dennoch gibt es Tiere, die aus der Jägerin eine Gejagte macht: Den Riesenwaran scheint das tödliche Gift der Braunschlange nicht zu interessieren. Er wagt es, sie in ihrem Unterschlupf anzugreifen! Eine weitere Spezies in der Wüste sind Honigtopfameisen: In guten Zeiten füttern die Arbeiterinnen einige Artgenossen mit süßem Saft, den diese in ihrem Körper speichern. Bewegungslos und prall gefüllt baumeln sie als lebendige „Honigtöpfe“ von der Decke des unterirdischen Ameisenbaus. Wird das Futter knapp, geben die „Honigtöpfe“ ihre Vorräte wieder ab und bringen den Ameisenstaat über schlechte Zeiten. (Text: NDR) Australien (2): In den Wäldern der Koalas
Die großen Eukalyptuswälder im Osten Australiens sind das Reich der Koalas. Eigentlich sind die „Australiens Teddys“ eher als gemütliche Tiere bekannt, doch in der Paarungszeit werden Koalamännchen plötzlich zu rastlosen Draufgängern, die den Weibchen und Rivalen in ihrem Revier das Leben schwer machen. Eindrucksvolle Aufnahmen beweisen: Während der Brunft geht es hoch her im Koalawald. Kilometerweit erschallen die grunzenden Rufe der Männchen. Wer hätte gedacht, dass die scheinbar sanftmütigen Koalamännchen jetzt regelrecht zu Wüstlingen werden, die sich gegenseitig rabiat bekämpfen und versuchen, über die Weibchen herzufallen.Doch die wissen sich zu wehren: mit scharfen Krallen und anderen Tricks. Australiens Osten birgt noch mehr Überraschungen: Monatelang sind die Gipfel der Australischen Alpen mit Schnee bedeckt. Selbst hier im Hochgebirge leben Beuteltiere, die sich an das raue Klima angepasst haben, so zum Beispiel der Bergbilchbeutler. Außerdem lebt hier der vielleicht seltenste Froschlurch der Welt. Der fünfte Kontinent ist nicht nur berühmt für seine Beuteltiere: In den Flüssen der Ostküste taucht ein merkwürdiges Wesen mit Entenschnabel und Biberschwanz nach Fischen und Krebsen: das Schnabeltier, ein eierlegendes Säugetier. Ebenso seltsam ist sein nächster Verwandter. Der stachelige Ameisenigel stöbert mit langer Schnauze im Termitenbau nach seiner Lieblingsspeise. Im Koalawald leben auch gefährliche Fallensteller. Die Todesotter lockt mit ihrer Schwanzspitze, die aussieht wie ein sich ringelnder Wurm! Kommt ihre ein neugieriges Opfer zu nah, schlägt sie zu! Vor der gut getarnten Giftschlange sollte man aber sich nicht nur als Vogel oder Echse in Acht nehmen: Ein einziger Biss der Todesotter ist auch für Menschen tödlich. Der Leierschwanz ist der Meistersänger im Eukalyptuswald. Mit langem Federschmuck und komplexen Melodien versucht er, Weibchen in seine Balzarena zu locken. Der Leierschwanz imitiert die Gesänge der anderen Vögel im Wald perfekt, und nicht nur die: Auch Umgebungsgeräusche kann er nachahmen. Mit seinem skurrilen Gesang und wildem Tanz will er der Damenwelt imponieren. Der ordnungsliebende Seidenlaubenvogel hingegen bezirzt die Weibchen mit einer Sammlung aus gelben und blauen Gegenständen, die er sorgsam um seine kunstvoll errichtete Liebeslaube drapiert. Ob glänzende Federn, leere Schneckenhäuschen oder Plastiklöffel, alles, was die richtige Farbe hat, kommt ihm gerade recht, um die Auserwählte von sich zu überzeugen. (Text: NDR) Australien (3): Im Dschungel der Riesenvögel
Rote Felsen und Kängurus im Abendlicht, so glaubt man, Australien zu kennen. Den meisten verborgen bleibt der vielleicht geheimnisvollste Teil des fünften Kontinents: Der tropische Regenwald im Nordosten des Landes ist Heimat von Kängurus, die auf Bäumen herumklettern. In den Sümpfen lauern die größten Krokodile der Erde auf unvorsichtige Beute. Verborgen im Dschungel leben schräge Paradiesvögel und der Kasuar, ein Riesenvogel wie aus der Urzeit! Down Under ist ein Kontinent voller Naturwunder! Sobald der Helmkasuar erscheint, sollte man sich besser in Acht nehmen, denn sein kräftiger Schnabel und die scharfen Krallen sind tödliche Waffen.Er kann die Größe eines Menschen erreichen, hat glänzend schwarzes Gefieder und einen leuchtend blauen Hals. Fliegen kann er aber nicht. Das wäre bei seiner Größe im dichten Dschungel auch eher nachteilig. Lieber schreitet der seltene Vogel über den Urwaldboden, ständig auf der Suche nach Früchten. Kasuare wagen sich kaum in offenes Gelände, doch die Filmaufnahmen beweisen, dass sie manchmal sogar einen Spaziergang am Strand machen! Gut versteckt im Wald sind die Kasuarküken geschlüpft. Brüten und die Versorgung des Nachwuchses ist beim Kasuar reine Männersache. Die gestreiften Küken ähneln eher Frischlingen als ihren Eltern, so sind sie im Wald perfekt getarnt. Fast ein Jahr lang kümmert sich der Vater um die Kleinen. Der Nordosten Australiens ist das Revier der größten Krokodile der Welt. „Salties“, wie Leistenkrokodile hier genannt werden, bewohnen nicht nur Mangrovensümpfe, sondern überleben auch im Salzwasser des offenen Ozeans. Zwar können die bis zu sechs Meter langen Reptilien monatelang hungern, doch wenn sie einmal zupacken, geht alles blitzschnell! Erst die Aufnahme mit Superzeitlupenkamera enthüllt, was beim Angriff tatsächlich passiert. Weniger bedrohlich ist ein plüschiger Bewohner der Tropenwaldwipfel: das Baumkänguru. Statt über die offenen Weiten Australiens zu hüpfen, klettern sie im Regenwald von Ast zu Ast. Ein ein spezieller Anblick, denn obwohl Baumkängurus im Grunde geschickte Kletterer sind, sehen sie dabei nicht besonders elegant aus. Auch Baumkängurus haben einen Beutel, in dem sie ihren Nachwuchs mit sich herumtragen. Erst nach einigen Monaten wagt sich das Jungtier erstmals ganz aus dem Beutel heraus, seine ersten Schritte sind gleich ein Klettertraining in luftiger Höhe. (Text: NDR) Australien (4): Im Land der Wombats
Atemberaubende Küsten, eindrucksvolle Wüsten, glühende Hitze! Der Süden Australiens steckt voller Gegensätze: Die Kalksteinklippen der Zwölf Apostel an der Südküste Australiens ziehen massenhaft Touristen an, auf den Wellen des Südlichen Ozeans reiten Surfer und Brillenpelikane. Doch weiter landeinwärts beherrschen oft gnadenlose Hitze und Trockenheit den Süden. Selbst Überlebenskünstler wie Wombats geraten in den Sommermonaten an ihre Grenzen. Während tagsüber heißer Wind über das karge Inland im Süden Australiens fegt, ruht er friedlich im selbst gebuddelten Reich unter der Erde: Der Wombat gehört zu den besten Baumeistern der Natur.Bis zu fünf Meter tief gräbt er in die Erde, legt 30 Meter lange Tunnelsysteme an. Wombats sind perfekte Buddelmaschinen: gedrungener Körper, kräftige kurze Beine, flacher Kopf. Und sie haben einen Beutel, der nach hinten offen ist, damit dem Nachwuchs keine Erde in die Augen rieselt. Wombats sind Einzelgänger und Überlebenskünstler, sie kommen mit extrem wenig Wasser aus. Doch die glühenden Sommer in Südaustralien machen selbst ihnen zu schaffen. Erst recht dann, wenn sie mit europäischen Kaninchen um die letzten Gräser konkurrieren müssen und fremdartige Pflanzen aus Übersee sich um sie herum ausbreiten. Je länger die Trockenzeit andauert, umso gefährlicher wird die Situation für die Beuteltiere. Im Süden Australiens leben weitere skurrile Tiere wie die Tannenzapfenechse. Ihren Namen verdankt sie ihren großen Schuppen, die den ganzen Körper bedecken. Die Echse speichert Fett für schlechte Zeiten in ihrem Schwanz. Dieser erfüllt aber noch einen weiteren Zweck: Da der Schwanz beinahe so breit und dick wie der Kopf des Tieres ist, können Feinde schwer erkennen, wo bei der Echse vorne oder hinten ist. Packt ein Angreifer aus Versehen ihren Schwanz, bricht der einfach ab und die Tannenzapfenechse kann flüchten. Eine weitere Besonderheit des roten Kontinents sind Bulldoggenameisen: Sie werden mehrere Zentimeter groß und haben einen Giftstachel, im Gegensatz zu den meisten anderen Ameisenarten. Außerdem besitzen sie kräftige Kiefer, mit denen sie sich alles schnappen, was sie erwischen können. Mit dem Gift des Stachels wird die Beute gelähmt und dann in den Ameisenbau geschleppt. Für unvorsichtige Insekten gibt es kein Entkommen. Australiens Süden ist voller Naturwunder: von der bizarren Pinnacles Desert, einer Wüstenlandschaft mit hohen Kalksteinsäulen, bis hin zum Murray-Fluss, der das Land mit Leben spendendem Wasser versorgt. Der Süden ist auch das Land der gemütlichen Wombats, die immer mehr Gefahren trotzen müssen, um zu überleben. Auch für diese Folge „Im Land der Wombats“ aus der Naturfilmreihe „Australien“ bereisten die erfahrenen Tierfilmer Klaus Weißmann und Rolf Sziringer den Kontinent viele Monate lang, um eindrucksvolle Aufnahmen und Tiergeschichten einzufangen. (Text: NDR) Der Bach – Lebensadern der Landschaft
45 Min.Wohl jeder kennt einen Bach in seiner Nähe. Doch was macht einen typischen Bach so wichtig im Zusammenspiel der vielen kleinen und großen Tier- und Pflanzenarten? Der vielfach preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft nimmt mit seinen Spezialkameras einen der vielfältigsten heimischen Lebensräume unter die Lupe. Rauschender Gebirgsbach, schattiger Waldbach oder friedlich schlängelnder Flachlandbach, sie alle haben Gemeinsamkeiten: Die Zweige der Baumkronen am Rande des Wasserlaufs berühren sich, fast überall ist die Tierwelt auf dem Rückzug. Studien belegen: In 94 Prozent der Fließgewässer existiert die Gemeinschaft der angestammten Tierarten nicht mehr. Was ist passiert? Und wie geht es weiter? Dieser Film zeigt die Vielfalt der tierischen Bewohner von Bächen, stellt ihre Lebensweise vor und erklärt ihre Bedeutung für das Ökosystem Bach.Die Protagonisten des Films sind die Groppe, eine Fischart mit einer ganz besonderen „Essstörung“, der Feuersalamander und der seltene Steinkrebs, dessen Panzer fluoresziert. Dabei begleitet der Film einen idealen und typischen Bach von der Quelle bis zur Mündung und schildert drei ganz unterschiedliche Katastrophen, die der filigrane Lebensraum im Laufe eines Jahres erleidet. Er dokumentiert auch, welche Faktoren dafür verantwortlich sind, dass nur noch jeder 1.000ste Bach in Deutschland als intakt bezeichnet werden kann und was getan werden muss, um die kleinen Fließgewässer zu retten. (Text: NDR) Bärenalarm in Transsilvanien
45 Min.Bild: NDR/Boas SchwarzIn keinem Land Europas leben mehr Bären als in Rumänien. Es sind wohl mehr als 6000 Exemplare, und es werden immer mehr. Besonders in Transsilvanien kommen die Bären dem Menschen oft gefährlich nahe. Vielerorts liegen deshalb die Nerven blank. Der Film folgt einer Bärin und ihren drei Jungen. Als sie alt genug sind, wagen sie sich aus dem Schutz der Karpatenwälder hinaus in die Stadt und werden so zu „Problembären“. Ihr dramatisches Schicksaal zeigt, welche Herausforderungen das Zusammenleben von Bären und Menschen mit sich bringt. Gibt es im dicht besiedelten Europa noch eine gemeinsame Zukunft? (Text: NDR)Die Bärenbande – In Skandinaviens Wäldern
90 Min.Hoch im Norden Europas liegt das Reich der Braunbären. Verborgen in den Wäldern von Finnland, Schweden und Norwegen leben bis heute mehrere Tausend Bären. Mitten im Winter, wenn draußen meterdicker Schnee ihre Höhle bedeckt, bringen die Weibchen ihre Jungtiere zur Welt. Monatelang bleiben die Bärenjungen dicht bei der Mutter, werden von ihr gewärmt und gesäugt, bevor die Drillinge im Frühjahr beginnen, ihre Welt außerhalb der Höhle zu erkunden. Gemeinsam mit der „Bärenbande“ geht dieser außergewöhnliche Naturfilm auf Entdeckungsreise in Skandinaviens wilde Wälder, in die Heimat der mächtigen Elche und cleveren Wölfe, zu den seltenen Waldrentieren und segelnden Gleithörnchen.Eisiger Wind, kaum Tageslicht und immer wieder Schnee, der Winter in Skandinavien ist unerbittlich! Braunbären verkriechen sich monatelang, halten Winterruhe in ihrer Höhle. Dabei hat selbst die kalte Jahreszeit ihre Experten: Der Bartkauz ist auch im Winter ein extrem erfolgreicher Jäger, denn die große Eule fixiert ihre Beute nicht nur mit den Augen, sondern hört sogar Geräusche von Nagetieren unter dem Schnee! Sonne und Wärme gewinnen endlich wieder die Oberhand, in Skandinaviens Wäldern ist Frühling. Zum ersten Mal verlässt die Bärenmutter mit ihren Drillingen die schützende Höhle. Und was gibt es für die Winzlinge da draußen nicht alles zu entdecken! Eine alte Spechthöhle ist auch das neue Zuhause der Schellenten-Familie. Für die Entenmutter ist sie ein perfekt geschützter Ort, um ihre Eier zu legen. Doch ihre Küken sind Nestflüchter, schon kurz nach dem Schlüpfen wollen die kleinen Federknäuel das Nest in luftiger Höhe verlassen. Dabei können sie noch längst nicht fliegen! Es gibt nur eine Möglichkeit: Die Küken müssen in die Tiefe springen. Was folgt, ist die erste und vielleicht größte Mutprobe ihres Lebens! Gemeinsam mit ihrer Mutter streifen die Bären-Drillinge durch den Wald: Was kann man fressen und was nicht? Das muss der Nachwuchs erst lernen. Bei ihren Ausflügen begegnet die Familie vielen Tieren, auch Artgenossen! Doch gerade die meinen es nicht immer gut mit den kleinen Bären: Fremde, ausgewachsene Männchen sind eine ernste Gefahr. Sie töten die Jungtiere, die nicht ihre eigenen sind, um mit deren Mutter selber Nachwuchs in die Welt zu setzen. Sogar fremde Bärenweibchen sind den Kleinen nicht immer wohlgesonnen, also muss die Mutter mit ihren Drillingen ständig auf der Hut sein! Alles andere als einfach, denn gerade ihr Kleinster macht gerne mal eine „Extratour“. Drei Jahre lang arbeiteten die renommierten Tierfilmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg an den Aufnahmen für diesen Film. Sie verbrachten viele Hundert Drehtage in den Wäldern Nordeuropas. Mit viel Geduld und noch mehr Know-how gelangen ihnen äußerst seltene und spannende Verhaltensaufnahmen aus der Wildnis Skandinaviens, unterstützt mit Aufnahmen von Jan Henriksson, Rolf Steinmann, Kari Kemppainen, Joosep Matjus, Florian Leo. Aus Tierschutzgründen wurden die Szenen mit den Bärenjungen innerhalb der Höhle und das Spiel davor nicht in freier Wildbahn gedreht. Alle anderen Bärenaufnahmen sind in der freien Natur Skandinaviens entstanden. (Text: NDR) Bärland
45 Min.Diese Naturdokumentation wirft erstmalig einen Blick auf die drei Bärenarten in ihren benachbarten Lebensräumen und zeigt, wie dort die Räder der Natur ineinandergreifen und sich ihr Lauf verändert. Entlang der pazifischen Küsten Nordasiens leben die meisten Bären auf der Erde. Braunbären, Eisbären und Kragenbären. In einer Welt aktiver Vulkane, stürmischer Kaltsteppen und nordischer Urwälder liegt ihr „Bärland“. Sie gelten als Herrscher dieser Wildnis. Doch um sie herum walten Mächte, die größer sind. Im Norden warten die Eisbären auf Packeis.Doch diesmal gefriert das Meerwasser nicht. Damit fehlt der „Kitt“, der Schollen und Eisberge zusammenschweißt und den Eisbären die Jagd auf Robben ermöglicht. In ihrer Not suchen sie Nahrung in verlassenen Siedlungen. Ein riesiger Vulkansee ist das Ziel zahlloser Braunbären. Sie warten nach den Monaten der Winterruhe auf die Rotlachse, die aus dem Meer heraufkommen. Ein Tsunami von Fischkörpern ergießt sich in den See und das große Fressen beginnt. Ein Naturwunder, verantwortlich für die höchste Bärendichte auf der Erde. Aber wenn die Lachsflut zu früh endet oder ausbleibt, wird auf die eigenen Artgenossen Jagd gemacht. Gerade für junge Bären ist das Überleben nie sicher. In den Urwäldern an der Südküste „Bärlands“ herrscht eher Überfluss. Doch Kragenbären müssen auf der Hut sein. Tiger und Leoparden bestimmen hier die Reviere und den Gang der Dinge. Dafür nutzen sie ein Kommunikationssystem aus Gerüchen. Baumstämme sind die „Funkmasten“, die von allen Bewohnern gezielt markiert und ihre Botschaften schnuppernd dekodiert werden. (Text: NDR) Berg der Bären
45 Min.Ein mächtiger Berg tief im eisigen Nordwesten Kanadas ist die Heimat der neunjährigen Grizzlybärin Sophie. Gerade ist sie aus ihrem Winterschlaf erwacht. Das raue Klima am Rande des Polarkreises lässt die Temperaturen im Winter bis auf minus 30 Grad fallen und selbst das Fell der Bären gefrieren. Für die Grizzlys bedeutet dies einen Kampf auf Leben und Tod. Doch dank eines einzigartigen Flusses, der bis tief in den Winter hinein eisfrei bleibt, haben die Bären einen entscheidenden Vorteil. Der Fluss versorgt sie mit Lachsen, lange nachdem andere Wasserwege der Yukon-Provinz bereits zugefroren sind.So können sich die hungrigen Grizzlys genug Speck für den kommenden Winterschlaf anfressen. Für Sophie ist das besonders wichtig, die junge Bärin hat zum ersten Mal Nachwuchs bekommen. Doch gerade, da sie so sehr auf Nahrung angwiesen ist, bleiben die Lachse aus. Das Leben der Bärenfamilie steht auf dem Spiel. Wenn sie jetzt nicht genug fressen, werden Sophie und die Jungen den Winter nicht überleben. Erst mit mehreren Wochen Verspätung erreicht die Wanderung der Lachse ihr Ziel. Jedes Jahr begeben sich Zehntausende Ketalachse auf die über 2500 Kilometer lange Reise vom Beringmeer bis zu den Flüssen des Yukons, um dort zu laichen. Nun braucht Sophie all ihre Erfahrung und ihr Geschick, um die verlorene Zeit aufzuholen. Doch sie muss nicht nur die flinken Fische erbeuten, sondern auch den kräftigen Bärenmännchen aus dem Weg gehen, die ihren Jungen gefährlich werden könnten. Dank ihrer Ausdauer und des einzigartigen Nahrungsreichtums eines ganz besonderen Flusses, schafft Sophie es, sich gegen alle Widrigkeiten zu behaupten. In dieser unberührten und unbarmherzigen Eiswildnis im hohen Norden Kandas zieht die junge Bärenmutter erfolgreich zwei Jungtiere groß und führt sie durch das schwierigste Jahr ihres Lebens. Der Film erzählt die bemerkenswerte Geschichte der jungen Bärin Sophie, die sich von einer unerfahrenen Jungbärin zu einer aufopferungsvollen Bärenmutter entwickelt, stets begleitet von Tierfilmer Phil Timpany. Seit über 30 Jahren ist er in der abgelegenen Wildnis unterwegs und ermöglicht dadurch einen nie dagewesenen Einblick in das Leben der Grizzlys. Faszinierende Unterwasseraufnahmen von Bären zeigen die Lachsjagd aus ganz neuen Perspektiven. So gelingt dem Tierfilmer ein Verhaltensporträt von großer Intimität. Es erzählt vom Erwachsenwerden in den endlosen Weiten des Yukon. (Text: NDR) Das Beste aus Expeditionen ins Tierreich
Die Redaktion NDR Naturfilm hat für das 50-jährige Jubiläum im Jahr 2010 aus fünf Jahrzehnten die besten „Expeditionen ins Tierreich“-Sendungen ausgesucht. Herausgekommen ist eine unterhaltsame, dramatische, aber auch überraschende Hitliste von Tierfilmepisoden: die Störche im schleswig-holsteinischen Bergenhusen von 1960, aus dem Geburtsjahr der Reihe, oder der „Hightech-Blick“ in den heimischen Wald aus dem Jahr 2009, aufwändige Orchesteraufnahmen für die Reihe „Wilde Heimat“, lebensgefährliche Expeditionen in die entlegensten Regionen Russlands, die Tierwelt der Galapagosinseln oder in den Tälern des Harzes. Inge Sielmann und zahlreiche Tierfilmer kommentieren ihre Lieblingssendungen. (Text: NDR)Der blaue Planet – Auf hoher See (Big Blue)
45 Min.Die Hälfte der Erde ist von einer blauen Wüste bedeckt, der Hochsee. Die Tiere hier haben ein massives Problem: Nirgendwo können sie sich verstecken und Nahrung ist in dieser Unendlichkeit nur schwer zu finden. Der offene Ozean ist die Sahara der Meere. Wie schaffen es Delfine, Schildkröten und alle anderen Bewohner, auf Hoher See zu überleben? Die Kamerateams folgen den Tieren in den offenen Ozean. Mit revolutionärer Technik rücken sie ihnen so nahe auf die Haut oder die Schuppen wie nie zuvor. Spinner-Delfine etwa bilden riesige Suchtrupps von 5000 Tieren.Denn 10.000 Augen sehen mehr, 5000 Sonare orten mehr. Fischschwärme in der riesigen Weite auszumachen, ist eine Kunst. Wenn aber Laternenfische zum Laichen aus den Tiefen aufsteigen, geraten sie in ein Schlaraffenland. Die Fischchen sind die häufigsten Wirbeltiere der Welt und bringen es zusammen auf 600 Millionen Tonnen. Pottwale legen zwar nur einen Weg von etwa einem Kilometer zu ihrer Beute zurück, aber der führt in die Tiefe! Das Kalb muss auf die Mutter warten, denn so lange wie sie, über eine Stunde, kann es die Luft noch nicht anhalten. Ein Mikrofon fängt auf, wie sich die Klicks der Mutter verändern, wenn sie der Beute näher kommt, sie nutzt sie als Echolot. Produziert werden sie in ihrer gewaltigen Nase, der größten im Tierreich. Dem Team gelangen auch eindrucksvolle Bilder von den schlafenden Giganten, ein atemberaubender und zudem seltener Anblick. Denn kein anderes Säugetier kommt mit so wenig Schlaf aus, etwa einer Stunde am Tag. Doch dafür schlafen Pottwale tief und fest wie ein Mensch. Und wer weiß? Vielleicht träumen sie sogar. Viele Tiere nutzen Strömungen als ideales Transportmittel, vom Walhai bis zur Ohrenqualle. Ein Tier, oder besser gesagt ein Kollektiv aus vielen kleinen Tieren, setzt sogar noch ein Segel obendrauf. Die Portugiesische Galeere ist ein Zusammenschluss aus vielen Polypen, von denen einige eine gasgefüllte Blase, andere bis zu 30 Meter lange, nesselnde Fangarme und wieder andere Verdauungsenzyme bilden. Die Blase enthält eine Membran, die aufgestellt in den Wind für Vorschub sorgt. Auf sicherem Kurs durch die Wellen fängt die kleine Piratenmannschaft mit ihren gefährlichen Tentakeln bis zu 100 kleine Fische, täglich. Einfühlsam begleitet die Kamera auch ein alterndes Wanderalbatros-Paar, wie es sein wohl letztes Junges aufzieht. Jeden Tag fliegen die Eltern Hunderte von Kilometern über den Südatlantik, um immer wieder aufs Neue Nahrung herbei zu schaffen. Geschwächt von den Strapazen wird das Paar wohl nie wieder auf ihre Brutinsel Südgeorgien zurückkehren. Vor einer Gefahr, der jedes Jahr viele Albatrosse zum Opfer fallen, können selbst die besten Eltern ihr Junges nicht schützen: Plastik. Heutzutage gelangen pro Jahr fast acht Millionen Tonnen Plastik ins Meer, mit dramatischen Folgen. Denn Plastik zerfällt durch Sonne und Salzwasser in winzige Mikroteilchen, die oft Gifte enthalten. Kleine Organsimen filtern sie aus dem Wasser, große Organismen wie die Wale, die am Ende der Nahrungskette stehen, reichern sie in gefährlichen Konzentrationen an. Wird die Plastikflut in den Ozeanen nicht gestoppt, werden noch jahrhundertelang unzählige Tiere vergiftet. Die Tiere der Hochsee leben weiter entfernt von der Zivilisation als alle anderen. Aber nicht weit genug. Denn ihre Welt ist über Flüsse, Meere und Luft untrennbar mit der Lebenswelt dre Menschen verbunden. (Text: NDR) Der blaue Planet – Extremwelt Küste (Coasts)
45 Min.Ein Fisch, der Angst vorm Wasser hat: Sobald eine Welle kommt, springt er mit einem weiten Satz davon und rettet sich ins halbwegs Trockene. Dieser kleine Schleimfisch aus dem Pazifik ist einer von vielen ganz speziellen Charakteren aus einem der extremsten Lebensräume der Erde. Denn die Küstenlandstriche sind nicht einfach nur der Übergang von „nass“ zu „trocken“, sondern ein besonderer Grenzstreifen des Lebens mit Platz für ebenso besondere Talente. Die Episode „Extremwelt Küste“ der Reihe „Der Blaue Planet“ zeigt das Leben ausgefuchster Grenzgänger, die in beiden Welten zu Hause sind, mit diesen Extremen zu leben und für sich zu nutzen wissen.So wie die Seelöwen von Galapagos, die in schroffen Lavabuchten sogar die Hochgeschwindigkeitssprinter der Ozeane erbeuten können: Thunfische. Die einzigartige Jagdtechnik ist erst seit 2014 bekannt und wurde in dieser Naturdokumentation zum ersten Mal gefilmt. Täglich verändern sich Küsten unter außerirdischem Einfluss: Der Mond führt zwei Mal am Tag zu Ebbe und Flut. Im Wechselbad der Gezeiten leben die Organismen ständig mit dem Risiko auszutrocknen oder von der Sonne versengt zu werden. Wer hier überleben will, muss extrem flexibel sein. Und so werden in den idyllisch wirkenden Gezeitentümpeln dramatische „Kammerspiele“ gegeben: Seesterne werden zu unerbittlichen Räubern, Napfschnecken verteidigen sich mit einem persönlichen Bodyguard gegen die fünfarmigen Jäger. Zwischen den Welten lebt es sich für die Grenzgänger voller Risiko: Papageitaucher werden im Nordmeer von Luftpiraten drangsaliert. An den Felsküsten Brasiliens laufen Rote Klippenkrabben täglich um ihr Leben, um zu ihren Weidegründen zu kommen. Unterwegs lauern schlangengleiche Muränen und Kraken mit acht Armen. Pinguine müssen auf der Insel Südgeorgien, wegen ihrer gewaltigen Tierdichte auch die „Serengeti der Antarktis“ genannt“, einen gewaltigen Wall aus Speck passieren: tonnenschwere Seeelefanten, die bei ihren Revierkämpfen leicht einen der Vögel zerquetschen könnten. Doch auch die Küsten selber werden angegriffen. Mancherorts knallen wahre Monsterwellen bis 30 Meter Höhe gegen das Land und die peitschende Brandung nagt bizarre Felsformationen aus Steilwänden. Ein Kampf zwischen zwei Welten. (Text: NDR) Der blaue Planet – Leuchtende Tiefsee (The Deep)
Keine schwarze lichtlose Welt: Sobald sich die letzten Sonnenstrahlen im Dunkel verloren haben, wird aus der Tiefsee ein Lichtermeer. Überall blinkt, glimmt und funkelt es. Etwa 90 Prozent aller Lebewesen illuminieren die Finsternis mit eigenem Licht. Wahrscheinlich ist dieses psychedelische Feuerwerk unter Wasser die häufigste Form der Kommunikation auf dem Planeten, mal sind es Liebesbezeugungen, mal tödliche Fallen. Der zweite Teil der spektakulären Serie „Der Blaue Planet“ taucht ein in eine Welt extremer lebensfeindlicher Bedingungen.Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde, bevölkert von seltsamen Kreaturen mit Horrormäulern und Restlichtverstärkern. Hier lebt ein Panoptikum extravaganter Geschöpfe: schlurfende Seekröten, schielende Kraken und Tintenfische, die wie Pfannkuchen aussehen, Würmer, die wie Zombies daherkommen, und „Halsabschneideraale“. Viele Korallenstöcke, die in der Finsternis in 6.000 Metern Tiefe wachsen, sind älter als die Pyramiden Ägyptens. Eine Sensation gelingt in acht Kilometern Tiefe: Ein extrem belastbarer Tauchroboter, der einem Druck standhält, der tausendmal größer ist als an der Meeresoberfläche, filmt den ätherischen Schneckenfisch. Es ist der am tiefsten lebende Fisch, der je gefunden wurde, ein Wesen wie von einem anderen Stern. Überhaupt filmen bemannte Tauchboote und Tauchroboter in den Meeren oft genug ein Universum, das an ferne Galaxien erinnert, voller unbekannter, nie gesehener Landschaften: Große Schlickwüsten bedecken die Hälfte der Erdoberfläche, gigantische Canyons, am Grund des Golfs von Mexiko blubbern Schlammvulkane, die Methanblasen ausspeien, wabern giftige Salzseen. Drei Viertel aller vulkanischen Aktivitäten der Erde finden in der Tiefsee statt. An regelrechten Hexenkesseln, den Schwarzen Rauchern, erzeugen Bakterien aus heißer Giftbrühe unschädliche Substanzen, sodass sich dort artenreiche Lebensgemeinschaften drängen, direkt dort, wo das heiße Innere der Erde nach außen dringt. Und vielleicht liegt sogar die Lösung für das Geheimnis, wie das Leben auf der Erde entstand, auf dem Grunde der Tiefsee. Eine Koproduktion von BBC, WDR, NDR, BR und SWR. (Text: NDR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail