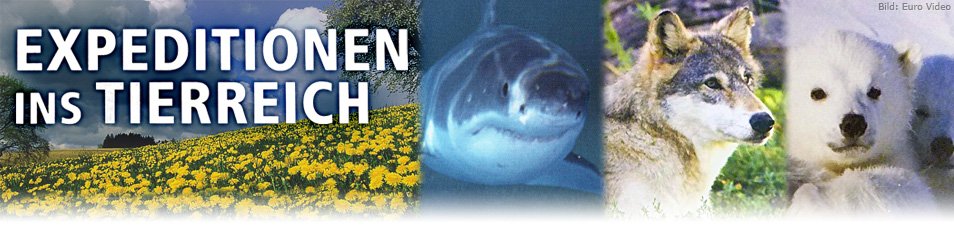unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 13)
Wildes Deutschland: Die Lausitz
45 Min.Weit im Osten Deutschlands liegt die Lausitz, das Land der 1.000 Teiche, eine Landschaft voller Gegensätze. In diesem Film aus der Reihe „Wildes Deutschland“ gewähren die Filmemacher Henry M. Mix, Yann Sochaczewski und Axel Gebauer außergewöhnliche Einblicke in die Region. In der beschaulichen Teichlausitz leben seltene Tiere wie Fischotter oder die sonderbare Rohrdommel. In den Bruchwäldern ziehen sogar Elche wieder ihre Kälber groß. Nur wenige Kilometer entfernt gleicht die Lausitz einer Mondlandschaft. Jahrzehntelanger Braunkohletagebau hat in der Lausitz riesige Abraumhalden und Bergbauseen hinterlassen.Nirgendwo sonst in Deutschland wurde die Landschaft so großflächig und radikal verändert wie hier. Doch die Natur zwischen Brandenburg und Sachsen kehrt zurück: Wolfsrudel und Rothirsche durchstreifen Truppenübungsplätze. Farbenfrohe Wiedehopfe und Bienenfresser erobern Rekultivierungsflächen. Weite Teile der Lausitz sind „Wildes Deutschland“ von seiner spannendsten Seite. Wenn es Frühling wird, erfüllen seltsame Laute die friedliche Wasserwelt der Teichlausitz: Die Balzrufe der äußerst seltenen Rohrdommel klingen so, als würde man in eine Flasche pusten. Kilometerweit sind die dumpfen Töne zu hören. Entdecken kann man die Rohrdommel allerdings kaum: Wenn sie sich beobachtet fühlt, reckt sie Kopf und Schnabel steil nach oben und bewegt sich wie die Schilfhalme im Wind. Ihr braunschwarzes Gefieder ist eine weitere Tarnung. Nicht nur die Teichlausitz bietet Wildtieren wertvollen Rückzugsraum. Selbst dort, wo der Tagebau die Landschaft extrem verändert hat, kehren Neusiedler zurück. Rekultivierungsflächen und Truppenübungsplätze sind inzwischen Heimat von Tieren, die hierzulande schon so gut wie ausgestorben waren. Schillernde Bienenfresser und Wiedehopfe brüten in der Heide, weil sie dort reichlich Insekten finden. Wölfe, die aus Polen eingewandert sind, haben auf den Manöverplätzen Fuß gefasst. Die fischreichen Teichgebiete werden seit Jahrhunderten zur Karpfenzucht genutzt. Im Sommer werden sie zur Kinderstube für Wasservögel. Die Rohrdommeln haben Nachwuchs bekommen, Kraniche und Singschwäne machen mit ihren Küken erste Ausflüge. Wo Wasser ist, fühlen sich auch Waschbären und Marderhunde wohl; beide Arten stammen ursprünglich nicht aus Europa, gehören mittlerweile jedoch zur Lausitzer Tierwelt. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 20.12.2017 NDR Wildes Deutschland – Die Müritz
45 Min.Die Müritz ist mit 117 Quadratkilometern der größte See auf deutschem Gebiet, aber bei Weitem nicht der einzige im Nordosten der Republik. Allein die Mecklenburgische Seenplatte zwischen Waren und Feldberg umfasst etwa 2.000 Seen. Dank des Müritz-Nationalparks ist die Artenvielfalt in diesem Gebiet besonders hoch: Die Hälfte aller deutschen Kraniche brütet in Mecklenburg-Vorpommern. Der Fischadler ist der Charaktervogel an der Müritz, der quirlige Fischotter geht hier auf die Jagd, vom Aussterben bedrohte Rotmilane kreisen am Himmel. Fred Bollmann kennt den Müritz-Nationalpark wie kaum ein anderer. Der ehemalige Ranger und ehrenamtliche Naturschützer setzt sich aktiv für den Erhalt „seiner“ Wildnis ein. Zwei Jahre dauerten die Dreharbeiten für diesen Film aus der Reihe „Wildes Deutschland“. Dabei ist ein einzigartiges Porträt dieser Region entstanden. (Text: NDR)Wildes Deutschland: Die Uckermark
Seen und Sölle, die nach der Eiszeit entstanden sind, Flussläufe und Moore, ausgedehnte Wälder, Felder und Wiesen prägen die Uckermark. Im Nordosten Brandenburgs, 80 Kilometer von Berlin entfernt und in direkter Nachbarschaft zu Mecklenburg-Vorpommern und Polen, ist die Uckermark mit über 3.000 Quadratkilometern der größte Landkreis Deutschlands. Dort finden sich beste Voraussetzungen für die Natur: 60 Prozent der Uckermark stehen unter Schutz, im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin im Süden, im Nationalpark Unteres Odertal im Osten und im Naturpark Uckermärkische Seen im Nordwesten.In der Uckermark trifft man auf besonders viele seltene Tier- und Pflanzenarten: Adler brüten in der Waldmark, Fischotter jagen in klaren Flüssen nach Forellen und Neunaugen, Biber stauen Bäche zu Seen, Dachse, Marderhund und Füchse leben gemeinsam mit Hirschen und Rehen in der Feldmark. Die abwechslungsreiche, von der Eiszeit geprägte Landschaft ist aber vor allem die Metropole der Kraniche Europas. In naturbelassenen Wäldern rund ums Plagefenn, dem ältesten Naturschutzgebiet Deutschlands, finden die eindrucksvollen Vögel beste Bedingungen, um ihren Nachwuchs aufzuziehen. Warum aber ist die Uckermark als Lebensraum so attraktiv für viele Tiere? Der Mensch ist auf dem Rückzug, nach 800 Jahren Besiedlungskultur verlässt er heute zunehmend die Region, zieht in die Städte und überlässt der Natur immer mehr Raum. Diese Dokumentation erzählt von einem ungewöhnlichen Landstrich, der vom Menschen seit Jahrhunderten stark beeinflusst und dennoch naturnah ist. Gefühlvoll setzt Christoph Hauschild die Uckermark in Szene. Hochstabilisierte Aufnahmen aus dem Helikopter zeigen die Region aus Perspektiven aus der Luft, extreme HD-Zeitlupen von Kranichen, Fischadlern oder Fledermäusen sowie aufwendige Zeitrafferaufnahmen gewähren Einblicke in die Welt der tierischen Bewohner im Nordosten Brandenburgs. Tierfilmer Christoph Hauschild porträtiert die wohl einsamste Region Deutschlands und gibt seltene Einblicke in eine Natur, die man anderenorts schon lange schmerzlich vermisst. (Text: NDR) Wildes Deutschland: Die Zugspitze
45 Min.Die Zugspitze ist mit 2.962 Metern der größte Gipfel des Wettersteingebirges. Für viele ist der höchste Berg Deutschlands Inbegriff für Übererschließung, Massentourismus und Raubbau an der Natur. Doch die Zugspitze hat auch eine andere, unbekannte Seite. Abseits der Touristenscharen finden sich einsame und noch fast unberührte Winkel und Täler. Hier verbergen sich vielfältige Lebensräume mit zahlreichen Naturschätzen. Das Zugspitzmassiv ist der einzige Ort in Deutschland, der bis in die Regionen von ewigem Schnee und Eis hinaufreicht. Eine Attraktion und Reise wert, doch hat der Berg weitaus mehr zu bieten.So finden sich an seinen Flanken Highlights wie zum Beispiel die spektakuläre Partnachklamm oder der wildromantische Eibsee, der wegen seines türkisblauen Wassers und seiner malerischen Buchten oft auch „Bayerische Südsee“ genannt wird. Jürgen Eichinger zeigt in seinem Film eine faszinierende Reise vom Tal zum Gipfel, von einer prallen Fülle des Lebens bis in scheinbar unwirtliche Gipfelregionen. Er steigt an den Ufern eines Wildbachs auf und zeigt, wie sich mit der Höhe die Vegetation und das Landschaftsbild samt seiner Bewohner verändern. Man erfährt auch, weshalb mit zunehmender Höhe der Artenreichtum von Flora und Fauna abnimmt und wie sich Tiere und Pflanzen an diese harten Umweltbedingungen anpassen, um dort zu überleben. Der erste Eindruck eines Hochgebirges mag der einer leblosen, nackten Stein- und Eiswüste sein. Im Gegenteil ist es jedoch reich gefüllt mit Leben. Im Laufe von Jahrmillionen haben zähe Tier- und Pflanzenarten gelernt, Unwettern und Wintereinbrüchen zu trotzen. Alpenschneehuhn, Gämse und Murmeltier tragen ein isolierendes Haarkleid. Kreuzotter, Bergeidechse und Alpensalamander nutzen mit ihrer dunklen Färbung die schwache Wärmestrahlung bestmöglich aus. Mit zunehmender Höhe wird der Wildbach mehr und mehr die Lebensader für extrem unterschiedliche Lebensräume. Doch schon binnen weniger Jahre wird er weitgehend versiegt sein, denn seine Quelle, der Zugspitzgletscher, schmilzt durch die Klimaerwärmung dahin. Damit steht auch den Bewohnern an seinen Ufern ein neuer, in dieser Form noch nie da gewesener Überlebenskampf bevor. Jürgen Eichinger ist es gelungen, einzigartige Bilder von der Zugspitze einzufangen. Mit einer Drehzeit von drei Jahren ist der Film wohl der aufwendigste, der über Deutschlands höchsten Berg gemacht wurde. Auch das ist ein Superlativ der Zugspitze. (Text: NDR) Wildes Deutschland – Die Zugspitze: Eine Reise auf den höchsten Berg Deutschlands
45 Min.Wildes Deutschland: Grenzgänger am Grünen Band
45 Min.Quer durch Deutschland, von der Ostsee bis zum Vogtland, sind auf 1.400 Kilometern Länge über 100 verschiedene Biotope mit seltenen Tier- und Pflanzenarten verbunden. Als das Grüne Band wird das Refugium bezeichnet. Seltene Tierarten wie wie Schwarzstorch, Fischotter, Wanstschrecke oder Braunkehlchen finden ideale Bedingungen in Sumpfgebieten, Mooren, Pionierwäldern oder auf Magerrasenflächen. In diesem einzigartigen Biotopverbund leben über 5.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten, darunter über 600 stark gefährdete Gattungen. Die langgestreckte grüne Oase ist ein besonders geschütztes Gebiet, dessen Ursprung lebensfeindlicher nicht sein konnte.Vor gut einem Vierteljahrhundert noch teilte dieser Streifen zwei politische Systeme, zerschnitt Deutschland in zwei Teile, trennte Familien, Freunde und Völker. Mit Minenfeldern, Stacheldraht und Mauern, rund um die Uhr bewacht. Doch statt Grenzwächter sind heute Wächter der Natur am Grünen Band unterwegs. Sie wachen in dem Schutzgebiet über die tierischen Grenzgänger, die zu Zeiten des Eisernen Vorhangs hier aufgehalten wurden oder sich schon damals nicht aufhalten ließen. Dazu zählen die Wildkatzen, die über den Korridor nun vom Vogtland nach Bayern wandern können. Seeadler, die in den angrenzenden Fluren in Niedersachsen ihren Nachwuchs großziehen und in den Gewässern von Sachsen-Anhalt die Fische fangen. Oder Biber, die immer in der DDR heimisch waren und erst nach deren Ende in die westlichen Feuchtbiotope aufbrachen. Der Tierfilmer Uwe Müller beobachtete das Leben an der alten Grenze über ein Jahr lang mit modernster HD-Technik zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Bei seinen Wachdiensten in den blühenden Landschaften und neu geschaffenen Lebensräumen kamen ihm Jäger und Gejagte, aber auch Grenzzeugen vor die Kamera. Der Film zum 25. Jubiläum des Grünen Bandes lässt diesen längsten Biotopverbund Deutschlands dadurch gleichzeitig auch als besondere Erinnerungsstätte lebendig werden. (Text: NDR) Wildes Deutschland – Unbekannte Tiefen: Das Erzgebirge
Wildes Deutschland – Unbekannte Tiefen: Vom Harz bis zur Nordsee
Die heimischen Gewässer sind die vielleicht geheimnisvollsten Biotope in Deutschland. Der Film begibt sich auf eine außergewöhnliche und teils gefährliche Reise vom Harz bis an die Nordsee. Durch modernste Unterwasserkameratechnik sowie Kran- und Flugaufnahmen gewährt der Film spannende Einblicke in eine bis dahin oft verborgen gebliebene Welt. Wenn im Frühling langsam Tauwetter einsetzt, kommen die schwarzen Augen der Vulkaneifel oder die schneebedeckten Wasserräder des Harzer Treppenregals wieder in Fluss.Die Kamera zwängt sich durch die schmalen Tunnel, die den Harz kilometerweit durchziehen und Heimat von Fröschen und Bergmolchen sind. Der Harz birgt ein weiteres Geheimnis. Vor Millionen von Jahren schuf das Wasser eine bizarre unterirdische Welt aus Tropfsteinen: die Hermannshöhle. Hier lebt in völliger Dunkelheit der Grottenolm, ein fabelhaftes Wesen. Die Reise geht weiter nach Sachsen. Dort hat der Mensch über Jahrzehnte durch Raubbau an der Natur in riesigen Braunkohle-Tagebaugebieten die Erde durchgraben. Die Natur erobert sich nun an den aufgegebenen Flächen langsam ihren Platz zurück. Die Mecklenburger Seenplatte bietet einen ganz anderen Einblick in die Unterwasserwelt. Dort liegen von den Gletschern der Eiszeit erschaffen unzählige Seen dicht an dicht und bieten mit ihrem riesigen Fischvorkommen die Grundlage für Seevögel wie Fischadler oder Rohrdommel. Über die Burgen des Bibers hinweg führt die Reise zur Elbe, wo der Versuch gestartet wurde, den ausgestorbenen Europäischen Stör wiederanzusiedeln. Ein aufwändiges und langfristiges Vorhaben. Zu Tausenden werden die jungen Fische in den Nebenarmen der Elbe ausgesetzt, in der Hoffnung, dass einige davon in 18 bis 20 Jahren zu ihren Laichplätzen zurückkehren. Vorher allerdings müssen sie den Gefahren von Stellnetzen, Schleusen, Wehren, Schiffsschrauben oder ihren natürlichen Feinden trotzen, um am Ende vorbei an der Hafenstadt Hamburg zur Nordsee zu gelangen. Die Reise endet bei Helgoland, dem nordwestlichsten Außenposten Deutschlands. (Text: NDR) Wildes Deutschland – Unbekannte Tiefen: Von den Alpen zum Rhein
Deutschlands Binnengewässer, Flüsse, Bäche und Seen, sind ein farbenprächtiges und teilweise kaum entdecktes Refugium in der Natur. Ein Blick in die Tiefe zeigt bizarre und bis dahin oft noch völlig unbekannte Welten: vom Mikrokosmos bis hin zu den Giganten Stör und Waller, die größten heimischen Süßwasserfische. Eine außergewöhnliche Expedition führt von den schneebedeckten Gipfeln und Gletschern der Alpen über die Mittelgebirge bis an die Nordsee und macht in der zweiteiligen Reihe „Wildes Deutschland“ das vielleicht farbenprächtigste, sicherlich aber das unbekannteste Bild von Deutschlands Natur sichtbar.Die Reise beginnt am Watzmann. Winzige Tropfen lösen sich jedes Jahr von der Decke der Eiskapelle, vereinen sich zu Rinnsalen, um anschließend als Eisbach ins Tal zu rauschen. Der Röthbach, gespeist durch Unmengen von Schmelzwasser, stürzt als Deutschlands höchster Wasserfall 475 Meter in die Tiefe, um am Fuße des Bergmassivs einfach zu versickern. Auch die Gründe des Berchtesgadener Königssees beherbergen ein faszinierendes Universum. Die nächste Station ist Deutschlands tiefster See, der Bodensee. Einer seiner Bewohner ist der riesige Waller, der bis zu drei Meter Länge erreicht. Vom Bodensee geht es hinauf in den Schwarzwald zum geheimnisvollen Schluchsee mit seinem dunklen Wasser und der artenreichen Wutachschlucht, Deutschlands längstem Canyon. Die Schwäbische Alb mit unzähligen Karsthöhlen, die im Verlauf von Millionen Jahren vom Wasser geschaffen wurden, bietet eine Welt wie von einem anderen Stern. Bizarre Tropfsteinhöhlen und unterirdische Seen warten bis heute darauf, entdeckt zu werden. Auch der Altrhein, der als „Amazonas Deutschlands“ gilt, ist ein Beispiel, dass seine prächtige Unterwasserwelt wirklich Teil der heimischen Natur ist. Mit modernster Unterwasserkameratechnik, sowie Kran- und Flugaufnahmen sind Bilder einer faszinierenden Reise in Deutschlands unbekannte Tiefen von den Alpen zum Rhein entstanden, die dem Betrachter bisher verborgen geblieben waren. Der zweite Teil „Wildes Deutschland“ führt in Deutschlands Norden, wo eine ganz andere Unterwasserwelt zu finden ist. (Text: NDR) Wildes Deutschland – Vorpommerns Küste
Im Nordosten liegt an der Ostsee eine der schönsten Naturlandschaften Deutschlands. Die Natur an Vorpommerns Küste ist außergewöhnlich. Die einzigartige Landschaft zwischen Ostsee und Bodden steht seit 1990 unter strengem Schutz. Der Nationalpark ist mit über 80.000 Hektar neben dem Nationalpark Wattenmeer an der Nordsee das größte Schutzgebiet Deutschlands. (Text: PHOENIX)Wildes Frankreich
Leben wie Gott in Frankreich: Dieses Sprichwort kommt nicht von ungefähr. Doch nicht nur die Menschen und ihr Lebensstil machen das Savoir-vivre in Frankreich aus; das größte Land Westeuropas bietet eindrucksvolle Naturlandschaften und eine faszinierende Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Die Pyrenäen im Südwesten Frankreichs bilden die natürliche Grenze zu Spanien. Diese noch sehr ursprüngliche und schroffe Bergwelt ist die Heimat des mächtigsten europäischen Raubtiers: Der Braunbär lebt dank des vielfältigen Nahrungsangebots in der Natur der Pyrenäen.Auch der Südosten ist von Bergen geprägt. Hier verlaufen die Alpen. Hoch in der Luft zieht der Steinadler seine Kreise, stets nach Beute Ausschau haltend. Ein anderer großer Jäger in dieser Region ist der Wolf. Er war ebenso wie der Braunbär fast ausgerottet, kehrt jedoch nach und nach in seine angestammten Reviere zurück. Die Vogesen im Nordosten von Frankreich sind ein Mittelgebirge mit Gipfeln bis knapp über 1.000 Meter Höhe. Die dichten Wälder hier beherbergen zahlreiche wilde Tiere, darunter auch Dachse. Ein Weibchen sucht einen Partner, um eine Familie zu gründen. Doch zuvor wartet noch der Hausbau. Südlich von Paris liegt der Wald von Fontainebleau, eines der größten Waldgebiete Westeuropas. Dieser königliche Forst bietet viele faszinierende Geschichten. Eine davon handelt von zwei ausgewachsenen Hirschbullen. An der Atlantikküste nördlich von La Rochelle liegt der Marais Poitevin, eine ausgedehnte Sumpflandschaft mit einer spektakulären Tier- und Pflanzenwelt. Ursprünglich Marschland, das lange Zeit regelmäßig vom Meer überflutet wurde, entstand der heutige Marais erst durch den Eingriff des Menschen: Im 12. Jahrhundert legten Benediktinermönche hier Dämme an und damit weite Bereiche trocken. Diese Flächen wurden landwirtschaftlich genutzt. Heute macht das Feuchtgebiet nur noch etwa 30 Prozent des Marais’ aus. Furchterregend aussehende Larven verwandeln sich in schillernde Libellen. Diese eleganten „Akrobaten der Lüfte“ begegnen anderen Flugkünstlern: den Hufeisennasen. Ihren Namen verdankt diese Fledermausart den charakteristischen Hautlappen um ihre Nase. Auch die Hufeisennasen bekommen gerade Nachwuchs: Das Jungtier wird einen Monat lang von seiner Mutter gesäugt, dann erst kann es seiner eigenen Wege fliegen. Die Cevennen sind eine wilde Bergregion im Süden Frankreichs. Hier haben Flüsse im Laufe der Zeit tiefe Canyons in das Kalkgestein geschnitten. Zwischen und über den Felswänden kreisen die Geier. Diese Greifvögel haben keinen allzu guten Ruf, aber sie spielen eine wichtige Rolle in diesem Ökosystem. Als Entsorgungstrupp der Natur beseitigen sie Tierkadaver und verhindern so, dass Bakterien und Verwesungsgifte das Wasser verseuchen, auf das alle Lebewesen hier angewiesen sind. Eine ganz spezielle Rolle im „Wilden Frankreich“ spielt eine Mittelmeerinsel: Korsika beherbergt eine sehr ursprüngliche Natur, das Naturschutzgebiet La Scandola ist das älteste von ganz Frankreich. Sein Symboltier ist der Fischadler, dessen Bestand hier seit einiger Zeit wieder zunimmt. Aber auch die Meeresgewässer vor La Scandola enthalten einen ungeheuren Reichtum an Tieren und Pflanzen. Ein besonderer Bewohner ist der Zackenbarsch. Zackenbarsche sind Hermaphroditen. Sie werden alle als Weibchen geboren, aber im Alter von zehn Jahren wechseln sie das Geschlecht und werden zu Männchen. Im Frühsommer versammeln sich Männchen und Weibchen. Sie umtanzen einander und wechseln dabei ihre Farben. Alles zum Zwecke der Verführung und Vermehrung. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere So. 04.06.2017 NDR Wildes Grönland – Eiswelt im Wandel
45 Min.Nirgendwo sonst ändert sich die Erde gegenwärtig so rasant wie in den Polarregionen. Tierfilmer Lars Pfeiffer hat jahrelang die Natur Grönlands hautnah verfolgt. Es gibt Tiere, die mit den Veränderungen mithalten werden, von anderen sind es vielleicht die letzten eindrucksvollen Bilder. Grönland besitzt das zweitgrößte zusammenhängende Eisschild nach der Antarktis. Aus Tausenden Gletschern werden hier täglich gewaltige Eismassen ins Meer gedrückt. Spektakuläre Aufnahmen zeigen Eisberge von der Größe einer Kathedrale. Drumherum blüht das Plankton und lockt immer mehr Wale aus südlicheren Regionen zum Polarkreis.Narwale, die geheimnisvollen Bewohner des Packeises, werden dagegen weniger. Ihr meterlanges Horn gab lange Rätsel auf. Wikinger brachten es als vermeintliches Einhorn nach Europa und erzielten Fantasiepreise. Lars Pfeiffer gelingen einzigartige Aufnahmen von ganzen Narwal-Gruppen und Tieren mit doppeltem Stoßzahn. Nur wenige Hundert mit dieser Anomalie soll es weltweit geben. Eisbären sind ebenfalls auf Packeis spezialisiert. Nur dort gelingt es ihnen, sich an ihre Hauptbeute Robben heranzuschleichen. Wo das Packeis zu dünn wird, werden die schweren Tiere immer häufiger dabei beobachtet, wie sie ihr Jagdverhalten anpassen und Vogelnester plündern. Dafür klettern sie erstaunlich geschickt auf steile Berge und Klippen. Andere Kletterkünstler sind die mit den Ziegen verwandten Moschusochsen. Wo das Eisschild abschmilzt, entstehen für sie neue Lebensräume mit frischem Grün. Dafür müssen die Bewohner der Polarregion ein Wetterphänomen erst noch kennenlernen: Regen. Lars Pfeiffer fängt die wohl ersten Tropfen in Nordgrönland ein, die auf verdutzte Walrosse fallen. Seit Jahrtausenden hat es hier immer nur geschneit. Auch für die Inuit bergen die Veränderungen Chancen und Risiken zugleich. Ihre Kultur ist auf die Jagd im Packeis gegründet. Noch heute gehen einige mit kleinen Kanus auf Walfang. Jetzt treten Gesteinsformationen zu Tage, die zu den ältesten des Planeten gehören. Ein Rohstoffschatz, der die knapp 60.000 Einwohner Grönlands reich machen könnte. Begleitet wird die Dokumentation von der Musik des vielfach preisgekrönten Komponisten Jörg Magnus Pfeil und der färöischen Sängerin Eivør Pálsdóttir. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 26.02.2025 NDR Wildes Großbritannien: Frühling und Sommer (The Great British Year: Summer / The Great British Year: Spring)
Großbritannien ist berühmt-berüchtigt für sein Wetter. Das Land ist umgeben von Meeren, über die Stürme peitschen. Das Klima formt unberechenbar und ständig wechselnd die Natur im Nordwesten Europas. Die Jahreszeiten dort: ein grandioses Schauspiel in vier Akten. Seit Monaten hat der Winter die Britischen Inseln fest im Griff. Kälte und fehlendes Licht werden für viele Bewohner zur Strapaze. Doch schon bald wird sich alles ändern. Der Frühling beginnt. Bienen nutzen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, um Nektar und Pollen zu sammeln. Vor der Küste Großbritanniens beginnt jetzt die Paarungszeit der Seepferdchen mit einem zauberhaften Tanz.Die zerbrechlichen Fische pflanzen sich auf ungewöhnliche Weise fort. Die Weibchen legen ihre Eier in die Bruttasche am Bauch des Männchens, die er bis zum Schlupf mit sich herumtragen wird. Wenn aus Frühling Sommer wird, schlüpfen in den Flüssen des Königreichs Tausende Eintagsfliegen. Immer wieder fliegen die Männchen auf, nur um sich graziös fallen zu lassen. Bevor es Abend wird, kehren die Weibchen zum Wasser zurück und legen die befruchteten Eier ab. Mit dem sonnigen Tag endet ihr Leben. Die Heidelandschaften Großbritanniens zählen zu den Sommerquartieren eines seltsamen Vogels: dem Ziegenmelker. Tagsüber sitzt er gut getarnt und bewegungslos da. Sein nächtliches Verhalten dagegen ist spektakulär. Neueste Aufnahmen aus Wärmebildkameras zeigen das Balzverhalten des merkwürdigen Vogels. Im Hochsommer zieht das Meeresplankton wahre Ungetüme in die seichten Gewässer vor Großbritannien: Riesenhaie. Mit zehn bis zwölf Meter Länge zählen sie zu den größten Fischen der Erde. Ein Schauspiel, das sich sogar von Land aus beobachten lässt. Der Zweiteiler „Wildes Großbritannien“ porträtiert die abwechslungsreiche Natur der Britischen Inseln. Bewegte Zeitraffer, hochstabilisierte Flugaufnahmen und extreme Zeitlupen präsentieren die Tiere und die Natur des Britischen Königreichs in seltener visueller Opulenz. (Text: NDR) Wildes Großbritannien: Herbst und Winter (The Great British Year: Autumn / The Great British Year: Winter)
Großbritannien ist berühmt-berüchtigt für sein Wetter. Das Land ist umgeben von Meeren, über die Stürme peitschen. Das Klima formt unberechenbar und ständig wechselnd die Natur im Nordwesten Europas. Die Jahreszeiten dort: ein grandioses Schauspiel in vier Akten. Herbst in Großbritannien. Jedes Wochenende im Oktober bewundern Tausende Besucher im Landschaftsgarten von Stourhead die Wandlung der Natur: Das Laub von Ahorn, Esche, Buche und Eiche veranstaltet ein Feuerwerk der Farben. Für viele Tiere sind die kürzer werdenden Tage ein Signal: Sikahirsche versammeln einen Harem, um ihn in erbitterten Kämpfen gegen Rivalen zu verteidigen.Eichhörnchen verstecken Nüsse und Eicheln als Vorrat für die kalte Jahreszeit. Im Gegensatz zu ihnen frisst die Haselmaus jetzt so viel sie kann, um anschließend den Winter in ihrer Höhle zu verschlafen. Der Herbst ist die Zeit der Regenwürmer, die unzählige Tonnen organischen Abfall recyceln. Ohne sie würden die Bewohner des Königreichs unter Blättern ersticken. Mitten im Winter bringen Kegelrobben an den Küsten Großbritanniens ihre Jungen zur Welt. Zeitgleich fegen heftige Stürme über das Land. Hohe Wellen sind eine große Gefahr für kleine Kegelrobben. Passen sie nicht auf, werden sie von den Brechern für immer ins Meer gezogen. Sobald der erste Schnee fällt, wird Großbritannien zu einem Winterwunderland. Die Federn der Moorschneehühner und das Fell der Schneehasen verändern jetzt ihre Farbe und werden weiß. Gut getarnt sind sie so für Greifvögel fast unsichtbar. Auch für Eulen bedeutet die weiße Pracht kein Problem. Aus der Luft orten sie selbst feinste Mäusegeräusche unter der Schneedecke. Der Zweiteiler „Wildes Großbritannien“ porträtiert die abwechslungsreiche Natur der Britischen Inseln. Bewegte Zeitraffer, hochstabilisierte Flugaufnahmen und extreme Zeitlupen präsentieren die Tiere und die Natur des britischen Königreichs in seltener visueller Opulenz. (Text: NDR) Wildes Hamburg – Tiere in der Stadt
Blitzschnell wie ein Pfeil fliegt ein Wanderfalke hinauf zum Turm der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Hier hat er sein Nest, der wohl schnellste Vogel überhaupt. Im Dach zieht er vier Junge groß. Nur ein paar Kilometer weiter entfernt, auf dem Ohlsdorfer Friedhof, schlägt ein Uhu seine Krallen in eine Ratte. Hier auf dem Parkfriedhof, unbemerkt von den meisten Besuchern der Grabstätten, lebt die größte Eulenart der Welt. Die Zahl der Wildtiere, die es in Hamburg gibt, überrascht manchen, viele Arten würde man hier nicht erwarten.Die Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen haben sich zwei Jahre lang mit der Kamera auf die Suche nach den „heimlichen Untermietern“ gemacht. In Hamburg leben knapp zwei Millionen Menschen. Bei vielen steht die Hansestadt für Hafen, Schiffe und Reeperbahn. Aber die Metropole hat auch jenseits der sündigen Meile eine „wilde“ Seite. Die Stadt an Elbe und Alster bietet mehr Tier- und Pflanzenarten Lebensraum als jede andere deutsche Großstadt. Über 50 Säugetierarten und etwa 160 verschiedene Vogelarten leben hier. Die Alsterschwäne sind Hamburgs Wahrzeichen und Glücksbringer zugleich. Einst durften nur Herrscher die edlen Ziervögel auf offenen Gewässern halten, so schafften die Hanseaten sich diese Tiere an, um dadurch die Unabhängigkeit der Stadt zu betonen. Die Höckerschwäne brüten direkt am Ufer der großen Außenalster und lassen sich weder von den flanierenden Spaziergängern noch von deren Hunden stören. Die kalte Jahreszeit verbringen sie im Winterquartier von Schwanenvater Nieß. Im Hafen ziehen Füchse ziehen ihre Jungen auf. Sie finden Nahrung in einem nahe gelegenen Tanklager. Dort hat sich eine Kolonie Sturmmöwen angesiedelt. Bis auf wenige Arbeiter unterbricht niemand die Ruhe der Vögel auf dem weitläufigen Gelände. Selbst die bunten Austernfischer fühlen sich wohl in der Stadt. Sie brüten auf dem Kiesdach eines Einkaufszentrums. Zwischen den Steinen sind ihre Eier hier optimal getarnt, wie am Strand. Die Liste der in Hamburg angesiedelten Wildtiere birgt so manche Überraschung: Direkt gegenüber von Blankenese fischen Seeadler in der Elbe. Europas größte Hirsche röhren im städtischen Naturschutzgebiet Duvenstedter Brook. Vom Dach eines Wohnhauses aus sammeln Bienen ihren Honig von den Blüten der Straßenbäume. Hornissen quartieren sich in Vogelhäuschen ein. Und Iltisse haben ihren Bau im Schuppen einer Alstervilla. Ein Grund für die Artenfülle in Hamburg: Mit einer Fläche von rd. 755 Quadratkilometern ist die Stadt eine der am dünnsten besiedelten Metropolen der Welt und bietet eine Vielfalt an Lebensräumen. Hamburg ist nicht nur für die Menschen die „Perle des Nordens“, sondern auch für Pflanzen und Tiere. (Text: NDR) Wildes Irland – Die grüne Insel
45 Min.Die wilde Atlantikküste Irlands galt vor der Entdeckung Amerikas als das Ende der Welt. Die spektakulären Landschaften ziehen Menschen seit jeher in ihren Bann, dienen oft als Kulisse für große Hollywoodproduktionen wie zuletzt „Star Wars“. Die Helden in diesem Film sind jedoch die überraschend vielen Tierarten, die es auf der „Grünen Insel“ gibt: Wale und Riesenhaie, die im Ozean nach Nahrung suchen, Papageientaucher und Steinadler, die die Lüfte beherrschen, Rothirsche, deren Brunftrufe im Herbst über die Seen von Killarney schallen. „Wildes Irland“ zeigt die faszinierende Natur und bunte Tierwelt eines Landes, das den Elementen des Atlantiks ausgesetzt ist.Wie ein Smaragd ganz im Westen Europas war Irland schon immer ein verzauberter Ort, das letzte Stück Land vor der überwältigenden Weite des Ozeans. Die Reise führt von den Brutkolonien der Papageientaucher und Atlantiksturmtaucher auf den Spitzen der Skellig Rocks in die Tiefen des Ozeans zu Buckelwalen und Riesenhaien. Die spektakulär aus dem Atlantik ragenden und kaum zugänglichen Felsen von Skellig Michael, erst kürzlich Kulisse für einige atemberaubende „Stars Wars“-Sequenzen, beherbergen die Ruinen eines frühmittelalterlichen Klosters. In den Felsen brüten Papageientaucher. Die Sturmtaucher dagegen nutzen die Steinnischen der alten Mönchsbehausungen als für sie perfekte Brutplätze. In den Meeresströmungen rund um die Insel finden Wale und Haie ein reiches Nahrungsangebot: Plankton und Fischschwärme, die vor der Küste aus den Tiefen des Meeres auftauchen. Auf Blasket Islands versammeln sich im Winter Kegelrobben an den Sandstränden. Die Männchen testen ihre Stärke in blutigen Kämpfen und streiten sich um die Weibchen. Das nördliche Hochland ist das Revier des Steinadlers. Nach vielen Jahrzehnten ist er in die Berge von Donegal zurückgekehrt. Einige Paare wurden wiederangesiedelt. Noch ist nicht sicher, ob sich der noch kleine Bestand halten kann. Im Südwesten der Insel, im Killarney Nationalpark, hallt im Herbst das Röhren der Rothirsche über die malerischen Seen. Die Brunftkämpfe der Männchen sind kräfteraubend. Nicht selten verenden die unterlegenen Hirsche an ihren schweren Verletzungen. Es ist gerade diese Vielfalt, die den preisgekrönten Naturfilmer John Murray so an seiner Heimat fasziniert. Er ist an der irischen Westküste aufgewachsen und hat mit diesem Film ein einzigartiges Porträt der Natur Irlands geschaffen. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 10.10.2018 NDR Wildes Italien (1): Von den Alpen zur Toskana
45 Min.Von den schneebedeckten Dolomiten zum türkisblauen Mittelmeer: Italiens spektakuläre Landschaften sind vielen Menschen bekannt. Dabei hat „Bella Italia“ noch viel mehr zu bieten, nämlich eine wilde, unbekannte Seite! Abseits von Touristenströmen und heiß begehrten Reisezielen leben seltene Tiere wie Abruzzengämsen, Rosaflamingos und sogar Riesenhaie. Der Zweiteiler „Wildes Italien“ porträtiert die Natur zwischen Stiefelspitze und Alpengipfeln mit bezaubernden Aufnahmen. In der Folge „Von den Alpen zur Toskana“ steht der Norden Italiens im Mittelpunkt. Winter im Norden Italiens: Eis und Schnee beherrschen die Dolomiten, viele Monate lang.Nur Spezialisten können hier im Hochgebirge überleben, so wie der Steinbock. Kaum ein anderes Tier klettert so trittsicher, erklimmt so elegant die steilsten Hänge. Doch selbst Steinböcke zieht es bei Eis und Schnee in etwas tiefere Lagen, das Risiko abzustürzen ist im Winter einfach zu groß. Wenn es doch einmal ein Tier erwischt, profitiert der Steinadler. Der „König der Lüfte“ wird im Winter zum Aasfresser, wenn er nicht selber Beute machen kann. Und er muss sie wohl oder übel teilen, denn auch Raben und Krähen sind schnell zur Stelle, wo ein Tier verendet ist. Sobald es Frühling wird, beginnen riesige Schmelzwassermassen aus den Dolomiten ins Tal zu stürzen, nähren Bäche und Flüsse in ganz Norditalien, auch den Po. An der Adriaküste mündet der längste Fluss Italiens ins Mittelmeer und bildet ein ausgedehntes Delta. Wo noch bis in die 1980er-Jahre Salinen betrieben wurden, liegt heute ein Vogelparadies: Das geschützte Delta zieht seltene Wasservögel wie Purpurreiher und sogar Rosaflamingos magisch an. Südlich der italienischen Alpen erstreckt sich eine der bekanntesten Kulturlandschaften der Welt, die Toskana. Mildes Klima, Olivenhaine, Weinberge und kleine Wälder prägen die Region. Wer genau hinschaut, entdeckt auch die wilde Seite der Toskana: In der Krone einer alten Eiche kämpfen zwei Hirschkäfer um die Gunst des Weibchens und auf einer blühenden Wiese vernascht eine Landschildkröte frische Blüten. Zwei Jahre lang dauerten die Dreharbeiten zu „Wildes Italien“. Die Naturfilmer Hans-Peter Kuttler und Ernst Sasse flogen Heißluftballon, setzten Kameraschienen, Unterwasser- und Zeitlupenkameras ein, um die Natur und die Tiere von den Alpen bis zur Toskana hautnah zu porträtieren. (Text: 3sat) Wildes Italien (2): Von Sardinien zu den Abruzzen
45 Min.Die Dokureihe zeigt die wilde und weitgehend unbekannte Seite Italiens. Abseits von Touristenströmen und heiß begehrten Reisezielen leben seltene Tiere wie Abruzzengämsen, Rosaflamingos und sogar Riesenhaie. In der ersten Folge steht der Süden Italiens im Mittelpunkt. Berichtet wird u.a. über Wildpferde auf Sardinien und über das „wilde Herz“ Süditaliens: die Abruzzen. (Text: 3sat)Wildes Kalifornien – Leben unter Extrembedingungen
45 Min.Der zweite Teil „Wildes Kalifornien“ zeigt das Leben unter Extrembedingungen und beschäftigt sich in eindrucksvollen Bildern und Geschichten mit erstaunlichen Comebacks seltenster Tiere in einem der artenreichsten Bundesstaaten der USA. Durch Walfänger einst fast ausgerottet, schwimmen heute wieder fast genauso viele Blauwale vor Kaliforniens Küste wie zu Beginn der industriellen Abschlachtung. Auch Nördliche See-Elefanten, von denen keine 100 Exemplare überlebt hatten, haben sich auf einen Bestand von 200.000 Robben vermehrt, von denen viele alljährlich in gewaltigen Kolonien an den Küsten Kaliforniens zur Paarung und zur Geburt der Jungen zusammenkommen.Wenn Mensch und Natur so eng zusammenleben wie in Kalifornien mit seinen 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, birgt das große Herausforderungen. Nicht nur, weil Weiße Haie auch dort schwimmen, wo sich wagemutige Surfer in über 20 Meter hohe Monsterwellen stürzen. Auch das Leben an den Traumstränden ist für Bodenbrüter wie den Sandregenpfeifer gefährlich geworden. Einige Tiere profitieren auch vom Menschen, z. B. der Kulturfolger Kojote, denn seine großen Konkurrenten Wölfe und Grizzlybären sind ausgerottet. Farmen, die aufgegeben wurden, werden wieder zur Heimat seltenster Arten wie dem San-Joaquin-Kitfuchs, der sich die Prärien mit Klapperschlangen, Silberdachsen und Kängururatten teilt, die mit waghalsigen Kung-Fu-Sprüngen ihren Feinden im letzten Augenblick entkommen. Rick Rosenthal zeigt eigentümliche Geschichten aus dem Californian Way of Life: Zahnlippfische, die im Laufe ihres Lebens ihr Geschlecht wechseln, Grunion-Ährenfische beim Sex on the beach und Schwarzbären, die zur Eichelernte in die Wipfel steigen. Vor allem aber gibt er einen hoffnungsvollen Ausblick, wie das Nebeneinander von Mensch und Natur gelingen kann: Die Natur kommt zurück, wenn man sie lässt, so wie im Meeresnationalpark Cabo Pulmo. Seit hier der kommerzielle Fischfang eingestellt wurde, birst das zuvor fast wieder leer gefischte Riff voll buntem Leben. Und Touristen tauchen mit verspielten Seelöwen. (Text: NDR) Wildes Kalifornien – Ströme des Lebens
45 Min.Der US-Bundesstaat Kalifornien mit seinen über 2000 Kilometern Küste und über 4000 Meter hohen Bergen bietet Naturschönheiten voller Superlative. Der aufwendig gedrehte Zweiteiler „Wildes Kalifornien“ des renommierten Naturfilmers und Meeresbiologen Rick Rosenthal stellt seine Heimat Kalifornien vor, wie man sie bislang kaum gesehen hat: über und unter Wasser. Der erste Teil „Ströme des Lebens“ zeigt die Bedeutung des Lebenselixiers Wasser für den drittgrößten Bundesstaat der USA: Die nährstoffreichen Meeresströmungen vor der Küste speisen eines der produktivsten Ökosysteme der Welt.Große Schulen von Delfinen jagen schier endlose Fischschwärme. In den Riesentangwäldern tummeln sich Seeotter. Und die einst fast ausgerotteten Grauwale bringen nach der längsten Wanderung, die Säugetiere auf dem Globus unternehmen, in den warmen Wassern der Baja California ihre Jungen zur Welt. In einzigartigen Aufnahmen ist es Rick Rosenthal gelungen, die Werbung von zwei Grauwalbullen um ein Weibchen zu filmen und wie sie sich anschließend paaren. Die Meeresströmungen versorgen aber auch das Landesinnere mit Wasser: Wolken und Nebel bringen Unmengen Feuchtigkeit an Land und machen Kalifornien zu einer Speisekammer Amerikas. Die gewaltigen, oft über 1000 Jahre alten und über 100 Meter hohen Mammutbäume der Redwoods entziehen den Feuchtigkeitsströmen der Luft Wassertröpfchen. Vor allem im Winter dringen sogenannte atmosphärische Flüsse tief ins trockene Landesinnere, wo sie an den hohen Bergen der Sierra Nevada gestoppt werden und im einzigartig schönen Yosemite-Nationalpark als Schnee niedergehen. So entstehen wichtige Wasserspeicher für die trockene Jahreszeit im ganzen Land. Rosenthal zeigt eindrucksvoll die Zusammenhänge zwischen den Strömen des Wassers im Ozean, in der Luft und an Land und den Laichwanderungen der Lachse, dem Überleben der seltenen Sierra-Nevada-Dickhornschafe und den Winterquartieren von Hunderttausenden von Schneegänsen aus der Arktis auf. Und macht deutlich, wie übermäßige Landwirtschaft und der Klimawandel dieses Gefüge mit schweren Dürren schon heute bedrohen. Dabei nimmt er die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die nächtlichen Beutezüge der Pumas und auf den Laufsteg der balzenden Beifußhühner, deren aufgeblähte Luftsäcke an die Puschel kalifornischer Cheerleader erinnern. (Text: NDR) Wildes Kanada
Kanada erstreckt sich vom im Osten gelegenen Neufundland über die weiten Ebenen des Graslandes und die majestätischen Rocky Mountains hinweg 5.500 Kilometer bis hin zu den riesigen gemäßigten Regenwäldern an der Pazifikküste. Von den südlichen Prärien bis zum eisigen Norden in der Arktis des Landes sind es ebenfalls über 4.000 Kilometer. Kanada ist ein Land mit gigantischen Ausmaßen und ebenso unterschiedlichen wie faszinierenden Lebensräumen. Der Film beginnt dort, wo die Europäer erstmals kanadischen Boden betraten. Dieses „neu gefundene Land“ heißt bis heute Neufundland.Eine auf den ersten Blick wilde und unberührte Gegend. Sie aber war damals schon lange von Ureinwohnern geformt worden. Vor allem aber ist Kanada immer noch ein Ort spektakulärer Naturschauspiele: Im Osten ziehen Jahr für Jahr zahllose Buckelwale an die Küste Neufundlands. Riesige Schwärme von Lodden locken sie an. Die kleinen Fische kommen zum Ablaichen an die Strände, wenn sie nicht vorher in den gewaltigen Mäulern der Wale verschwinden. In den endlosen Wäldern Kanadas segeln Flughörnchen von Baum zu Baum und legen dabei erstaunliche Distanzen beinahe spielend zurück. Das Land mit dem Ahornblatt in der Flagge besitzt das größte intakte Waldgebiet der Erde. Im Zentrum des Landes schließlich findet sich die weite Prärie. Hier ist die Heimat eines der markantesten Tiere Nordamerikas: des Bisons. Früher gab es Millionen von ihnen, doch vor allem die weißen Siedler rotteten die meisten im 19. Jahrhundert aus. Nur selten hat man, wie in diesem Film, das Glück, diese gewaltigen Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, wie sie sich ihren natürlichen Feinden, den Wölfen, in einem dramatischen Kampf auf Leben und Tod stellen müssen. Doch nicht alles in der Prärie ist so dramatisch. Die Schwarzschwanzpräriehunde leben hier recht friedlich in riesigen Kolonien mit Tausenden Bauen. Diese werden, sobald sie verlassen sind, auch gerne von anderen Tieren genutzt, zum Beispiel von Kanincheneulen. In der schroffen Bergwelt der Rocky Mountains liefern sich die Böcke der Dickhornschafe erbitterte Kämpfe. Nur der Stärkste hat eine Chance bei den Weibchen. Weiter westlich erstreckt sich dann die Pazifikküste. Hier wandern Lachse millionenfach flussaufwärts über Stromschnellen und Wasserfälle, um weit im Landesinneren zu laichen. Auf diesem Weg finden zahllose Lachse den Tod. Davon ernähren sich Wölfe, Schwarzbären, Adler und andere Vogelarten. Auch die Wälder profitieren davon, denn die Kadaver, die die Tiere zurücklassen, düngen den Boden dieser Gegend so massiv, dass die Bäume hier rund dreimal so groß werden wie in anderen Teilen des Landes. Im Norden Kanadas schließlich befindet sich die Arktis: eine raue Welt, die den größten Teil des Jahres von Schnee und Eis bedeckt ist. Heimat der Eisbären. Ein Weibchen hat ihre Jungen in einer Höhle an der Küste zur Welt gebracht und bereits seit acht Monaten nichts gefressen. Jetzt muss es dringend nach Nahrung suchen. Das aber kann es nur auf dem Meereis und damit erst, wenn der Nachwuchs fähig ist, mehrere Hundert Kilometer zurückzulegen. Doch dann ist bereits der Zeitpunkt erreicht, an dem das Meereis zu schmelzen beginnt. Eine Jagd auf die bevorzugten Robben wird unmöglich. Ein Dilemma, das mit der zunehmenden Erderwärmung hier jedes Jahr früher sichtbar wird. Landschaft oder auch die Tierwelt, durchschnittlich ist nichts in Kanada, dem Land der Extreme. (Text: NDR) Wildes Karelien – Land der Braunbären und Singschwäne
Singschwäne verkünden mit trompetenartigem Gesang den Beginn der neuen Jahreszeit: In Karelien wird es Licht! Die Sonne erscheint endlich wieder über dem Horizont und befreit die wald- und wasserreiche Landschaft im Norden Russlands von Eis und Dunkelheit des langen Winters. Helligkeit, Wärme und Energie wecken die Natur aus der Winterstarre. Birkhähne balzen, Braunbärenmütter mit ihren Jungen durchstreifen die Taiga auf der Suche nach vorjährigen Preiselbeeren. Die Blütenpollen der selten gewordenen karelischen Maserbirken färben die Uferzonen der zahllosen Seen gelb. Licht hat in Karelien eine ganz besondere Bedeutung. Es heißt, dass es hier nur zwei Jahreszeiten gibt: den acht Monate langen Winter und den vier Monate kurzen Sommer.Schon die ersten Sonnenstrahlen zaubern einen glänzenden Schimmer auf die Wellen des Vodlozero Sees. In den Weißen Nächten im Mittsommer geht die Sonne gar nicht unter und lässt das Leben auch „nachts“ pulsieren. Doch bereits Anfang September verlassen die Singschwäne mit der sinkenden Sonne wieder Karelien. Mit einem letzten fantastischen Aufglühen der Polarlichter fällt das Land erneut in Dunkelheit und Winterschlaf. Die Russlandkenner Henry M. Mix und Axel Gebauer führen durch einen kurzen Sommer voller Leben, durch Landschaften aus Wasser und Licht, so schön und ursprünglich, wie sie in Europa nur noch selten zu erleben sind. (Text: NDR) Wildes Kuba
45 Min.Bild: NDR/NDR Naturfilm/doclights/Crossing the Line ProductionsIn seiner neuen Dokumentation zeigt der vielfach preisgekrönte Naturfilmer John Murray faszinierende Bilder aus der unverdorbenen Wildnis der größten Karibikinsel. Kuba, wie man es noch nie gesehen hat. Der kleinste Vogel der Welt ist nur auf Kuba heimisch: der Bienenkolibiri, auch Bienenelfe genannt. Seine Sichtung ist allerdings so selten, dass schwer zu entscheiden ist, ob er wirklich weltweit der kleinste Vogel ist (oder vielleicht doch die jamaikanische Zwergelfe). Es ist gelungen ist, ein Bienenkolibriweibchen beim Bau seines kaum golfballgroßen Nestes zu filmen.Die Kinderstube zimmert das Weibchen aus Spinnweben. Dafür muss es die Fäden aber aus Spinnennetzen stibitzen. Und das ist für einen Bienenkolibri Schwerstarbeit. Als besonderes Highlight dieser Naturdokumentation darf die Beobachtung der Brut beim Heranwachsen in rekordverdächtigem Tempo gelten. Das Monte-Iberia-Fröschchen ist ein weiterer Winzling in den kubanischen Wäldern. Bei gerade einmal einem Zentimeter Größe läuft es ständig Gefahr, von einem größeren Tier geschnappt zu werden. Doch diese kleine Froschart ist giftig, davor warnt seine kontrastreiche schwarz-gelbe Zeichnung. Trotzdem ist das Monte-Iberia-Fröschchen bedroht, es ist nur noch in zwei kleinen Gebieten auf der Insel anzutreffen. Auf Kuba leben rund 26 verschiedene Fledermausarten, sieben davon gibt es nirgendwo sonst auf der Erde. Die Kuba-Blütenfledermaus gehört zu den Arten, die sich vorwiegend von pflanzlicher Kost wie Früchten, Nektar und Pollen ernähren. Sie sind, wie auch andere Fledermausarten, nachtaktiv und verschlafen den Tag in einer Höhle. Am Höhleneingang lauert jedoch Gefahr: Kuba-Schlankboas hoffen dort auf Beute. Sie orientieren sich nach Geruch, während die Fledermäuse ihre bewährte Echo-Ortung benutzen. Mit speziell abgestimmter Kameratechnik ist es gelungen, das Drama zu dokumentieren, das sich hier tagtäglich lautlos und in völliger Dunkelheit abspielt. Seit gut drei Millionen Jahren leben die Kuba-Leguane bereits in der Karibik. Hektik ist ihnen an ihren tropischen Stränden fremd, es gibt nicht viel, was sie aus der Ruhe bringen könnte. Nur in der Paarungszeit ist das anders, da sind die Männchen wie ausgewechselt, gilt es doch, sich das Recht auf Fortpflanzung zu sichern. An den Stränden im Sumpfland von Zapata, unweit der berühmten Schweinebucht, ist für Millionen Landkrabbenweibchen der Strand für die Fortpflanzung wichtig. Im April verlassen Millionen davon mit Tausenden Eiern bepackt den Wald in Richtung Ozean. Sie müssen ihre Eier im Meerwasser deponieren, damit die nächste Generation heranwachsen kann. Die Krabben legen dabei bis zu sieben Kilometer zurück. Für viele ist die Wanderung, bei der sie auch Küstenstraßen queren müssen, der letzte Weg ihres Lebens. Jardines de la Reina, Gärten der Königin, heißt ein Wasserparadies vor der Südküste Kubas. Christoph Columbus gab dem Archipel diesen Namen zu Ehren von Königin Isabella I. von Kastilien. Unberührte Mangrovenwälder und Korallenriffe, in denen das Unterwasserleben in seiner ganzen tropischen Farbenpracht pulsiert, liefern vielleicht die eindrücklichsten Bilder dieser kostbaren, noch intakten Lebensräume. Hier wachsen noch die empfindlichen Elchgeweih-Korallen, die in der Regel die ersten Opfer schädlicher Umwelteinflüsse werden. Haie durchstreifen diese Riffe in großer Zahl. Ihre Gestalt ist perfekt auf ihre Lebensweise zugeschnitten, hat sich in den vergangenen 50 Millionen Jahren kaum noch verändert. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Kubanischen Revolution ist der Lebensstandard der Menschen bescheiden, bedingt durch die Abschottung vom kapitalistischen „Westen“. Gleichzeitig hinterlassen die Menschen auf Kuba aber auch nur einen Bruchteil des ökologischen Fußabdrucks vom dem der Bevölkerung in Industrienationen. Der Gewinner dieses Kapitels in der Geschichte war ganz klar die Natur: Naturfilmer John Murray gewährt einen Einblick in die Schätze dieser geschichtsträchtigen und faszinierenden Insel, die für die Natur der gesamten Karibik zu einem echten Hoffnungsträger geworden ist. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 27.11.2019 NDR Wildes Mallorca
Mallorca steht für Sommer, Sonne, Strand und Meer; die „wilde“ Seite der Touristeninsel kennen aber nur wenige, wie etwa das Reich der seltenen Mönchsgeier im Bergmassiv der Tramuntana. In über 1.000 Metern Höhe in den Bergen des Nordens von Mallorca kann der Winter auf der beliebten Touristeninsel recht ungemütlich werden. Genau diese Jahreszeit haben die seltenen Mönchsgeier für ihre Balz auserkoren. Die Art war schon fast ausgestorben, bedroht durch Tourismus und die Giftköder der Jäger. Engagierten Biologen ist es gelungen, Tiere auszuwildern und den Bestand wieder zu vergrößern.Eine von den Tierschützern ist Evelyn Tewes. Der Film begleitet die Österreicherin und die größten Vögel Europas rund ums Jahr. Oft gelangt sie nur in waghalsigen Klettermanövern zu „ihren“ Geiern. Inzwischen kreisen wieder rund 80 Mönchsgeier über Mallorca. Eine andere engagierte Biologin setzt sich für die vielfältige Unterwasserwelt Mallorcas ein: bunte Lippfische, riesige Zackenbarsche, gefräßige Muränen und Quallen, die wie „Spiegeleier“ aussehen, sind nur einige der vielen Lebewesen an den felsigen Küsten. Vor allem die bedrohten Delfine liegen Sevgi Yaman am Herzen. Immer wieder verfangen sich die Tiere in Fischernetzen und müssen befreit werden. Doch solche spektakulären Rettungsaktionen lösen nicht das Problem. Sevgi kämpft vor allem für die Einrichtung eines Meeresschutzgebietes rund um die vorgelagerte Insel Dragonera. In einer Mischung aus Naturdokumentation und Reportage porträtiert der Film die Natur Mallorcas unter dem Druck der ökologischen Probleme. (Text: NDR) Wildes Neuseeland – Kampf ums Paradies
Brodelnde Geysire, verwunschene Urwälder, stille Fjorde und eisige Gletscher. Neuseeland ist in seiner Vielfalt unvergleichlich, was seine Landschaften und Tierwelt angeht. Was geschieht, wenn Menschen und von ihnen mitgeführte Tiere in das Paradies eindringen? Was, wenn sich für Kakapo, Brückenechse, Kiwi und Riesenheuschrecke nach Jahrmillionen friedlichen Daseins das Leben komplett ändert? Was, wenn europäische Wiesel flugunfähige Ureinwohner flächendeckend dezimieren? Wie kann die besondere ursprüngliche Tier- und Pflanzenwelt Neuseelands überleben? Und wer wird diesen Kampf gewinnen? Das heutige Neuseeland ist nicht nur Heimat von Kiwi und Kea, Weta und Wekaralle.Es ist auch die Heimat von Pflanzen aus aller Welt, Amseln und Buchfinken, Bachforellen und Mäusen aus Übersee. Sie alle verdrängen, auf die eine oder andere Art, die tierischen Ureinwohner Neuseelands aus ihren Lebensräumen. Im modernen Neuseeland werden aber auch neue Allianzen geschlossen. Riesenforellen etwa haben sich darauf spezialisiert, Mäuse beim Durchqueren eines Gewässers zu erlegen. Fast überall auf den Inseln ist die Natur im Wandel. Einige der ursprünglichen Tier- und Pflanzenarten können sich behaupten, viele jedoch stehen kurz vor dem Aussterben: der extrem seltene Chatham-Schnäpper etwa oder der flugunfähige Eulenpapagei, der Kakapo: Behütet wie die Kronjuwelen, leben einige wenige nachtaktive Kakapos auf Codfish Island, einer kleinen Insel im Süden Neuseelands. Die dicken, flugunfähigen Papageien sind extrem selten und haben ein merkwürdiges Fortpflanzungsverhalten: Nur wenn die Rimu-Harzeibe ausreichend Früchte trägt, und das geschieht etwa alle vier Jahre, beginnen die Kakapos mit ihrer Balz. Dann stoßen die Männchen trommelartige Geräusche aus, die die Weibchen locken sollen. Wie sie gerettet werden können und ob modernste Schutzbemühungen fruchten, sind nach wie vor brennende Fragen, die Neuseelands Natur- und Artenschützer umtreiben. Der Teil „Kampf ums Paradies“ aus der Naturdokumentationsreihe „Wildes Neuseeland“ gibt Einblicke in aufwändige und clevere Rettungsaktionen, neue, Hoffnung gebende Allianzen und zeigt, dass die eigenwillige Tierwelt Neuseelands durchaus zu retten ist. Dabei bedienen sich die Naturfilmer für „Wildes Neuseeland“ aller technischen Raffinessen: Scheinbar schwerelos gleitet die Kamera durch Südbuchen- und Baumfarnwälder, über gigantische Gletscher, weite Flusstäler und dampfende Geysiere, um mithilfe von Kran, Dolly- und Steadycam eindringliche, aber auch ungewöhnliche Perspektiven einzunehmen. Zeitraffer zeigen die Lebendigkeit der grandiosen Landschaften über die Jahreszeiten, extreme Zeitlupen lassen Verhaltensweisen von Tieren, die in Bruchteilen von Sekunden ablaufen, fürs menschliche Auge sichtbar werden: Dazu zählen etwa die Kämpfe der Seelöwen oder die vor Lebensfreude überschäumende Sprungakrobatik Hunderter Schwarzdelfine. Unterwasserexkursionen in die Tiefen der Fjorde und atemberaubende Landschaftsaufnahmen aus der Luft ergänzen zusammen mit einem stimmungsvollen Soundtrack die große Erzählung von den Geheimnissen und Naturschätzen der Inseln am anderen Ende der Welt. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 19.09.2018 NDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.