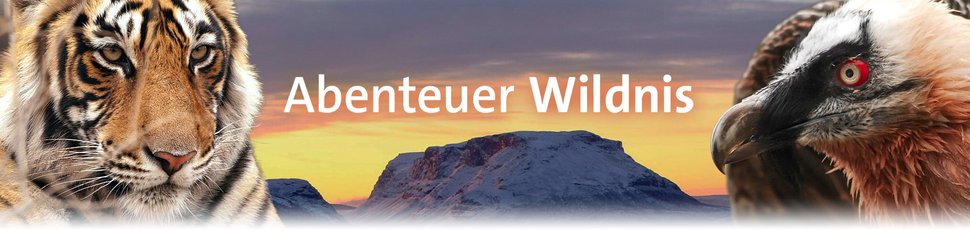553 Folgen erfasst seit 2020 (Seite 6)
Der Große Kaukasus – Russlands Dach der Welt
Die Bergwelten des Kaukasus markieren eine magische Grenze zwischen Europa und Asien. Über ein Jahr hat Filmemacher Henry M. Mix mit seinem Team in Russlands höchstem Gebirge verbracht. Entstanden ist eine eindrucksvolle Dokumentation über die Naturwunder zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Die wilde Berglandschaft mit ihrem extremen Klima hat eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt geformt. Sie macht den Kaukasus zu einem der weltweit 25 bedeutendsten Zentren biologischer Vielfalt. Bergwisent, Kaukasus-Königshuhn und Kaukasischer Tur sind nur hier zu finden. Im Regenschatten des schneereichen Hauptkammes leben Saiga-Antilopen, Ohrenigel und Schlangenadler.Im Westen des Gebirgszuges sind die einst ausgerotteten Bergwisente zu Hause. Über Jahrzehnte hinweg wurde der heutige Wildbestand aus Rückzuchten wieder aufgebaut. Mit bis zu 800 kg Lebendgewicht sind Wisente die größten Landsäugetiere Europas. Zweimal im Jahr verlassen sie die Bergwälder und ziehen hinauf in die alpinen Zonen auf knapp 3.000 Meter. Nirgendwo sonst leben Tiere dieser Gewichtsklasse in derartigen Höhen. Mit ihrem rüsselartigen Nasensack wirken Saiga-Antilopen wie Wesen aus einer anderen Welt. In den winterkalten Kalmückensteppen dient die erweiterte Nase als Wärmetauscher und Klimaanlage. Eiskalte Atemluft wird vorgewärmt, bevor sie die Lungen erreicht. Wer im Kaukasus überleben will, darf nicht zimperlich sein. Wetterkapriolen sind an der Tagesordnung. Oft scheinen sich die vier Jahreszeiten an einem Tag abzuwechseln. Schwarze Wolken verdunkeln die Sonne und bringen Hagel-, Regen- oder Schneestürme. Lawinen donnern zu Tal. Erdrutsche können binnen Sekunden ganze Landstriche neu gestalten. Epische Bilder, atemberaubende Flugaufnahmen und nie zuvor dokumentiertes Verhalten seltener Tiere – von der ersten Minute an wird „Der Große Kaukasus“ seine Zuschauer fesseln. (Text: BR Fernsehen) Großer Elefant – kleiner Elefant
Dokumentation über eine Elefantenherde in Tansania – ein heftiger Bullenkampf sowie eine Elefantenhochzeit gehören zu den Höhepunkten des Films. Der Große Elefant ist ein mächtiger Bulle, der im nordwestlichen Teil des Ngorongoro-Schutzgebiets in Tansania durch Steppe und Savanne wandert. Er ist nicht nur auf der Suche nach Nahrung, sondern auch nach paarungsbereiten Kühen. Die weiblichen Tiere leben mit ihren Kälbern in Familien-Gruppen, die ein Dutzend oder mehr Elefanten umfassen. Der Kleine Elefant ist eines dieser Kälber. Zusammen mit seiner Mutter, den „Tanten“ und anderen Jungtieren zieht er durch die karge Landschaft einer harten Trockenzeit.Längst hat die Sonne Gräser und Kräuter, die Hauptnahrung der Kühe, vertrocknen lassen. Den Tieren fällt es schwer, ihren täglichen Bedarf zu decken. Doch wenn hin und wieder der Große Elefant die Gruppe besucht, verändert sich die Situation zum Vorteil für die gesamte Herde. Der Große Elefant weiß, wo es auch in der Trockenzeit frisches Grün gibt – in den Baumkronen der Schirm-Akazien und anderer Bäume. Und meist begnügt sich der Bulle nicht damit, mit seinem langen Rüssel ein paar Zweige herunterzureißen. Seine Riesenkräfte erlauben ihm, den Baum einfach umzuwerfen. Allein durch seine Anwesenheit schützt er die kleinen Kälber vor Löwen und anderen Raubtieren. (Text: BR Fernsehen) Große Taten für kleine Arten
45 Min.Gewässerrandstreifen: Entnahme einer Wasserprobe.Bild: BR/Christoph Castor„Wie und in welcher Welt wollen wir leben?“ – auf diese Frage suchen die Protagonisten dieses Films mit viel Leidenschaft zukunftsweisende Antworten. Ihr Einsatzgebiet: die Natur mitsamt ihren wertvollen und unverzichtbaren Kleinstlebewesen. Es sind Käfer, Wildbienen oder Amphibien, die unsere Böden, Grünflächen und Wälder am Leben erhalten. Ein Filmteam begleitet einen Wildbienenexperten, der ausgerechnet auf einem Golfplatz herausfinden will, wie es dort um die wilden Verwandten der Honigbiene steht. Der Golfklub Memmingen hat es sich im Rahmen des Projekts „Golf und Natur“ zum Ziel gesetzt, ein Wildbienen-Mekka zu werden.Zwischen dem samtig gepflegten Kurzrasen stehen dort nun prächtige Wildblumenwiesen. Im Landkreis Mühldorf am Inn kämpft ein Landwirt mit mächtigen Wasserbüffeln für kleine seltene Gelbbauchunken. Durch die Beweidung, die entstehenden Pfade und Suhlen schaffen seine Büffel optimale Voraussetzungen, damit sich die seltenen Gelbbauchunken im feucht-nassen Boden wohlfühlen. So lebt der Landwirt seinen Traum von einer tiergerechten und nachhaltigen Fleischgewinnung, die gleichzeitig zur Artenvielfalt beiträgt. Eine Lebensaufgabe, die im Alltag jedoch einige Herausforderungen bereithält! Und ein kleines engagiertes Forscherteam aus Freising will endlich herausfinden, was die viel diskutierten Gewässerrandstreifen an landwirtschaftlich genutzten Flächen wirklich für Insektenreichtum und -vielfalt bringen. Ob sich eine der zentralen Forderungen des erfolgreichsten bayerischen Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ auch wissenschaftlich begründen lässt? (Text: BR Fernsehen) Großstadtspatzen
30 Min.Altvogel und Jungspatz.Bild: Jürgen Eichinger / BRDer Spatz gehört eigentlich in bayerische Biergärten wie die Breze, hinter deren Krümeln er her ist. Doch die frechen Vögel werden seltener. Vor allem in den Großstädten: Neue Bauvorhaben, sterile Grünflächen, Insektenmangel setzen ihnen immer mehr zu. Filmautorin Angela Graas-Castor erzählt die Geschichte von vier einzigartigen Spatzenkolonien in München: hinterm Rathaus am Marienhof, in Neuperlach, am Flughafen und im Elefantenhaus des Tierparks Hellabrunn. Überall müssen die pfiffigen Vögel ungewöhnliche Strategien entwickeln, um mit den Herausforderungen der Stadt klarzukommen. Sie haben mit Großbaustellen zu kämpfen, müssen kreative Nist- und Schutzplätze erobern, neue Nahrungsnischen auftun. Unterstützt werden die kleinen Überlebenskünstler dabei von Menschen, die mit viel Herzblut so einiges für sie in Bewegung setzen. Doch wird der Spatz es wirklich schaffen, auf Dauer in unseren Städten zu überleben? (Text: BR)Grzimeks Erbe in Afrika
In „Grzimeks Erbe“ werden Artenschutzprojekte vorgestellt, die Bernhard Grzimek in aller Welt initiiert hat. Für diese Folge war Christian Herrmann in Afrika unterwegs. Der Schweizer Biologe Dr. Markus Borner ist einer der Naturschützer, der mit Prof. Dr. Bernhard Grzimek noch persönlich gearbeitet hat. Grzimek, bekannt als Frankfurter Zoodirektor und Vorsitzender der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, hat Jahrzehnte für den Aufbau und Erhalt der Tierschutzgebiete gekämpft. Zusammen mit seinem Sohn Michael produzierte er den Kinofilm „Serengeti darf nicht sterben“.Genau dort, in der Serengeti, arbeitet Dr. Borner. Einst führte er hier mit Grzimek die Tierzählungen aus der Luft durch – im „Fliegenden Zebra“, einem in Zebrastreifen lackierten einmotorigen Flugzeug. Gemeinsam reisten sie auch in den Kongo zu den Berggorillas und in andere afrikanische Staaten. Filmemacher Christian Herrmann hat Dr. Borner auf einer Rundreise begleitet und festgehalten, was aus dem Erbe des Tierschützers Grzimek geworden ist. (Text: BR Fernsehen) Grzimeks Erbe in Asien
In „Grzimeks Erbe“ werden Artenschutzprojekte vorgestellt, die Bernhard Grzimek in aller Welt initiiert hat. Für diese Folge waren Eberhard Meyer und Felix Heidinger in Asien unterwegs. Schon als Prof. Dr. Bernhard Grzimek in Afrika seine ersten Projekte zugunsten der bedrohten Tierwelt in Angriff nahm, machte er immer wieder deutlich, dass es dabei auch um die Unterstützung einer armen Bevölkerung geht. Die von Grzimek gegründete Zoologische Gesellschaft Frankfurt dehnte ihre Aktivitäten bis nach Asien aus, wo der Artenschutz ebenfalls mit dem Lebensstandard der einheimischen Bevölkerung steht und fällt.Solange es in Vietnam noch einen Markt für erlegte Affen gibt, werden sich auch Jäger finden, die in die abgelegensten Urwälder aufbrechen. Aber inzwischen sind hier, wie auch auf den Philippinen und in Indonesien, die Erben Grzimeks im Einsatz. Sie sind die entschlossenen Hüter so prachtvoller Wildtiere wie der Languren Vietnams, des Korallenschnabelhornvogels auf der philippinischen Insel Panay oder der Orang-Utans auf Sumatra. (Text: BR Fernsehen) Grzimeks Erbe in Südamerika
In „Grzimeks Erbe“ werden Artenschutzprojekte vorgestellt, die Bernhard Grzimek in aller Welt initiiert hat. Für diese Folge war Felix Heidinger in Südamerika unterwegs. Als Prof. Dr. Bernhard Grzimek in seiner 37. Fernsehsendung eine ausgewachsene südamerikanische Meerechse über seinen Schreibtisch laufen ließ, wusste er, dass die Menschen in Deutschland noch nie ein solches Wesen gesehen hatten. Grzimek, der damalige Direktor des Frankfurter Zoos, war der Mann, der mit seiner Sendereihe „Ein Platz für Tiere“ die Tiere dieser Welt in deutsche Wohnzimmer brachte. Damit konnte Grzimek die Menschen nicht nur faszinieren, sondern er mobilisierte sie auch, sich für die Erhaltung der letzten Paradiese dieser Welt zu engagieren.Aus seiner Arbeit entstand eine Stiftung, die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die sein Werk bis heute fortsetzt. Das Filmteam begibt sich auf die Spuren von Grzimeks Erben, den Wissenschaftlern und Abenteurern, die in Südamerika für den Schutz bedrohter Lebensräume und Tierarten kämpfen. Vom vulkanischen Galapagos über tropische Regenwälder bis hinunter in die raue Bergwelt Patagoniens – kein Kontinent ist vielseitiger und abwechslungsreicher als Südamerika. (Text: BR Fernsehen) Haie eiskalt! Jäger zwischen Nordsee und Grönland
45 Min.Seit Millionen von Jahren beherrschen sie die Meere: Haie. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennt man sie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordens und ihre faszinierenden Überlebensstrategien aber weiß man nur sehr wenig. Christina Karliczek will das ändern und begibt sich auf eine spannende Expedition. Die erfahrene Unterwasserkamerafrau ist eine der wenigen in ihrem Metier und für Tauchgänge unter dem Eis und in extremer Tiefe speziell ausgebildet. Die Suche nach den kaltblütigen Meeresbewohnern führt das Team von den sonnigen schwedischen Inseln entlang der norwegischen Fjorde bis an die grönländische Arktis.Die erfahrene Unterwasserkamerafrau Christina Karliczek begleitet verschiedene Meeresbiologen. Einer von ihnen kann Haie gefahrlos nur durch Berührung in eine hypnoseähnliche Starre versetzen. Andere Forscher versehen Haie mit Satellitensendern und bekommen damit Einblicke in die unerforschte Lebensweise der oft missverstandenen Jäger und ihre wichtige Rolle im Lebensraum Meer. Hautnah trifft Christina Karliczek Dorn- und Katzenhaie und lüftet einige Geheimnisse der legendären Riesenhaie vor der Atlantikküste Schottlands. Sie kommen dort zu mysteriösen Gruppentreffen zusammen. Andere ihrer Protagonisten mit scharfen Zähnen leuchten in der Finsternis. Erstmals gelang es, die Biolumineszenz des Schwarzen Laternenhai zu filmen, der durch besondere Leuchtorgane am Bauch blaugrün funkelt. Wenig erforscht sind diese Herrscher der Meere. Trotz ihrer außergewöhnlichen Anpassungen an extreme Lebensräume sind sie inzwischen fast überall ernsthaft bedroht. Millionen von ihnen sterben in Fischernetzen, landen als Schillerlocken, Seeaal und Fish and Chips auf dem Teller der Verbraucher. Viele Haie verenden zudem als ungenutzter Beifang. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat für manche Arten längst ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Unter der Eisdecke Grönlands trifft Christina schließlich auf den ultimativen Hai des Nordens. Zum ersten Mal gelingt es ihr, einen Eishai zu filmen. Der über sechs Meter lange Knorpelfisch kann über 400 Jahre alt werden, manche sagen gar ein halbes Jahrtausend. Eine Begegnung, die Christina sicher nie vergessen wird. (Text: BR) Haie, Hummer, Helgoland
45 Min.Ein einfühlsames Porträt über Deutschlands Hochseeinsel Helgoland. Der Film ist eine Liebeserklärung an Helgoland und seine menschlichen und tierischen Bewohner und ein eindrucksvoller Bericht über eine Insel inmitten der Nordsee, die stetigen Veränderungen unterworfen ist. Meeresbiologe und Tierfilmer Florian Graner ist schon fast überall auf der Welt getaucht, doch nur mit wenigen Orten verbindet ihn eine so persönliche Geschichte wie mit Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel. Vor 16 Jahren kam Florian Graner als Zivildienstleistender nach Helgoland. Jetzt kehrt er auf „seine“ Insel zurück und ist überrascht, wie sehr sich die Natur verändert hat. Schon sein erster Besuch auf der Helgoländer Düne zeigt: Annähernd 80 Kegelrobben liegen mit ihrem Nachwuchs am winterlichen Strand; früher sah Florian die „großen Verwandten“ der Seehunde hier nur vereinzelt, Kegelrobben waren in der deutschen Nordsee äußerst selten.Die Robben sind nicht die einzigen, die Helgoland für sich neu entdeckt haben: In den steilen Klippen nisten neben Lummen und Alken seit Anfang der 1990er-Jahre Basstölpel, Hochseevögel, die in Deutschland nur hier vorkommen. Offensichtlich sind auch die Veränderungen um Helgoland herum – das Wasser der Nordsee wird immer wärmer. Auf Tauchgängen entdeckt Florian zahlreiche exotische Tierarten wie Streifenbarben und Meeräschen, stößt aber auch auf inzwischen selten gewordene, ursprüngliche „Helgoländer“ wie Hai und Hummer. (Text: BR Fernsehen) Haie leben gefährlich
45 Min.Haie gelten als Herrscher der Ozeane. Sie leben zwischen Eismeer und Tropen. Ihr Bild wurde geprägt von Schauermärchen und Hollywood-Blockbustern: Sie sind als blutrünstige, gnadenlose Killer verschrien, die um des Tötens willen töten. Doch diese Zuschreibungen haben alle eines gemeinsam: Sie sind Fiktionen. Die Wirklichkeit sieht anders aus und genau ihr spürt dieser Film nach, der die große Vielfalt der Hai-Arten und ihre Lebenswelten zeigt. Der Hai, Inbegriff des Raubfisches, ist überraschenderweise öfter Gejagter als Jäger, öfter gefährdet als Gefährder.Und selbst wenn er jagt, tut er dies nicht immer mit Erfolg. Dabei haben sie sogar Wege gefunden, gemeinsam artenübergreifend zu jagen. Graue Riffhaie und Weißspitzen-Riffhaie haben sich etwa als Jäger zusammengetan, um ihre Chancen zu erhöhen. Haie sind auch Meister der Tarnung. Der äußerst bizarre Fransenteppich-Hai macht seinem Namen alle Ehre und lässt sich kaum mehr vom Riff mit seinen Korallen unterscheiden. Die Bandbreite der Hai-Arten reicht vom kleinen Epauletten-Hai bis zum gewaltigen Walhai, der nur zu bestimmten Anlässen aus der Tiefsee emportaucht. Der Filmemacher Didier Noirot hat die faszinierenden und so extrem unterschiedlichen Lebewesen in bemerkenswerten Bildern festgehalten und bringt uns die Welt der Haie – weit entfernt von jeglicher Sensationslust – so nah wie kaum je zuvor. Er thematisiert ihre Besonderheiten, ihre Schönheit und ihre Überlebensstrategien. Diese Meister der Anpassung werden heute allerdings vor allem aufgrund der Gefährdung durch den Menschen dauerhaft und zunehmend stärker auf die Probe gestellt. (Text: BR Fernsehen) Hannah goes Wild: Abenteuer Artenschutz
45 Min.Die junge Tierärztin Hannah Emde, Jahrgang 1992, ist unterwegs in Namibia: Artenschutz, Abenteuer und persönlicher Einsatz stehen im Mittelpunkt des Zweiteilers „Hannah goes wild“. Hannah trifft in Namibia Menschen, die sich zeitlebens für das Leben von Elefanten, Nashörnern, Geparden und anderen Arten einsetzen und die Natur schützen wollen. Tagelang begleitet sie die Tierschützerinnen und Tierschützer an verschiedene Orte und darf als Tierärztin bei mehreren Organisationen mithelfen. Hannah Emde ist Tierärztin und Artenschützerin aus Leidenschaft. Seit Jahren ist sie mit den Regenwäldern dieser Welt vertraut. Namibia hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern auch mit einigen der zentralen Tier- und Umweltprobleme wie Artensterben, Klimawandel, Wilderei und dem Konflikt zwischen Tieren und Menschen um Lebensraum zu kämpfen.Im ersten Teil trifft Hannah Emde berühmte Artenschützerinnen und -schützer, die sich leidenschaftlich für das Leben von gefährdeten Geparden und Elefanten einsetzen. Die Tierärztin Maaike de Schepper führt gemeinsam mit Hannah einen Gesundheitscheck an Geparden durch, die im großen Naturreserverat von N/a’an ku sę leben. Die Gründerin des Reservats, Marlice van Vuuren, durchstreift mit ihr das Schutzgebiet auf der Suche nach Wildtieren. Und der weltweit führende Elefanten-Tracker Hendrick Munembome führt sie auf die Spuren der Wüstenelefanten. (Text: BR) Hannah goes Wild: Die letzten ihrer Art
45 Min.Die junge Tierärztin Hannah Emde, Jahrgang 1992, ist unterwegs in Namibia: Artenschutz, Abenteuer und persönlicher Einsatz stehen im Mittelpunkt des Zweiteilers „Hannah goes wild“. Hannah trifft in Namibia Menschen, die sich zeitlebens für das Leben von Elefanten, Nashörnern, Geparden und anderen Arten einsetzen und die Natur schützen wollen. Tagelang begleitet sie die Tierschützerinnen und Tierschützer an verschiedene Orte und darf als Tierärztin bei mehreren Organisationen mithelfen. Hannah Emde ist Artenschützerin aus Leidenschaft. Sie ist seit Jahren mit den Regenwäldern dieser Welt vertraut und hat bereits über das Leben von Nebelpardern und Orang-Utans auf Borneo, Großpapageien in Guatemala und Lemuren auf Madagaskar geforscht.Namibia hat nicht nur seltene Tierarten zu bieten, sondern mit einigen der zentralen Tier- und Umweltproblemen zu kämpfen wie Artensterben, Klimawandel, Wilderei und dem Konflikt zwischen Tieren und Menschen um Lebensraum. Im zweiten Teil begegnet Hannah den aussterbenden Spitzmaulnashörnern und begleitet ein Nashorn-Tracking-Team bei ihrer harten Arbeit zum Schutz dieser Tiere. Außerdem geht sie dem Sinn und Unsinn der Trophäenjagd nach und beleuchtet das Thema auf vielen Ebenen: Sie spricht mit Einheimischen, aber auch mit kommerziellen Trophäenjägerinnen und -jägern. (Text: BR) Der Harz: Felsenreich und Wasserwelten
45 Min.Verwunschene Wälder, Großkatzen, wilde Schafe und ein langer, harter Winter: Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge hat vieles zu bieten. Der Harz ist sagenumwobener Treffpunkt der Hexen, war einst Inselreich von Urzeitechsen und ist heute ein Naturjuwel mit einer Tierwelt, die man in Deutschland anderswo kaum noch findet. Der zweite Teil der Dokumentation „Der Harz“ beginnt im Sommer und endet im Winter. Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge hat viel zu bieten. Der Harz, das ist raue Natur mit Schneestürmen im Winter und regennassen Wäldern im Sommer, den beiden einzigen wilden Katzenarten Deutschlands, röhrenden Hirschen, wilden Schafen und vielen anderen Tieren, die sich nur selten zeigen.Auf den Wiesen und in den Wäldern des Harzes jagen Deutschlands einzige Großkatzenarten. Die Wildkatze kann leicht mit einer Hauskatze verwechselt werden. Sie war aus vielen Regionen Deutschlands verschwunden. Durch die Mischung aus dichten Wäldern, die Verstecke für den Nachwuchs bieten, und Wiesen für die Mäusejagd, konnte die Wildkatze in der Harzregion überleben. Der Luchs war in ganz Deutschland ausgerottet. Im Nationalpark Harz wurden erstmalig wieder Tiere in die Freiheit entlassen. Von 2000 bis 2006 waren es 24 Luchse. Seit 2002 gibt es regelmäßig Nachwuchs im Harz. Inzwischen leben hier die meisten Luchse Deutschlands, etwa 55 ausgewachsene Exemplare und 35 Jungtiere. Einige tragen ein Sendehalsband. Die Forscherinnen und Forscher des Luchsprojekts wollen herausbekommen, wie der Luchs seinen Lebensraum nutzt und vor allem wie er sich ausbreitet. Vom Harz ausgehend besiedeln Luchs und Wildkatze wieder ihre angestammten Lebensräume. Die größte Gefahr für die Tiere dabei sind die zahlreichen Straßen und Autobahnen, durch die Deutschlands Landschaften zerschnitten werden. Die zweite Folge „Der Harz“ beginnt im Sommer und endet im Winter. Mehr als zwei Jahre lang war Tierfilmer Uwe Anders im Harz unterwegs. Es entstanden einzigartige Aufnahmen von überfluteten Wäldern, zauberhaften Schneelandschaften und den heimlichen Harzbewohnern wie Luchs, Wildkatze, Tannenhäher und Mufflon sowie von vielen weiteren Überraschungen, die die Natur im Harz bereithält. (Text: BR Fernsehen) Der Harz – Im Wald der Luchse
45 Min.Der Harz ist reich an Niederschlägen, die zahlreiche Waldbäche und Gebirgsflüsse füllen.Bild: NDR/Doclights GmbH/Uwe AndersDeutschlands nördlichstes Mittelgebirge hat viel zu bieten: verwunschene Wälder, Wildkatzen, wilde Schafe und einen langen, harten Winter. Der Harz ist sagenumwobener Treffpunkt und ein Naturjuwel mit einer Tierwelt, die man anderenorts in Deutschland kaum noch findet. Über 1.000 Meter hoch ragt der Brocken, der höchste Berg des Harzes, aus der flachen Landschaft. Kahl und Wind umpeitscht ist sein Gipfel, dunkel und wasserreich sind seine bewaldeten Hänge. Der Harz ist ein Regenfänger. Hier fällt zwei- bis dreimal so viel Niederschlag wie im Umland. Im Winter kommt der Niederschlag als Schnee und verwandelt das Gebirge in eine weiße Traumlandschaft. Dabei kann es in den Hochlagen ungemütlich werden.Am Brocken erreichen Stürme nicht selten Orkanstärke und die Temperaturen fallen regelmäßig unter minus 20 Grad. Wildkatze und Luchs streifen durch die nebelverhangenen Wälder, Mufflon und Rothirsch leben hier. Der Luchs ist längst zum Symboltier der Region geworden. Das soll zeigen, dass Naturschutz und Tourismus erfolgreich nebeneinander existieren können. Manchmal kommt der Luchs den Menschen sogar sehr nahe. Doch die gut getarnte Wildkatze wird fast nie bemerkt. Über zwei Jahre lang war Tierfilmer und Harzkenner Uwe Anders für seine Dokumentation im Harz unterwegs. Ihm ist ein besonderes Naturporträt gelungen mit einzigartigen Landschaftsaufnahmen und überraschenden Verhaltensporträts der wilden Harzbewohner. (Text: BR Fernsehen) Hasenalarm – Die Welt der Langohren
45 Min.Hasen sind auf allen Kontinenten heimisch, mit Ausnahme der Antarktis. Sportliche Florida-Waldkaninchen, schwimmende Sumpfkaninchen oder hakenschlagende Antilopenhasen – Susan Fleming porträtiert in „Hasenalarm – Die Welt der Langohren“ die Multitalente, die in den eisigen Wäldern Kanadas ebenso zu Hause sind wie in Deutschland. Doch wie unterscheidet man eigentlich Hasen von Kaninchen? Sportliche Florida-Waldkaninchen, schwimmende Sumpfkaninchen oder hakenschlagende Antilopenhasen: Hasen und Kaninchen sind immer auf Zack! Susan Fleming porträtiert die Multitalente, die auf allen Kontinenten heimisch sind mit Ausnahme der Antarktis.Doch wie unterscheidet man Hasen von Kaninchen? Auch wenn es optische Merkmale wie Körperbau oder Ohrenlänge gibt, sie Einzelgänger sind oder sich in Gruppen tummeln, alle gehören zur Familie der Hasen. Das Florida-Waldkaninchen ist die am weitesten verbreitete Kaninchenart in Nordamerika. In dieser Dokumentation stellt es seine Verführungskünste in der Umgebung von Chicago unter Beweis. Noch erstaunlicher sind die Sumpfkaninchen. Sie jagen nicht nur übers Land in atemberaubender Geschwindigkeit, sie durchqueren auch problemlos schwimmend Seen und Sümpfe. Eine Meisterleistung, die zum ersten Mal gefilmt werden konnte. Antilopenhasen hingegen sind eine der rund 30 Arten von echten Hasen, die in Europa, Asien und Nordamerika verbreitet sind. Sie behaupten sich sogar in den Wüsten Arizonas. Ihre größten Feinde sind Wüstenbussarde, mit denen sie sich wahre Wettrennen um Leben und Tod liefern. Sehr viel weiter nördlich leben die Schneeschuhhasen, die die Weiten Kanadas besiedeln. Durch jahrzehntelange Forschung haben Biologen wie Rudy Boonstra erstaunliche Dinge über sie herausgefunden: Wenn Schneeschuhhasen gestresst sind, weil sie beispielsweise ständig von Luchsen gejagt werden, haben sie weniger Nachkommen. Ihre Jäger wandern ab und die Schneeschuhhasen erobern langsam ihre ursprünglichen Territorien, die nunmehr frei von Luchsen sind, wieder zurück. Zumindest so lange, bis sich die Luchse wieder in ihr ursprüngliches Gebiet zurückwagen und genügend Nahrung vorfinden. Neben den wilden Vertretern der Langohren gibt es unzählige Zuchtkaninchen mit skurrilen Namen wie Französischer oder Englischer Widder, Englischer Schecke, Löwenkopfkaninchen, Angorakaninchen, Riesenkaninchen, Lohkaninchen und noch viele mehr, sie alle stammen von Wildkaninchen ab. Es gibt eine riesige Kaninchen-Fangemeinde, die Züchter überbieten sich gegenseitig: Wer hält den Weltrekord bei den Riesenkaninchen, wo werden die wichtigsten Preise für die Prachtexemplare verliehen? Eine der weltweit größten Versammlungen von Kaninchenzüchtern findet jährlich in den USA statt. Hier werden mehr als 10.000 Exemplare gezeigt. Ein aufregendes Ereignis für Kaninchen, Züchter, Veranstalter und Interessierte gleichermaßen! Kaninchen haben auch die Städte erobert: In Frankfurt trifft Filmautorin Susan Fleming Dr. Madlen Ziege, die vor allem die Unterschiede im Verhalten zwischen Stadt- und Landkaninchen studiert hat. So ist etwa der Fluchtreflex der Kaninchen, die in Frankfurts Parks massenhaft zu finden sind, viel weniger intensiv ausgeprägt als der ihrer Vertreter auf dem Land. (Text: BR Fernsehen) Das Havelland – Naturoase im Herzen Brandenburgs
45 Min.Erfolgsstory: Der Bestand des Fischadlers hat sich in den letzten 10 Jahren in Brandenburg fast verdoppelt.Bild: BR/NDR/NDR NaturfilmWie ein schützender Arm legt sich die Havel um das Havelland, eine der reizvollsten Kulturlandschaften Brandenburgs. Viele kennen die Region vor den Toren Berlins als Obstgarten und über Theodor Fontanes Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. Doch das Havelland bietet weit mehr. Tierfilmer Christoph Hauschild zeichnet ein einfühlsames Porträt vom Havelland, einer Naturoase im Herzen Brandenburgs. Im größten Binnenfeuchtgebiet Mitteleuropas sammeln sich jedes Jahr abertausende Kraniche auf ihrem Weg gen Süden. Mächtige Seeadler finden in den zahlreichen Gewässern reichlich Nahrung und in den angrenzenden Wäldern röhren kapitale Rothirsche.Eine landschaftliche Besonderheit sind die weiten Stromtalwiesen, die sogenannten Luchs. Hier leben die seltenen Großtrappen – gehütet wie Kronjuwelen. Auf den trockeneren Ländchen, kleinen Bodenerhebungen, zieht der Fuchs seine Jungen groß. Von den Storchennestern auf Kirchtürmen und Gehöften ist es nicht weit zu stillen Erlenbrüchen, in denen die seltenen Sumpfschildkröten leben, und wo sich der Fischadler nach erfolgreicher Jagd eine Pause gönnt. Tierfilmer Christoph Hauschild zeichnet ein einfühlsames Porträt vom Havelland, einer Naturoase im Herzen Brandenburgs. (Text: BR Fernsehen) Hawaii – Paradies der Wale und Vulkane
45 Min.Hawaii / Hawaje / Plaża / BeachBild: PixabayFilmemacher Daniel Opitz bereist die Insel Hawaii zusammen mit Einheimischen und Wissenschaftlern. Der Film ist geprägt von der großen Leidenschaft des Kielers für das Meer, für Wale und Delfine und für einen der schönsten Orte der Welt. U. a. führt die filmische Reise zu den zerklüfteten Canyons der Bergregenwälder, die Heimat der seltenen Kleidervögel, zu den Mondlandschaften der Vulkane oder zu unbewohnten Inseln, wo die Hawaii-Mönchsrobbe lebt. Das besondere Lebensgefühl und die einzigartige Natur Hawaiis faszinieren den Kieler Daniel Opitz seit mehr als zehn Jahren.Aus der Begeisterung für Wale und Delfine wurde die Lebensaufgabe, ihnen zu folgen und über sie zu berichten. Dieser Film ist eine Reise in Daniel Opitz’ „persönliches Paradies“. Der Filmemacher entführt in die Welt der Riesenwellen, er taucht ab in die bizarre Unterwasserwelt der Vulkaninseln, zu Schiffswracks und Haien, Buckelwalen und Delfinen. Er nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf beeindruckende Hubschrauberflüge abseits von Massentourismus, Waikiki und Hotelburgen. Jedes Jahr kommen Buckelwale in die geschützten Gewässer von Hawaii, um sich hier zu paaren und um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Riesige Mantarochen, Meeresschildkröten und Tigerhaie ziehen durch das glasklare Wasser. Wellen bestimmen die Form, den Rhythmus und die Stimmung an den Küsten Hawaiis – das Meer gehört hier zum täglichen Leben dazu. Die Beziehung von Mensch und Natur steht stets im Mittelpunkt des filmischen Interesses von Daniel Opitz. Zwei Jahre lang weicht er einem Team von Walforschern nicht von der Seite und begleitet sie bei ihrer unermüdlichen Arbeit, dem Rätsel der Gesänge der Buckelwale ein kleines Stück näherzukommen. (Text: BR Fernsehen) Die heiligen Tiere der Pharaonen
45 Min.Elefantine in Oberägypten war die Kultstätte des widderköpfigen „Chnum“, des Gottes der Fruchtbarkeit. Doch die Grabungen fördern auch viel Profaneres zu Tage: Knochenreste von riesigen Nilbarschen und Flusspferden, Reste von Mahlzeiten der Alten Ägypter.Bild: NDR/NDR/Michael SutorIn den Katakomben von Tuna el Gebel stoßen Zooarchäologe Joris Peters und sein Team auf Millionen Mumien von Ibissen, Falken und Pavianen. Ein kleiner gebogener Knochen aus einem Mumienbündel bringt Licht in die Geschichte: Vor mehr als 2.000 Jahren wurde ein Affe in einer Tempelnische gehalten, ohne Licht und nur unzureichend ernährt. Ort des Geschehens: Ägypten, das Land der Pharaonen. Für den belgischen Zooarchäologen Joris Peters von der Universität München will das so gar nicht in das Bild der Hochkultur am Nil passen. Keine andere antike Kultur hatte eine so facettenreiche und intensive Beziehung zur Tierwelt wie die der alten Ägypter.In den Katakomben von Tuna el Gebel in Mittelägypten stoßen Joris Peters und sein Team auf Millionen Mumien von Ibissen, Falken und Pavianen. Alles deutet darauf hin, dass sich hier in den späten Jahrhunderten des Ägyptischen Reiches eine regelrechte Mumienindustrie entwickelt hat. Wurden die Tiere gequält, womöglich sogar getötet – im Dienste der Priester? In den engen, einsturzgefährdeten Gängen von Tuna el-Gebel suchen die Wissenschaftler nach Antworten. (Text: BR) Heimliche Helden – Keas in Neuseeland
45 Min.Neuseeland ist, oder besser war, ein „Planet“ der Vögel. Über Jahrmillionen gaben sie den Ton an. Neuseeland ist bis heute eine Welt für sich, auch wenn der Mensch und seine Mitbringsel vieles verändert haben. Heute kämpfen die Neuseeländer darum, wenigstens einige der Papageien- und Vogelarten von damals zu retten. Die Keas, die heimlichen Helden Neuseelands, haben eine gute Chance! Das raue, alpine Bergland Neuseelands gehörte immer den Keas. Eis und Schnee, extreme Wetterlagen, keine gesicherte Ernährung: Ausgerechnet die Keas verstanden es, sich durchzubeißen.Dann kamen die ersten Siedler, rodeten die Wälder und brachten Säugetiere mit, die mit den Vögeln um Nahrung und Lebensraum konkurrierten. Aber dort, wo Keas leben, sind sie automatisch Teil des Soziallebens der Neuseeländer geworden. Sie brechen in Häuser und Mülltonnen ein, öffnen Schlösser und verschleppen Werkzeug. Geöffnete Autofenster verstehen sie als Einladung. Nur die Plätze, an denen Keas ihre Eier ablegen und die Küken aufziehen, sind weit weg von menschlichen Ansiedlungen in dunklen Höhlen in der Wildnis. Doch selbst dahin sind Nesträuber eingedrungen; den Marder- und Rattenattacken stehen die Keas machtlos gegenüber. Die Zahl der Keas ist dramatisch gesunken. Die Neuseeländer suchen nach Abhilfe. Corey Mosen ist ein Ranger, der sich den Keas an die Fersen heftet. Vor allem ist er aber Experte für schmale Felsspalten, in denen Keas brüten: Nur indem er ausatmet, kann er sie passieren. Es sind abenteuerliche Bilder, die jedem den Atem stocken lassen, die Belohnung sind vorher nie gesehene Bilder von Kea-Küken, frisch geschlüpft. Drei Monate werden Keas in Höhlen verborgen von den Eltern versorgt, dann geht es zum ersten Mal raus ins Abenteuer. Von Natur aus sind die Keas angepasst an eine ganz andere Welt – ohne Menschen, ohne gefährliche Vierbeiner. Das einzige, was sie dagegensetzen können, ist offensichtlich die Intelligenz und ihre ungeheure Lernfähigkeit. Wie klug diese Bergpapageien wirklich sind, wird in dieser Dokumentation deutlich. In mehr als vier Jahren Drehzeit wurden die Geheimnisse der Keas gelüftet. (Text: BR Fernsehen) Held aus dem Dschungelbuch – Der Lippenbär
45 Min.ARD/NDR ERLEBNIS ERDE: HELD AUS DEM DSCHUNGELBUCH, „Der Lippenbär“, am Montag um 20:15 Uhr im ERSTEN. Bärenmännchen kämpfen oft nur zum Spaß. Dabei fordern meist die älteren Lippenbären die jüngeren heraus.Bild: NDR/GULO/NDR NaturfilmBiologen wissen über Lippenbären in freier Wildbahn so gut wie gar nichts. Im Süden von Indien fand das Filmteam einen besonderen Zugang zu den scheuen Tieren und rückte ihnen mit der Kamera ganz dicht auf den Pelz. Heute leben noch etwa 10.000 Lippenbären in Indien. Im Süden des Landes fanden die Filmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg einen besonderen Zugang zu den scheuen Tieren und rückten ihnen erstmalig mit der Kamera ganz dicht auf den Pelz. Über einen Zeitraum von drei Jahren und in mehr als 200 Drehtagen konnten die beiden Naturfilmer nicht nur Lippenbären am helllichten Tag filmen, sondern dokumentierten Verhalten, das selbst Wissenschaftlern bisher nicht bekannt war.Sie folgen einem jungen Männchen auf seinem Weg zum erwachsenen Bären. Balu – wie der Halbstarke heißt – ist gute zwei Jahre alt, als er aus der Obhut seiner Mutter entlassen wird. Nun wird sich zeigen, ob er das, was er von seiner Mutter gelernt hat, auch allein anwenden kann. Neben den Lippenbären werden auch andere Tiere gezeigt, etwa Leoparden und Tiger, Elefanten und eine Horde Tempelaffen. Balu ist am Ende des Films ein ausgewachsener Bär. Auch wenn er zunächst bei den Weibchen kein Glück hat, kann es nicht mehr lange dauern, bis er eigenen Nachwuchs zeugen wird. (Text: BR Fernsehen) Helgoland – Insel im Sturm
45 Min.Helgoland ist Deutschlands einzige Hochseeinsel und damit etwas ganz Besonderes. Seit Jahrhunderten trotzt der rote Felsen den Elementen und bietet Mensch und Tier einen Zufluchtsort inmitten der rauen Nordsee. Tausende Zugvögel rasten hier auf ihrem kräftezehrenden Flug über die Deutsche Bucht in wärmere Regionen. Die kleine Insel von 1,5 Quadratkilometern bietet zu jeder Jahreszeit grandiose Naturschauspiele. Wenn im Sommer die Rufe Tausender Seevögel die roten Klippen erfüllen, ist es Zeit für den Lummensprung: Hunderte noch flugunfähige Trottellummenküken stürzen sich dann todesmutig vom Fels in die Tiefe.Ein Naturereignis, das sich die Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland nicht entgehen lassen. Alljährlich zählen und beringen sie die jungen Lummen und helfen auch mal nach, wenn der Sprung ins Wasser nicht glückt. Das Hauptinteresse der Vogelforscher aber gilt dem Vogelzug. Seit über 100 Jahren werden die Frühjahrs- und Herbstwanderungen der Zugvögel von den Wissenschaftlern des Instituts für Vogelforschung dokumentiert und ausgewertet. Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat Filmautor Robert Morgenstern die Atmosphäre und Geschichten Helgolands eingefangen und zu einem Porträt der Insel und seiner Bewohner verwoben. Durch Zeitlupen- und Zeitrafferaufnahmen wird der spezielle Rhythmus der Insel in diesem Film lebendig und anschaulich. Die besonderen Perspektiven und Tieraufnahmen zeichnen die Vielfalt und die Besonderheiten der roten Insel nach und geben darüber hinaus faszinierende Einblicke in die Arbeit der Vogelkundler. (Text: BR Fernsehen) Herbstwelten
45 Min.Noch ein letztes Mal zeigt sich die Natur in aller Pracht, wenn sich die Blätter der Laubbäume verfärben und die tief stehende Sonne Wiesen und Wälder golden erstrahlen lässt. Der Herbst ist eine Jahreszeit der Herausforderungen. Nur wer jetzt die richtigen Vorbereitungen trifft, wird den kommenden Winter überleben. Im Film werden die verschiedenen Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt in opulenten Bildern gezeigt. Herbst in Deutschland – das Jahr neigt sich dem Ende zu. Der erste Frost stellt sich ein, die Tage werden kürzer, es gibt weniger Sonnenstunden und eine melancholische Stimmung breitet sich über das Land aus. Es ist eine Zeit der Widersprüche, und das wechselhafte Herbstwetter steht symbolisch für die Herausforderungen dieser Jahreszeit.Bei den letzten warmen Sonnenstrahlen beginnt die Erntezeit. Tiere, die hierzulande überwintern, finden so überall Nahrung, doch es gilt, so schnell wie möglich Vorräte anzusammeln oder ein Fettpolster anzufressen, sonst droht bald der sichere Tod. Zugvögel wie Kraniche und Stare dagegen nehmen jetzt Abschied, denn mit dem Verschwinden ihrer Futtergrundlage gibt es nicht mehr genügend Nahrung, um den Winter zu überstehen. Zuvor sammeln sie sich in riesigen Scharen, um die lange gefährliche Reise in den Süden anzutreten, wo sie überwintern werden. Für andere Tiere ist der Herbst aber auch die Zeit des Neuanfangs: Ausgerechnet jetzt, wenn alle anderen Tiere Energie tanken und Kraft sparen, haben die Rothirsche ihre Brunftzeit mit Kämpfen, Röhren und dem ständigen Treiben ihrer Weibchen. Für sie ist Energiesparen jetzt keine Option. Es gilt, den Bestand der nächsten Generation zu sichern. Nur wer jetzt die richtigen Vorbereitungen trifft, wird den kommenden Winter überleben. Ob Eichhörnchen, Hirsch, Baldachinspinne oder Kranich – die Kamera ist ganz nah dabei, wenn sich die Tiere diesen Herausforderungen stellen, und so ist ein abwechslungsreiches Porträt vom Herbst in Deutschland entstanden. (Text: BR Fernsehen) Highway durch Australien – Der Südwesten
45 Min.Ein Fuchskusu, oder Possum. Fuchskusu sind neugierig. Sie besuchten in der Nacht das Lager von Ernst Arendt und Hans Schweiger.Bild: ZDF und BR/Ernst Arendt/Hans SchweigerErnst Arendt und Hans Schweiger reisen diesmal nach Australien. Am südwestlichsten Punkt beginnen sie ihre Tour quer durch den Kontinent. Am südwestlichsten Punkt beginnen Ernst Arendt und Hans Schweiger ihre Tour quer durch Australien. Traumhafte Strände, Blumenwiesen und Wälder mit riesigen Eukalyptusbäumen liegen an der Strecke durch den Südwesten Australiens. Possums, Bandicoots, Kakadus und natürlich Kängurus queren ihren Weg. Neugierige Vögel inspizieren ihren Unimog. Und zum Schluss geht ein Traum in Erfüllung: Sie finden den winzigen, niedlichen Honigbeutler. (Text: BR)Highway durch Australien – Die Nullarbor
45 Min.Von den Traumküsten Westaustraliens fahren Ernst Arendt und Hans Schweiger ins trockene Inland, durchqueren die berühmte Nullarbor-Ebene und erreichen schließlich die Gegend von Adelaide. In Australien muss man alles mit Kängurus teilen: das Camp, den Strand und den Highway. Truckstopps sind Oasen nicht nur für Autofahrer. Bei der Kaffeepause finden Arendt und Schweiger auch hier interessante Tiere. Der historische Eyre Highway, heute nicht mehr befahren, bringt sie zurück in Pionierzeiten. Zum Schluss geht es in eine Kleinstadt. Tausende von Kakadus kommen in den Ort, turnen an Antennen und rutschen wie Skifahrer auf den Blechdächern. (Text: BR)Highway durch Australien – Ins rote Zentrum
45 Min.Schwarzfuß-Felsenkängurus.Bild: ZDF und Ernst Arendt/Hans SchweigerErnst Arendt und Hans Schweiger sind weiter durch Australien unterwegs, bis in die roten Wüsten Richtung Alice Springs. Von den malerischen Flinders Ranges geht es für Ernst Arendt und Hans Schweiger entlang einer stillgelegten Bahnlinie in die roten Wüsten bis nach Alice Springs. An Bahnruinen und sogar in Kunstobjekten der Aborigines brüten Papageien, winzige Zebrafinken und Raben. Neben der Strecke finden sie Artesische Brunnen, riesige Warane und bunte Blumen im roten Wüstensand. Selbst mitten in Alice Springs im Straßencafé beobachten Arendt und Schweiger interessante Tiere. Rund um die Wüsten-Stadt in den Schluchten der MacDonnell Range klettern Felsenkängurus und leben Dingos. Ein überraschender Regen flutet die Wüste und auch die Straßen. (Text: BR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail