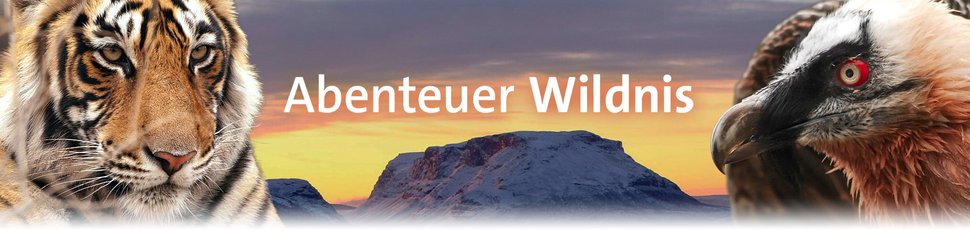553 Folgen erfasst seit 2020 (Seite 5)
Die frechen Spatzen von Berlin
Die Filmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen verfolgten zwei Jahre lang ein Spatzenpaar und ein „Findelkind“ mit der Kamera. Drama, Liebe und Tod – was in diesem Tierfilm alles passiert, lässt manche Seifenoper blass erscheinen … Über zwei Jahre lang verfolgten die beiden Filmer im Berliner Zoo ein Spatzenpaar und ein „Findelkind“ mit der Kamera. Die kleinen Vögel sind wahre Überlebenskünstler und trotzen den Gefahren der Metropole. Im Zoologischen Garten von Berlin finden sie eine grüne Oase inmitten des Großstadtdschungels.Hier sind die Lebensbedingungen für Spatzen ideal: zahlreiche geeignete Nistplätze und vor allem Nahrung im Überfluss. Mit aufwendigen Filmtechniken werden die kleinen Vögel auf ihren Beutezügen verfolgt. Im Zoorestaurant stibitzen sie Spaghetti und Pommes frites von den Tellern der Gäste und in der Zooküche machen sie sich über Reistöpfe her. Im Zentrum der Dokumentation steht ein Spatzenpaar und der Zootierpfleger Marcus. Er findet ein frisch geschlüpftes, elternloses Spatzenküken und zieht es groß. Keine leichte Aufgabe, denn Marcus muss sein Leben voll auf den nimmersatten Jungspatz umstellen. Streifzüge außerhalb des Zoos zeigen, wie Spatzen in anderen Teilen Berlins leben. Wer hätte gedacht, dass Spatzen selbst die Love-Parade toll finden und auf der Spree Ausflugsdampfer wie Piraten entern. Trotz ihrer Anpassungsfähigkeit werden Spatzen vielerorts seltener. Die Filmautoren gehen auch der Frage nach, warum das so ist, und zeigen, welche Probleme Spatzen in den Städten haben. (Text: BR Fernsehen) Die Fuchsflüsterin
45 Min.Es gibt auf der ganzen Welt vermutlich nur eine Frau, die sich mit einem Polarfuchs unterhalten kann: Die Biologin Ester Rut Unnsteinsdóttir erforscht seit 23 Jahren die Füchse Islands. Sie kann sogar den Lockruf der Fuchsmutter imitieren, um Welpen aus dem Bau zu locken – damit sie ihre Zahl, ihr Alter und ihre Gesundheit überprüfen kann. Eine echte Fuchsflüsterin. Nirgendwo leben mehr Polarfüchse pro Quadratkilometer als auf der Halbinsel Horn im Nordwesten Islands. Die Biologin Ester Rut Unnsteinsdóttir erforscht seit 23 Jahren die Füchse Islands. Die Füchse auf Horn sind ein Gradmesser für Islands Bestände: Wenn selbst hier, unter optimalen Lebensbedingungen, etwas schieflaufen sollte, könnte es schlimm werden für alle Füchse auf Island.Im März vor sieben Jahren war die Bilanz nach Esters Winterexpedition niederschmetternd: Damals hatten sehr viele Füchse den Winter nicht überlebt. Vielleicht liegt die Ursache dafür im Meer, das die Füchse ernährt. Denn die Ozeane sind mit einer Unzahl von Chemikalien verschmutzt. Tiere nehmen viele davon mit der Nahrung auf. Auch Seevögel haben die Gifte in ihren Körpern, und geben sie hochkonzentriert an die Füchse weiter. In Esters Fuchs-Proben fanden Forscher viel des starken Giftes Quecksilber. So viel wie bei den Füchsen der russischen Pazifikinsel Mednyi. Dort verschwanden zwischen 1970 und 1980 90 Prozent aller Füchse, und ihre Zahl hat sich seither nicht erholt. Werden auch die Füchse auf Horn durch dieses Nervengift geschwächt? Der Nordatlantik ist eines der am stärksten mit Quecksilber belasteten Meere der Welt. Trotzdem, für Ester ist es endlich wieder ein gutes Fuchsjahr: Denn schon lange gab es nicht mehr so viel gesunden Nachwuchs. Aber das Überleben der Füchse bleibt durch das giftige Quecksilber in ihren Körpern bedroht. Ester weiß, dass sie nicht viel dagegen tun kann. (Text: BR Fernsehen) Die fünf Geparde – Gemeinsam durch die Serengeti
45 Min.In der nördlichen Serengeti jagen fünf Geparde im Verbund, um größere Beutetiere zu jagen. Es ist das größte Bündnis von Geparden, das jemals beobachtet wurde. Filmautor Reinhard Radke hat viele Geschichten über die schlanken Jäger zu bieten. Geparde sind die Hochgeschwindigkeitsjäger der Savanne. Nur wenige wagen sich auch an größere Beute. Doch manchmal zeigen sich die Raubkatzen von einer überraschend anderen Seite. In der nördlichen Serengeti tauchen fünf Männchen auf, die alles auf den Kopf stellen. Es ist das größte Bündnis von Geparden, das jemals beobachtet wurde. Eine erfahrene Mutter bringt ihren männlichen Nachkommen die letzten Feinheiten der Jagd bei, bevor sie den Nachwuchs in die Unabhängigkeit entlässt.Das Weibchen hat sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Geduldig wartet sie, bis die Gnus dicht genug bei ihr sind. Ein junges Weibchen steht vor ganz anderen Problemen, es hat vier Jungtiere zu versorgen. Die Kleinen müssen jeden Tag mehrere Kilometer zurücklegen. Lange mustert die Mutter die Umgebung, doch die Löwin in den Büschen hat sie nicht bemerkt. Die Löwin beobachtet sie dagegen schon lange: Fleischfresser sind untereinander Konkurrenten! Die fünf Gepardenmännchen beschatten nach mehreren erfolglosen Jagdversuchen eine Herde. Nachdem einer von ihnen durchstartet, bricht unter den Gnus Panik aus. In diesem Chaos den Überblick zu behalten ist eine Herausforderung für die Geparde. Ihr Opfer ist ein 200 Kilogramm schweres Gnu. Beute, die für ein einzelnes Männchen viel zu groß wäre. Doch die vielen Monate des Jagdtrainings zahlen sich aus. Für diesen Film reiste Tierfilmer Reinhard Radke in die nördliche Masai Mara, um Geparde in Situationen zu filmen, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Dabei gelangen ihm nicht nur spektakuläre Aufnahmen von der Jagd, sondern auch rührende Familiengeschichten zweier Mütter, die ihren Nachwuchs großziehen. (Text: BR Fernsehen) Gämsen, Murmeltiere und Aalrutten – Die Berchtesgadener Alpen
45 Min.Im Rahmen der großen Serie über Deutschlands schönste Naturregionen entstand das bildgewaltige Naturporträt über Deutschlands einzigen Alpennationalpark Berchtesgaden. Gezeigt werden extreme Lebensräume wie die Karstlandschaften des Steinernen Meeres, der Watzmann mit der höchsten Felswand der Ostalpen, das Wimbachgries mit seinen ständig wandernden Schuttströmen und der Königssee, einer der tiefsten Seen Deutschlands. Wer in dieser Wildnis überleben will, muss perfekt an seine Umwelt angepasst sein. In schwindelnder Höhe leben Gämsen mit ihren neugeborenen Kitzen, immer auf der Hut vor den Fängen des Steinadlers, Tarnkünstler wie das Schneehuhn und es wachsen Bergblumen wie das legendäre Edelweiß.Auf den Hochalmen balgen sich Murmeltiere und in den Tiefen des Königssees laicht die rätselhafte Aalrutte, ein Meeresfisch, den es vor zehn Millionen Jahren ins Süßwasser verschlagen hat. Cineflex-Flugaufnahmen, aufwendige Kamerafahrten und eindrückliche Langzeitbelichtungszeitraffer zeigen den Nationalpark Berchtesgaden auch von seinen weitgehend unbekannten Seiten, „malen“ Stimmungen und verdeutlichen so den Lauf der Jahreszeiten in einer der schönsten Regionen Deutschlands. (Text: BR Fernsehen) Gazellen – der große Sprung in die Sahara
45 Min.Die Mhorrgazellen waren in Afrika ausgestorben. Nur in einem Zoo in Spanien lebten die letzten sieben Tiere dieser größten Gazellenart, ein spanischer General hatte sie Beduinen abgekauft. Und im spanischen Almeria begann man zu züchten, erst allein, dann kaufte der Münchner Tierpark Hellabrunn einige Tiere und plante die Wiedereinbürgerung der Gazellen in Nordafrika. Sechs Gazellen kamen zurück nach Marokko, drei aus Spanien, drei aus München. Sie kamen nicht in die Freiheit, sondern in die königliche Jagddomäne nahe Marrakesch. Heute stehen fast 200 Mhorrgazellen auf dem eingezäunten Gebiet. Filmautor Felix Heidinger hat 20 Mhorrgazellen auf dem Weg in die Freiheit begleitet. Ein aufregender Weg, stressig für die Tiere und die Tierärzte, eine Reise durch Marokko bis in die Nähe der algerischen Grenze. Eine Reise in die Freiheit, bei der es sich zeigte, dass der Weg in die Freiheit auch ein Weg in den Tod sein kann. (Text: BR Fernsehen)Geheime Jäger der Serengeti
45 Min.Ein Gepard in der Serengeti.Bild: BR/Udo ZimmermannStreifenhyänen sind nachtaktiv. Es gelingt deshalb nur selten, diese als Einzelgänger bekannten Tiere zu beobachten. Dem Autor ist es jedoch gelungen, einem Hyänenpaar zu folgen, das bis nach Sonnenaufgang aktiv blieb und gelegentlich auch vor Sonnenuntergang den Bau aufsuchte. Filmautor Reinhard Künkel lebt seit 30 Jahren in der Wildnis Afrikas am Südrand der Serengeti. Er wohnt fast das ganze Jahr über in einem Dschungelcamp und geht jeden Tag auf Safari, um Tiere zu fotografieren und zu filmen. Und weil er sich ständig zwischen wilden Tieren aufhält, entwickelt er auch ganz persönliche Bindungen zu besonders scheuen Tieren. In dieser Sendung erzählt er von einem sehr seltenen Jäger der Serengeti, der Streifenhyäne. (Text: BR Fernsehen)Das geheime Leben der Rothirsche
45 Min.Immer aufmerksam: Ein Rothirsch-Weibchen.Bild: NDR/DocLights GmbH/Axel GebauerMajestätisch, machtvoll, stolz: Der Rothirsch hat definitiv kein Image-Problem. Schon oft wurde der „König der Wälder“ gefilmt. Meist als röhrender Brunfthirsch, der im Herbst um die Weibchen kämpft. Doch wie der Rothirsch den Rest des Jahres „tickt“, wird selten gezeigt. Dabei sind Rothirsche sehr sozial und fürsorglich, ausgelassen und verletzlich. Versteckte Kameras zeigen ungewöhnliche Einblicke in das geheime Leben der Rothirsche. Während der Brunft buhlen die Rothirsche mit lautem Röhren und aggressiven Kämpfen um die Gunst der Hirschdamen.Dabei verausgaben sich die Hirsche bis zur Erschöpfung. Am Ende der anstrengenden Paarungszeit müssen sie den Rest des Jahres extremen Aufwand betreiben, um die körperlichen Reserven wieder aufzufüllen. In den kommenden Monaten ziehen die männlichen Tiere in Junggesellenrudeln umher und konzentrieren sich aufs Fressen. Ihre Nachkommen und die Weibchen interessieren sie kaum. Auch die Hirschkühe leben zunächst in Rudeln. Ende Mai vertreiben sie den Nachwuchs aus dem Vorjahr und bringen im Verborgenen ihre Jungen zur Welt. Anschließend führen sie ihre Kälber an versteckte Spielplätze und beschützen sie vor drohenden Gefahren. Ehe ein Hirschkalb die Chance bekommt ein Platzhirsch zu werden, vergehen mindestens fünf Jahre. Eine lange Zeit, die aufregende Begegnungen, aber auch entspannte Momente mit sich bringt. Rothirsche sind keine langweiligen Wiederkäuer: Versteckte Kameras an Suhlen oder anderen „Rendezvous-Plätzen“ geben ungewöhnliche und seltene Einblicke in dieses unbekannte Leben der Rothirsche. (Text: BR Fernsehen) Geheimnisvolle Hochseeoasen
45 Min.Die endemischen Clarion-Kaiserfische im mexikanischen Revillagigedo Archipel reinigen die pazifischen Riesenmantas von Parasiten und losen Hautresten.Bild: WDR/MöltgenfilmDer Natur- und Unterwasserfilmer Rolf Möltgen taucht mit Meereswissenschaftlern in geheimnisvolle Welten rund um mächtige Unterwasservulkane hinab. Gemeinsam wollen sie erkunden, warum sich dort so viele Arten tummeln. Sie wollen auch herausfinden, wie sich Tauchtourismus einerseits und Schutzmaßnahmen andererseits auf diese Oasen auswirken. Mancherorts ragen karge Felsen aus dem Meer, sie sind die Gipfel mächtiger Unterwasservulkane, die häufig viele Tausend Meter hinab reichen können. Der Natur- und Unterwasserfilmer Rolf Möltgen taucht mit Meereswissenschaftlern aus aller Welt in einige der geheimnisvollen Bergwelten hinab.Die erste Erkundungsreise führt rund 350 Kilometer hinaus auf den Pazifik zu den Ravillagigedo-Inseln vor Mexiko. Vor Roca Partida bilden Schnapper so riesige Schwärme, dass die Felswand dahinter verschwindet. Sie locken Räuber wie Weißspitzenhaie an, die wiederum die noch größeren Galapagoshaie. Freundlich gestimmt dagegen sind die Riesenmantas vor San Benedicto – eine ganz besondere Attraktion. Der Grund für die Lebensfülle rings um Felsen und Atolle ist die Folge eines einfachen physikalischen Effekts: Prallt die Strömung auf ein Hindernis wie eine Bergwand, wird das Wasser schlagartig nach oben gelenkt. Am Gipfel bilden sich zudem Wirbel, dort bietet das Plankton Nahrung in Hülle und Fülle. Manchmal allerdings führt auch etwas ganz anderes die Tiere zu den Bergen: Vor Malpelo, einem tristen Felsbrocken 500 Kilometer vor Kolumbien, ziehen Hunderte Bodenstirn-Hammerhaie über die Taucher hinweg. Die Erdmagnetfelder der Seegebirgsketten dienen den Weitstreckenwanderern zur Orientierung. Eine Fahrt mit dem Tauchboot Deepsee hinab in die Bergwelt des Kokosrückens vor Costa Rica ist ein Höhepunkt der Reise. Das Team sieht seltene Arten wie Tiefseequappen, Schildzahn- und Stachelhaie in mehr als 300 Metern Tiefe. Der letzte Tauchgang findet mitten in der Nacht statt und stellt eine besondere Herausforderung dar. Vor der Kokosinsel kommen so viele Weißspitzenhaie zusammen wie nirgendwo sonst. (Text: BR Fernsehen) Geheimnisvolles Mittelmeer – Von Berberaffen und Feuerfischen
Im Laufe seiner geologischen Geschichte haben sich die Umrisse des Mittelmeers dramatisch verändert. Bei Gibraltar war Afrika einst mit dem europäischen Kontinent verbunden und blockierte damit den Zufluss aus dem Atlantik. Das Mittelmeer trocknete komplett aus und schuf so an verschiedenen Stellen Landbrücken, über die Tiere zwischen den Kontinenten wandern konnten. Die Migrationswege der Mittelmeerbewohner sind seit jeher vielfältig: Schwimmend, fliegend oder laufend kamen sie von einem zum anderen Kontinent. So gibt es noch heute Berberaffen auf dem europäischen Kontinent und Chamäleons, die einst aus Afrika kamen, leben an der spanischen Mittelmeerküste.Die Straße von Gibraltar spielt die entscheidende Rolle bei der Wiederbesiedlung des Mittelmeerbeckens und macht es daher auch unter Wasser zum Anziehungspunkt verschiedenster Tiere. Große Thunfischschwärme dringen jedes Jahr aus dem Atlantik in die wärmeren Gewässer des Mittelmeeres vor, um sich zu paaren. Und der größte Knochenfisch der Erde, der Mondfisch, findet vor Elbas Küsten ideale Bedingungen, um in dieser außergewöhnlichen Heimat zu überleben. Neben den natürlichen, nur von geologischen Prozessen beeinflussten Migrationswegen zeigt der Film die Bedrohung durch künstlich geschaffte Wege: Der Suezkanal stellt heute eine Verbindung zum tropischem Roten Meer her. Über diesen Weg finden Tiere ins Mittelmeer, die dort ernsthafte Probleme verursachen. Mit dem gefräßigen Rotfeuerfisch können es die Mittelmeerfische nicht aufnehmen. Der Filmautor porträtiert, wie es Tiere aus drei Kontinenten und Meeren geschafft haben, sich das Mittelmeer und seine Küsten über Millionen von Jahren zur Heimat zu machen. (Text: BR Fernsehen) Geheimnisvolle Tigerhaie: Spurensuche im Ozean
Sigurd Tesche rückt in der aufwendigen HD-Produktion so manches Vorurteil über Tigerhaie zurecht – ein packendes Porträt eines vom Aussterben bedrohten Raubfisches. Er zählt zu den größten und schönsten Raubfischen überhaupt: der Tigerhai. Pfeilschnell, unberechenbar und scheinbar unersättlich versetzt der elegante Hochseejäger Badende in aller Welt in Angst und Schrecken. Ein denkbar schlechter Ruf eilt ihm voraus: Gefährlicher als der Weiße Hai sei er. Ein Tigerhai fresse alles, was ihm zwischen die beispiellos scharfen Zähne gerate. Der Dokumentarfilmer Sigurd Tesche hat dem Mythos vom Monster auf den Zahn gefühlt. Weltweit war er unterwegs, um den verrufenen Räuber aufzuspüren. Mitgebracht hat er atemberaubende Bilder u. a. aus Südafrika, wo man versucht, die Strände durch kilometerlange Schutznetz-Systeme gegen Haie abzuschirmen.Mit einem kleinen Team ist der Filmer in die Lagunen des St. Lucia-Wetland-Parks vorgedrungen, wo er Krokodilen und Flusspferden unter Wasser begegnet ist. In den Gewässern des Hawaii-Archipels hat das Team Tigerhaie beim Vogelfang beobachtet und einen spektakulären Kampf einer Seeschildkröte mit einem der gestreiften Jäger gefilmt – einmalige Aufnahmen einer Auseinandersetzung mit verblüffendem Ausgang. Sensationell sind auch die Bilder einer Zitronenhaigeburt auf den Bahamas: Dr. Samuel Gruber, Urgestein der internationalen Haiforschung, leistet unter Lebensgefahr Geburtshilfe. (Text: BR Fernsehen) Geheimnisvolle Welten – Nachts in Dschungel und Pampa
45 Min.Ein internationales Team aus Biologen und Naturfilmern hat sich aufgemacht, um die Geheimnisse nachtaktiver Tiere zu lüften. Bisher konnte kaum erforscht und so gut wie nie gefilmt werden, wie nachtaktive Tiere in kompletter Finsternis ihren Weg durch dichten Urwald finden oder gar Beute jagen. Ein internationales Team aus Biologen und Naturfilmern, darunter die deutsche Biologin Susanne Seltmann und der Max-Planck-Wissenschaftler Bryson Voirin, will die Geheimnisse dieser hoch spezialisierten Wesen lüften. Ihr Ziel ist es herauszufinden, warum Tiere nachts aktiv sind, und wie sie sich in der Dunkelheit orientieren.Mithilfe von neuartigen Nachtsichtgeräten und Spezialkameras spüren die Forscher den Tieren nach. Die Expedition führt das Team durch Mittel- und Südamerika, vom tropischen Dschungel Costa Ricas über die überschwemmten Wälder Amazoniens bis in die schroffe Bergwelt Patagoniens. Die erfahrene Kamerafrau und Großkatzenexpertin Justine Evans will Pumas bei ihrer nächtlichen Jagd in den Bergen des Nationalparks Torres del Paine im Süden Chiles oder Jaguare am Strand von Costa Rica filmen. Ein Teil der Gruppe um den Insektenspezialisten George McGavin will herausfinden, wie man bei der Beobachtung der Tiere ganz ohne Tageslicht zurechtkommt. Bei der Durchquerung kilometerlanger Höhlen in den Tafelbergen Venezuelas begegnen ihnen bizarre Kreaturen, die sich perfekt an ein Leben in absoluter Dunkelheit angepasst haben. In den überfluteten Waldgebieten am Amazonas trifft das Team im Dunkeln nicht nur auf Mohrenkaimane, auch hoch oben im Blätterdach des Regenwaldes macht es eine interessante Entdeckung. (Text: BR Fernsehen) Geht ’n Eisbär zum Arzt … Training im Tiergarten Nürnberg
45 Min.Ein Eisbär spielt mit einer Tonne.Bild: BRZootiere beim Arzt: Noch vor wenigen Jahren waren Untersuchungen mühsam, manche gar nicht möglich. Im Tiergarten Nürnberg machen die Tiere jetzt aber freiwillig mit. Unter Führung von Zootierärztin Dr. Katrin Baumgartner wurde das „medizinische Tiertraining“ Standard. Die Patienten im Gehege lernen beispielsweise, sich Blut abnehmen oder röntgen zu lassen. Der Film zeigt eindrucksvoll, was man mit viel Geduld, Einfühlungsvermögen und Vertrauen selbst bei den scheusten Tieren erreichen kann. Wie sieht Gesundheitsvorsorge und medizinische Versorgung bei großen und oder wilden Tieren im Zoo aus, die weitaus wehrhafter sind und sich schon aufgrund ihrer Physis und Gefährlichkeit problemlos diesen Untersuchungen entziehen können? Außer es wird Zwang ausgeübt oder das Tier betäubt.Doch Zwang würde das Vertrauensverhältnis zwischen Tier und Mensch negativ beeinträchtigen. Und eine Betäubung sollte nur dann praktiziert werden, wenn sie medizinisch notwendig ist und nicht nur deshalb, um sich einem Tier gefahrlos nähern zu können. Die Folge in der Vergangenheit war deshalb oft, dass sich die medizinische Vorsorge in den Zoos auf das regelmäßige Untersuchen von Kotproben und das Beobachten der Tiere hinsichtlich Verhaltensauffälligkeiten beschränkt hatte. Um dies zu ändern, hat der Tiergarten Nürnberg unter Führung von Zootierärztin Dr. Katrin Baumgartner vor einiger Zeit damit begonnen, die Tiere des Tiergartens so zu trainieren, dass sie medizinische Untersuchungen oder Behandlungen mit etwas Positivem verbinden und diese freiwillig über sich ergehen lassen. Die Freiwilligkeit steht dabei an oberster Stelle. Die Tiere können jederzeit die Untersuchung oder Behandlung abbrechen. Das medizinische Training ermöglicht, dass viele Tiere im Tiergarten Nürnberg freiwillig zur Tierärztin kommen und sich Blut abnehmen oder röntgen lassen, einen Ultraschall machen, die Klauen flexen oder einfach nur abtasten lassen. Diese verschiedenen Maßnahmen kann Dr. Baumgartner wiederholt ohne Zwang umsetzen – ein Meilenstein bei der medizinischen Betreuung der Zootiere. Zwischenzeitlich wird dies bei fast allen Tierarten im Tiergarten Nürnberg angewandt, sogar bei Reptilien, fränkische Pionierarbeit sozusagen! Das medizinische Tiertraining ist eine sehr sensible Vertrauensangelegenheit und wird fast immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit praktiziert, weil kleinste Fehler oder negative Einflüsse durch Dritte viel bereits Erreichtes wieder zunichtemachen können. Dennoch durfte Filmautor Markus Schmidbauer mit seinem Kamerateam dieses Training bei vielen Tieren im Tiergarten Nürnberg über ein Jahr lang begleiten. Ein spannender und vielseitiger Einblick in das medizinische Tiertraining des Tiergartens Nürnberg. Viele interessante Fragen werden im Rahmen des Films beantwortet. Manches lässt sich auf Haustiere übertragen. (Text: BR Fernsehen) Geisterkatzen: Im Tal der Schneeleoparden
45 Min.Im Schatten der Gipfel des tibetischen Hochlands in der Provinz Qinghai gibt es ein verborgenes Tal, in dem mehr Schneeleoparden leben als irgendwo sonst auf der Erde. Die Filmautoren folgen einem trächtigen Weibchen auf der Suche nach einem sicheren Revier. In der chinesischen Provinz Qinghai sucht ein trächtiges Schneeleoparden-Weibchen nach einem sicheren Revier. In einem Tal findet die Schneeleopardin eine geeignete Höhle, in der sie zwei Junge zur Welt bringt. In den folgenden 18 Monaten dreht sich ihr Leben allein darum, die Kleinen mit ausreichend Nahrung zu versorgen und sie vor allen Gefahren zu schützen, die überall in der schroffen Bergwelt lauern.In dem Tal lebt auch ein altes, kampferprobtes Schneeleoparden-Männchen. Es könnte der kleinen Familie gefährlich werden. Zudem lockt der Alte jüngere Rivalen an, die ihn herausfordern wollen und auch der Schneeleopardin in die Quere kommen könnten. Sie würden nicht zögern, ihre Kleinen zu töten, um sich selbst mit dem Weibchen zu paaren. Und als wäre das nicht schon Ärger genug, ziehen immer wieder Yak-Herden durchs Tal, die von Tibetischen Mastiffs bewacht werden. Die Kälber der Wildrinder sind als Beute verlockend, aber die Yak-Mütter verteidigen ihren Nachwuchs mit spitzen Hörnern. Die Schneeleopardin wird all ihre Kraft und Geschicklichkeit brauchen, um ihre Jungen durch die ersten Monate zu bringen. Viele überleben das erste Jahr nicht. Aber sie ist eine erfahrene Mutter und gibt alles, damit schon bald die nächste Generation durch das Tal der Schneeleoparden ziehen kann. (Text: BR Fernsehen) Geisterkatzen: Im Wald der Luchse
45 Min.Holen Sie sich die Wildnis auf den Bildschirm – mit faszinierenden Tier- und Naturerlebnissen. Das Programm zeigt verblüffende Lebensräume zu Wasser, zu Land und in der Luft. Die Expeditionen begegnen Tieren auf Augenhöhe und stellen ihre einzigartigen Verhaltensweisen, Vorlieben und ihre Bedeutung für eine intakte Umwelt dar. (Text: BR Fernsehen)Geisterkatzen: In den Bergen der Pumas
45 Min.In Patagonien, weit im Süden von Chile und inmitten der schroffen Gebirgskette der Anden, verbirgt sich ein ganz besonderer Ort. Die Bedingungen hier sind hart – unablässig peitschen Winde über die kargen Hochebenen, die Sommer sind kurz, die Winter dafür lang und entbehrungsreich. Und doch ist der Nationalpark Torres del Paine ein Paradies für Pumas. Im Nationalpark Torres del Paine in Patagonien ist einem Pumaweibchen etwas Besonderes und Seltenes gelungen, dass ihr viel Kraft abverlangt: Die erfahrene Mutter hat gleich vier Junge zur Welt gebracht, die sie nun versorgen muss. Doch ihr Wille ist stark und sie stellt sich der Herausforderung.Die wichtigste Beute für Pumas sind die Guanakos. Die großen Pflanzenfresser sind doppelt so schwer wie ein ausgewachsener Puma, sind oft in engen Herden zusammen und haben scharfe Sinne. Das Pumaweibchen muss seine Kraft einteilen und so sucht sie vor allem nach verendeten Tieren oder solchen, die durch Krankheiten geschwächt sind. Die Mutter versorgt ihre Jungen nicht nur, sie versucht ihnen auch alles beizubringen, was sie später zum Überleben brauchen werden. Wie man richtig jagt, sich anschleicht und das Gelände nutzt. Die Kleinen müssen schnell lernen, denn nach einem guten Jahr werden sie auf sich alleine gestellt sein. Genau dieses Schicksal trifft die kleinen Pumas früher als geplant. Eines Tages kehrt ihre Mutter nicht mehr von der Jagd zurück. Ein tragischer Fehler bei der Jagd, ein anderer Puma oder eine Schneelawine haben sie höchstwahrscheinlich das Leben gekostet. Nach Monaten erscheint in dem alten Jagdgebiet des Pumaweibchens ein jüngeres Weibchen. Es ist eine ihrer Töchter, sie hat es tatsächlich geschafft zu überleben und tritt nun die Nachfolge ihrer Mutter an. Eine abenteuerliche Geschichte über ein extrem scheues Tier der Anden. (Text: BR Fernsehen) Geliebtes Alpaka
45 Min.Der neunjährige Christobal vom Hochlandvolk der Q’eros in den Anden soll Pate werden für ein neugeborenes Alpakafohlen, so ist es Brauch bei seinem Volk. Für seine Familie und die Menschen im Dorf bedeuten die Kleinkamele alles. Im Hochland der Anden zwischen 4.000 und 6.000 Metern über dem Meer schaffen es nur wenige Tierarten zu überleben. Zu ihnen gehören die Alpakas. Über 90 Prozent aller Alpakas, knapp vier Millionen Tiere, leben in den Anden Perus. Die höckerlosen Kleinkamele sind Überlebenskünstler in einer rauen Region. Viele Gefahren lauern vor allem für Neugeborene.Der neunjährige Christobal vom Hochlandvolk der Q’eros soll Pate werden für ein neugeborenes Alpakafohlen, so ist es Brauch bei seinem Volk. Die Q’eros gelten als direkte Nachfahren der Inka und haben uralte Bräuche zum Schutz ihrer Tiere bewahrt. Noch führen die Menschen das traditionelle Leben eines Naturvolkes, eng verbunden mit ihren Alpakas. Aber Christobal muss auf der Hut sein, denn der Tod ist in der lebensfeindlichen Höhe allgegenwärtig und jedes zweite Neugeborene stirbt. Seit er vier Jahre alt ist, ist Christobal Alpakahirte. Für seine Familie und die Menschen im Dorf bedeuten die Kleinkamele alles, sie sind überlebenswichtig. Sie sind auf die flauschig wärmende Wolle ihrer Alpakaherden angewiesen. Aus den feinen Fasern weben sie warme, kunstvoll gefertigte Kleidungsstücke mit uralten Mustern und Symbolen, die in die Zeit der Inka zurückreichen. Christobal gibt sein Bestes für sein neugeborenes Patentier. Mit einer Zeremonie wird die Patenschaft besiegelt, er gibt seinem Hengst den Namen Misti. Ab jetzt wird er ihm ein Leben lang verbunden bleiben und ihn beschützen, wenn er in Not ist. (Text: BR Fernsehen) Gemeinsam sind sie stark – Afrikas Zebramungos
45 Min.Sie sind die Überlebenskünstler der afrikanischen Steppen und Savannen: die Zebramangusten. Die kleinen, flinken und cleveren Tiere mit dem gestreiften Fell erreichen gerade einmal die Größe eines Marders. Doch gemeinsam sind sie stark. Zebramangusten, auch Mungos genannt, sind klein, flink, clever, haben ein gestreiftes Fell und sind die Überlebenskünstler der afrikanischen Steppen und Savannen. Im Familienverband schaffen es die selbstbewussten Winzlinge, Löwen zu entkommen und sogar Schlangen auszutricksen. Zwischen Elefantenherden, hungrigen Wildhunden und angriffslustigen Greifvögeln kämpft die Sippe des etwa 30 Mungos zählenden Magwa-Clans jeden Tag aufs Neue ums Überleben.Ort ihrer Abenteuer ist eines der größten Wildschutzgebiete der Welt: das Selous Reservat, 50.000 Quadratkilometer Wildnis im Herzen von Tansania, ein Gebiet größer als die Schweiz. Die Chefin der Truppe ist Ela, ein starkes Weibchen. Als Leittier wird sie von Odu, dem ranghöchsten Männchen, unterstützt. Die beiden führen die kleine Gruppe zu den besten Nahrungsplätzen, wissen, wann es Zeit ist, das Revier zu verlassen und anderenorts neue Baue zu graben, wie man Gefahren meistert und Dürreperioden übersteht. Mit Beginn der Regenzeit gibt es zahlreichen Nachwuchs beim Magwa-Clan. Eines der Babys ist der blinde Kisu. Sein Glück: Einzelgänger Toku, der beste Jäger der Gruppe, hat sich zu seinem Beschützer erklärt. Solange die Jungtiere noch klein und unbeholfen sind, droht den Mangusten besonders oft Gefahr: Sie müssen sich vor Adlern, Leoparden und Löwen in Acht nehmen. (Text: BR Fernsehen) Geparde – Afrikas elegante Jäger
45 Min.Während Gepardenweibchen ganz auf sich allein gestellt sind, genießen Löwinnen und ihr Nachwuchs den Schutz des Rudels.Bild: NDR/NDR/Reinhard RadkeDie Geparde der Serengeti, wie man sie noch nie gesehen hat: Aufnahmen mit der Superzeitlupenkamera zeigen sonst nicht wahrnehmbare Details der Jagdstrategien des schnellsten Landsäugetiers. Trotz ihrer Schnelligkeit sind Geparde als Einzelgänger in der afrikanischen Savanne in einer schwachen Position. Löwen jagen im Rudel, Leoparden sind kräftiger und die Hyänen als Clan unschlagbar. Oft werden die Jäger selbst zu Gejagten, besonders gefährlich wird es für Gepardenweibchen. Der Filmautor begleitet eine junge Mutter, die zum ersten Mal Nachwuchs hat, bei dem Versuch, möglichst viele ihrer Jungen großzuziehen.Er zeigt, welche Tricks im täglichen Überlebenskampf nötig sind, damit die elegante Katze ihre Kleinen durch die ersten gefährlichen Wochen bringen kann. Besonders die Löwen haben es auf sie und ihre Jungen abgesehen. Im selben Revier jagen zudem drei junge Gepardenbrüder, sodass das junge Weibchen oft leer ausgeht. Insgesamt ein Jahr bleiben die Gepardenjungen bei ihrer Mutter und lernen von ihr alles, was sie zum Überleben brauchen. HD-Superzeitlupentechnik mit bis zu 2.000 Bildern pro Sekunde ermöglicht eine vermeintlich bekannte Geschichte mit neuen Augen zu sehen. (Text: BR Fernsehen) Geschichten von der Bärenalm – Naturbeobachtungen im Nationalpark Bieszczady in Polen
Das Bieszczady-Gebirge wird oft als der schönste und wildeste Winkel Polens bezeichnet. Das Mittelgebirge ist Teil der Ostkarpaten mit einer einmalig klein strukturierten Landschaft. Es liegt direkt an den Grenzen zur Ukraine und Slowakei. Der höchste Gipfel ist die Tarnica mit 1.364 Metern. Heute leben im Bieszczady auf einem Quadratkilometer nur etwa 25 Menschen. Keine Industrie verschmutzt die Luft, es gibt nur wenige Straßen. Große Säugetiere wie Bären, Wölfe, Luchse und viele Vogelarten wie Schwarzstorch und Uhu sind hier zu Hause. Reh, Hirsch, Biber und Fischotter fühlen sich hier wohl. Die Pflanzenwelt ist sehr artenreich, sehenswert sind auch die weiten Buchenwälder. (Text: BR Fernsehen)Gibraltar – Brücke zwischen den Welten
45 Min.An der Südspitze Spaniens, wo sich Europa und Afrika beinahe berühren, wo sich die Wassermassen des Atlantiks mit denen des Mittelmeeres mischen, liegt die Straße von Gibraltar. Sie trennt Kontinente und Meere – und verbindet sie. Für Fische und Meeressäuger ist sie Passage zwischen Mittelmeer und Atlantik, den Vögeln dient sie als Brücke für ihren jährlichen Zug zwischen den Kontinenten. Die Wächter des Gibraltarfelsens, die Berberaffen, haben die Meerenge fest im Blick. Wie ihre wilden Artgenossen in Marokko, auf der anderen Seite der Gibraltarstraße, werden sie jedes Jahr Zeugen einer massenhaften Tierwanderung: des Vogelzugs zwischen Afrika und Europa.Mehr als 100.000 Störche und Zehntausende von Raub- und Singvögeln überqueren die nur 14 Kilometer breite Meeresstraße. Nirgends lässt sich der Vogelzug entlang dieser westlichen Vogelzugroute besser beobachten als hier. Unter Wasser dient die Meerenge als Passage für Fischschwärme und große Meeressäuger. Die Filmkamera taucht mit einem Familienverband von Grind- oder Pilotwalen, die im Meer zwischen den Kontinenten heimisch sind, und verfolgt die riesigen Pottwale, die zwischen Mittelmeer und Atlantik nach Beute jagen. Meeresströmungen und starke Winde beeinflussen das Leben in und entlang der Meeresstraße. (Text: BR Fernsehen) Giganten im Mittelmeer – Pottwalen auf der Spur
45 Min.Von links: Thomas Behrend und der Meeresbiologe Alexandros Frantzis halten Ausschau nach Pottwalen im Mittelmeer.Bild: Blue Planet Film/BR/NDREtwa 200 Pottwale leben heute noch im westlichen Mittelmeer (2009) – sie zu finden ähnelt der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen. Mit Unterwasser-Mikrofonen gelingt es, die Pottwale zu orten. Doch Pottwale im Mittelmeer zu filmen, wird für Thomas Behrend und sein Team zur Herausforderung. Pottwale sind die größten Raubtiere der Erde. Sie jagen in den Tiefen der Ozeane und im Mittelmeer. Erst seit einigen Jahren erforscht der griechische Wissenschaftler Alexandros Frantzis die isolierte Population, Filmaufnahmen gibt es kaum. Gemeinsam mit dem deutschen Tierfilmer Thomas Behrend bricht er in die Gewässer vor Griechenland auf, um die heimlichen Giganten zu filmen.Mit Unterwasser-Mikrofonen gelingt es, die Pottwale zu orten. Es ist schwierig, aber schließlich gelingt es Behrend, Zusammenkünfte von Pottwal-Weibchen zu filmen – einzigartige Bilder entstehen, die selbst den langjährigen Unterwasser-Kameramann berühren. Doch als er sich einer scheinbar friedlichen Gruppe im Wasser nähert, geschieht das Unfassbare: Die mächtigen Wale versuchen plötzlich, ihn zu vertreiben. Behrend schwimmt mit aller Kraft zurück – ein einziger Flossenschlag könnte ihn töten. Was dann folgt, werden Behrend und Frantzis nie in ihrem Leben vergessen: Mit atemberaubenden Aufnahmen dokumentiert dieser Film Verhaltensweisen von den seltenen Pottwalen. (Text: BR Fernsehen) Gorillas unter Stress – Lebensraum am Limit
45 Min.Nach einer jüngsten Erhebung ist die Zahl der Berggorillas auf 1.063 gewachsen. In der seltenen Erfolgsstory den Schutz bedrohter Tierarten betreffend zeigen sich allerdings auch Schattenseiten. Was passiert, wenn die Population wächst, ihr Habitat aber nicht? Aktuelle Untersuchungen internationaler Forscher zeigen, dass das Stressniveau der Tiere deutlich ansteigt … Es gibt Hoffnung für die letzten Berggorillas der Erde! Ende 2018 ging eine großartige Nachricht um die Welt: Die Zahl dieser Menschenaffen ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Nach der jüngsten Zählung der frei lebenden Primaten werden aktuell 1.063 vermeldet! Doch was passiert, wenn die Population wächst, ihr Habitat aber nicht? Die letzten Berggorillas der Erde leben in nur zwei sehr kleinen Schutzgebieten im östlichen Afrika: zum einen an den Hängen der Virunga-Vulkane zwischen Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo, zum anderen im Bwindi-Wald in Uganda.Zwei kleine, grüne Inseln – umgeben von Gebieten, die eine der höchsten Bevölkerungsdichten Afrikas aufweisen. Abwandern können die Tiere nicht. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und dem Dian Fossey Gorilla Fund haben festgestellt, dass die Gorillagruppen heute deutlich häufiger aufeinandertreffen als früher. Diese Begegnungen enden oft in aggressiven, teils auch tödlichen Kämpfen. Jüngste Analysen von Kotproben sowie Langzeitbeobachtungen bestätigten, dass das Stressniveau der Tiere deutlich ansteigt. Wo liegen die Grenzen beim Artenschutz, und wie reagieren die Experten auf die neuen Herausforderungen? Die Dokumentation zeigt in beeindruckenden Bildern das Leben der letzten frei lebenden Berggorillas der Welt und präsentiert die provozierenden Erkenntnisse der erfolgreichen Schutzbemühungen. Am Ende steht die Frage nach der Zukunft des Zusammenlebens von Mensch und Tier. (Text: BR Fernsehen) Das Graue Langohr – Winzling im Kitzinger Land
45 Min.Seit rund zehn Jahren bestimmen Fledermäuse den Alltag von Christian Söder. Vor allem eine Art ist ihm besonders ans Herz gewachsen: das Graue Langohr (Plecotus austriacus). Seit einer besonderen Begegnung mit einem Grauen Langohr ist er von diesen Tieren fasziniert und setzt sich leidenschaftlich für ihren Schutz ein. Das ist auch nötig, denn das Graue Langohr hat es schwer. Es kommt zwar fast in ganz Bayern vor, allerdings sinkt die Anzahl der Tiere seit etwa 25 Jahren. Das Graue Langohr (Plecotus austriacus) kommt zwar in fast ganz Bayern vor, allerdings sinkt die Anzahl der Tiere seit etwa 25 Jahren.Zudem ist es nicht einfach, diese Fledermäuse zu entdecken. Sie werden gerade einmal sechs Zentimeter groß, leben sehr unauffällig und nur in kleinen Kolonien mit maximal 20 bis 30 Tieren. Das Graue Langohr ist eine typische Dorffledermaus und gilt als klassischer Kulturfolger. Christian Söder ist aktiv im Projekt „Rettet das Graue Langohr“. In der Kolonie der Fledermäuse unter dem Dach seines Wohnhauses kann er das Verhalten der Tiere genau beobachten. Regelmäßig sammelt er Kotproben der Tiere. Die werden dann von einer Biologin analysiert, um herauszufinden, was alles auf dem Speiseplan des Grauen Langohrs steht. Als Fachberater für Fledermausschutz im Landkreis Kitzingen wird Christian Söder auch immer dann gerufen, wenn Hausbesitzer einen Umbau planen und Fledermäuse unter dem Dach leben. Allein im Landkreis Kitzingen sind 18 Fledermausarten nachgewiesen. Bei seinen Begehungen sucht Christian Söder nach Spuren der Tiere, wie Fraß- oder Kotreste, und notiert potenzielle Ein- und Ausflüge im Dachstuhl. Denn nicht nur die Tiere sind geschützt, sondern auch die Quartiere, in denen sie leben. Um die Lebensbedingungen des Grauen Langohrs zu verbessern, wurde das Artenschutzprogramm „Graues Langohr“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt beinhaltet die Suche nach Fledermausvorkommen und das Betreuen von Fledermausquartieren im Weinlandkreis Kitzingen. „Rettet das Graue Langohr“ ist eine Initiative der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern an der Universität Erlangen im Auftrag des Landesamtes für Umwelt. Mit dabei sind die Landschaftspflegeverbände Kitzingen und Eichstätt sowie die Städte Kitzingen und Mainbernheim. Im Rahmen des Projektes möchte man mehr über die Lebensweise des Grauen Langohrs erfahren, um konkrete Schutzmaßnahmen einleiten zu können. Durch konkrete Maßnahmen soll der Lebensraum der Fledermäuse aufgewertet werden. Dazu gehört das Anlegen von Blühflächen, Streuobstwiesen und die Förderung von Naturgärten. Damit profitieren von dem Artenschutzprogramm, das auch den Untertitel „Flurbereicherung“ trägt, nicht nur die Fledermäuse, sondern auch Vögel, viele Insekten und zahlreiche weitere Tierarten. (Text: BR Fernsehen) Das größte Krokodil der Welt
Das größte Krokodil der Welt könnte ein Sunda-Gavial sein. Denn er legt die größten Eier aller noch lebenden Krokodilarten, woraus die längsten Jungkrokodile schlüpfen. Aber gibt es heute überhaupt noch solche riesigen Exemplare? Der deutsche Biologe Rene Bonke macht sich in den Sumpfwäldern von Borneo auf die Suche. Der Sunda-Gavial ist eines der geheimnisvollsten und seltensten Krokodile der Welt. Versteckt und zurückgezogen lebt er in den letzten Sumpfwäldern Südostasiens. Die Einheimischen nennen den Sunda-Gavial deshalb auch „Buaya malu“ – das schüchterne Krokodil.Kaum etwas ist über das Krokodil mit der langen Schnauze bekannt. Worauf aber gründet sich die Annahme, dass der Gavial das größte Krokodil dieser Welt sein könnte? Da ist zum einen die Größe seiner Eier und die daraus schlüpfenden Jungtiere sind größer als die jedes anderen Krokodils. Und da sind die enormen Schädel von Museumsexemplaren – meist sind nur die Augen und die lange Schnauze zu sehen. Unter den sechs größten Krokodilschädeln der Welt befinden sich fünf Sunda-Gaviale. Der größte (84 cm) liegt im British Museum in London, der zweitgrößte (81,5 cm) sowie drei weitere der größten in der Zoologischen Staatssammlung München. Und noch dazu stammen diese Schädel aus Zentral-Kalimantan auf Borneo. Alle Spuren führen an diesen Ort. Der deutsche Biologe Rene Bonke macht sich gemeinsam mit seinem indonesischen Freund, dem Nationalpark-Ranger Androw Mikho Sion, in den Sumpfwäldern des Tanjung Puting Nationalparks auf die Suche nach dem vielleicht größten Krokodil der Welt. (Text: BR Fernsehen) Die größten Wasserfälle der Erde – Naturwunder Iguaçu
Die Wasserfälle von Iguaçu im Grenzland von Argentinien und Brasilien sind die größten der Erde, breiter als die Victoriafälle und höher als die berühmten Niagarafälle. In atemberaubenden Bildern porträtiert Filmemacher Christian Baumeister die wohl schönsten Wasserfälle der Erde. Im Grenzland von Argentinien und Brasilien liegen sie wie ein Juwel eingebettet im undurchdringlichen Regenwald: die Wasserfälle von Iguaçu, die größten der Erde, breiter als die Victoriafälle und höher als die berühmten Niagarafälle. Über eine Breite von rund 2.700 Metern stürzen die Wassermassen mit ohrenbetäubendem Lärm bis zu 80 Meter in die Tiefe.In atemberaubenden Bildern porträtiert Filmemacher Christian Baumeister die wohl schönsten Wasserfälle der Erde. Die Katarakte sind mehr als ein beeindruckendes Naturschauspiel: Das „große Wasser“, wie sie die Guarani-Indianer nennen, ist eindrucksvolle Kulisse für eine Vielzahl von Tieren. Hinter dem Vorhang aus Wasser brüten elegante Rußsegler im Fels. Wo sich der Dunst der Wasserfälle über den Urwald legt, bringen Nasenbären in selbst gebauten Baumnestern ihren Nachwuchs zur Welt. Auch ihnen folgt Christian Baumeister und berichtet von ihren ersten, tollpatschigen Kletterversuchen, Begegnungen mit giftigen Schlangen oder Spielen in den Baumkronen. Doch das Paradies Iguaçu ist bedroht. Immer häufiger zieht es Wilderer in den Nationalpark. In riskanten Aktionen stellen die Park-Ranger den illegalen Jägern nach. Und Biologen setzen alles daran, um die letzten Jaguare und Kaimane zu schützen oder verschollene Riesenotter aufzuspüren. Filmautor Christian Baumeister zeichnet ein wunderbares wie atemberaubendes Porträt einer der schönsten Regionen der Erde und berichtet von der Tierwelt und den Menschen, die sich dem Schutz der einzigartigen Wasserfälle und des Nationalparks von Iguaçu verschrieben haben. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail