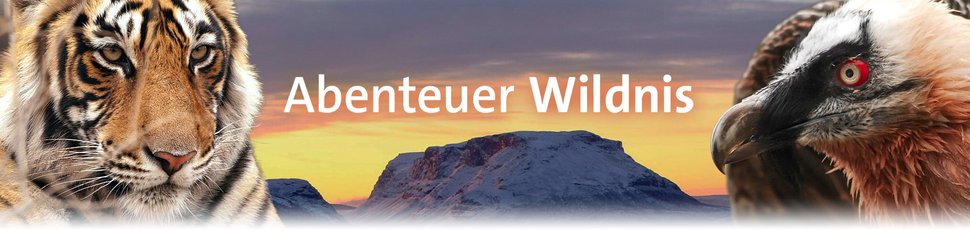553 Folgen erfasst seit 2020 (Seite 13)
Portugal – Europas Wilder Westen
45 Min.Portugal birgt viele Überraschungen. Sein Klima ist geprägt von atlantischer Kühle im Norden und mediterranem Flair im Süden. So hat sich ein Mosaik unterschiedlichster Lebensräume entwickelt – mit einzigartigen Bewohnern. Christian Baumeisters filmische Entdeckungsreise durch Portugals Natur präsentiert das Touristenland aus einem anderen Blickwinkel. Sie folgt seiner wilden, ungezähmten Tierwelt und stellt mit atemberaubenden Luftaufnahmen seine ungeahnte landschaftliche Vielfalt vor. Die Reise des Filmteams durch Portugal beginnt am westlichsten Rand Europas.Von dort zogen einst Seefahrer aus, um die Welt zu erkunden. Hier präsentiert sich die Küste rau und ungestüm, sturmgepeitschte Wassermassen prallen mit ungebremster Wucht auf die Felsen. Ausgerechnet diese letzte Bastion vor dem Atlantik hat sich eine Storchenkolonie zum Nisten ausgesucht. Die Störche vom Cabo Sardăo, 150 Kilometer südlich von Lissabon, sind die einzigen auf der Welt, die auf Felsen brüten. Hoch oben im gebirgigen Norden des Landes tragen atlantische Winde feuchte Luftmassen heran, die sich an den fast 2.000 Meter hohen Berggipfeln entladen. Im Nationalpark Peneda-Geres regnet es 150 Tage im Jahr, das ist selbst den widerstandsfähigen Garrano Wildpferden manchmal zu viel. Dann ziehen sie sich in den Wald zurück. Dort allerdings droht Gefahr durch ein Rudel Iberischer Wölfe, das die dichten Wälder durchstreift. Im Nordosten Portugals schlängelt sich der Fluss Duero entlang der spanischen Grenze gen Süden. Dort suchen Gänsegeier die Täler nach Kadavern ab. Abgeschirmt von den hohen Bergketten des Nordens ist es hier viel trockener. Die großen Aasfresser arbeiten im Team, hat einer etwas erspäht und landet, lockt das etliche Artgenossen herbei. Mit Überschreiten des Flusses Tajo in südlicher Richtung ändert die Landschaft ihr Gesicht erneut. Das Klima gelangt unter mediterranen Einfluss. Wo einst lichte Wälder wuchsen, erstreckt sich heute eine weite Steppenlandschaft, der Alentejo. Hier hat die Großtrappe noch viel Raum für eine spektakuläre Balz. Wo Korkeichenwälder die Landschaft dominieren, geht im Schutz der Dunkelheit ein geheimnisvoller Jäger auf die Pirsch. Die Weidensperlinge, die in den Korkeichen nisten, müssen sich in Acht nehmen. Die Ginsterkatze ist ein geschickter Kletterer, auch wenn sie näher mit Hyänen als mit echten Katzen verwandt ist. Am südlichsten Ende von Portugal angekommen, liegt weit entfernt von den nebelumwobenen Bergen des Nordens die Algarve: Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist die Region eine der sonnenreichsten Europas. Hier geht das gut getarnte, Wärme liebende Chamäleon auf die Jagd. Und in der einzigartigen Lagunenlandschaft Ria Formosa führen die Männchen der Winkerkrabben eine beeindruckende Choreografie auf, um Weibchen in ihre Sandröhren zu locken. Berühmt ist die Algarve insbesondere für ihre imposanten Felsformationen, über Jahrmillionen von Wind und Wellen geschaffen. Hier vollbringt ein eher unscheinbares Tier etwas, das sonst nur Pflanzen gelingt: Die Grüne Samtschnecke lagert Chloroplasten in ihrer Haut ein und betreibt damit Fotosynthese. (Text: BR Fernsehen) Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean
45 Min.Eine fantastische Reise durch ein abenteuerliches Portugal: Festland, Meer und Inseln. Erde, Wasser, Luft und Feuer – Portugals Natur- und Tierwelt versucht im ständigen Gezerre seiner Elemente zu leben und zu überleben. Filmautor Gernot Lercher folgt Tieren in den unterschiedlichsten Habitaten auf ihrem ungewissen Weg dem Horizont entgegen. Fast so, als seien die Eroberer, Seeleute und Entdecker längst vergangener Tage ihre Vorbilder. Die filmische Reise durch ein Portugal voller Abenteuer: Die Geschichten sind fantastisch und draufgängerisch. Sie erzählen von Wildpferden in den schroffen Bergen Nordportugals, die schon die Konquistadoren nach Amerika begleitet haben, genauso wie von Seepferdchen, die an der Küste der Algarve so häufig anzutreffen sind wie sonst nirgendwo auf der Welt.Die Tierwelt Portugals offenbart sich in grenzenloser Vielfalt. Hier ruft das Meer und dort das Land. „Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean“ ist eine atemberaubende Dokumentation über ein Land am äußersten Rand Europas. Dort wo sich Anfang und Ende treffen, das Leben und der Tod – und alles, was dazwischen liegt. (Text: BR) Präriehunde – Der Ruf des Wilden Westens
Die Präriehunde im amerikanischen Westen galten Anfang des 20. Jahrhunderts dort lediglich als Ungeziefer, das die Ernteerträge verminderte und angeblich Krankheiten übertrug. Allein in Texas wurden binnen weniger Jahre 99,8 Prozent der Bestände getötet. Ein schwerer Eingriff in den Lebensraum „Prärie“. Der Präriehund-Bau, mit bis zu 300 Meter langen unterirdischen Gängen, lockert den von Rindern und Bisons fest getrampelten Boden immer wieder auf. In der Regenzeit füllen sich die tiefer gelegen Bereiche mit Wasser – ein überlebenswichtiges Reservoir für alle Pflanzen während der trockenen Monate.Und andere Präriebewohner nutzen den Bau der Präriehunde oft als Brutstätte. Moderne wissenschaftliche Methoden haben es möglich gemacht, die bemerkenswerteste Eigenschaft dieser kleinen Präriebewohner aufzudecken: Sie haben eine Sprache. Für das menschliche Ohr kaum wahrnehmbar, zeigt die Analyse ihrer Schreie im Computer, dass sich Präriehunde äußerst differenziert verständigen können. Von den außergewöhnlichen Experimenten, mit den Wissenschaftler diesen Fähigkeiten nachgespürt haben, wird in diesem Film erzählt. (Text: BR Fernsehen) Das Rätsel der Andamanen-Elefanten
45 Min.Eine Elefantenkuh mit ihrem jungem Elefantenbullen am Strand.Bild: Les Films d'Ici/BR/Philippe GautierIm 19. Jahrhundert begannen europäische Seefahrer, die Andamanen zu erkunden: Dort gab es keine der in Südasien vorkommenden großen Säugetiere, auch keine Elefanten. Heute werden sie für die Holzgewinnung eingesetzt, und kleine Herden leben in freier Wildbahn. Wie gelangten sie auf die Inseln, und wie konnten sie neue Gebiete erobern? Es heißt, dass die Elefanten auf den Andamanen im Meer von Insel zu Insel schwimmen. Ein Film über die rätselhafte Geschichte der Andamanen-Elefanten. Als die europäischen Seefahrer im 19. Jahrhundert begannen, die Andamanen zu erkunden, waren sie überrascht. Auf den fast 200 Inseln der Inselgruppe im Indischen Ozean zwischen dem Golf von Bengalen und der Andamanensee gab es keine der in Südasien vorkommenden großen Säugetiere, insbesondere keine Elefanten.Auf anderen Inseln im Indischen Ozean wie Sumatra, Borneo oder Sri Lanka, die eine ähnliche geologische Geschichte haben, war die Art jedoch vorhanden. Ihr Fehlen war umso rätselhafter, als auf den Andamanen Menschen leben, deren Vorfahren die Inseln wahrscheinlich während der letzten Eiszeit auf dem Landweg erreichten. Warum also nicht die Elefanten? Ironischerweise brachte die britische Kolonialverwaltung ab 1858 Elefanten per Schiff aus Birma und Indien auf die Andamanen und nutzte sie für die Holzgewinnung, eine Industrie, für die diese Tiere damals unverzichtbar waren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts gelang es jedoch einigen dieser Elefanten zu entkommen oder sie wurden ausgesetzt und fanden Zuflucht auf verlassenen Inseln, wo sie wieder ausgewildert wurden: Eine Ausnahme in der Geschichte dieser Art, die unter dem Verlust ihres natürlichen Lebensraums im übrigen Asien leidet. Wie haben sie also diese Inseln erreicht? Indem sie im Meer schwammen, wie bisher angenommen wurde? Die rätselhafte Geschichte der Andamanen-Elefanten steht im Fokus des Films. (Text: BR) Raubtiere vor der Haustür – Harzluchse und Heidewölfe
45 Min.Ole Anders zeigt Ulrike Müller, wo einer der Harzer Luchse die Autobahn in Richtung Hessen überquert hat.Bild: BR/NDR NaturfilmWas ist, wenn Wolf, Luchs und Bär in den Gebieten leben, in denen man spazieren geht, Pilze sammelt oder joggt? Holger Vogt macht in einer spannenden Reportage mit faszinierenden Naturaufnahmen die Rückkehr der Raubtiere zu einem Erlebnis und gibt Antworten auf die Frage, wie es sich mit ihnen leben lässt. Der Journalist Tim Berendonk wird auf das Thema von rückkehrenden Raubtieren aufmerksam, als 2012 das erste Wolfspaar in Niedersachsen Nachwuchs bekommt. Es ist das am westlichsten zwischen Hamburg und Hannover lebende Wolfsrudel, das keine zehn Kilometer von der A7 entfernt in der Heide jagt.Zusammen mit der Umweltwissenschaftlerin Ulrike Müller recherchiert Tim Berendonk in Deutschland und in Ländern, in denen diese Tiere nie ganz ausgerottet wurden. Die beiden reisen durch Finnland und wollen erfahren, wie dort Landbevölkerung, Rentierzüchter und Jäger mit Wölfen, Luchsen und Bären klarkommen, und wie die großen Raubtiere zunehmend zum Touristenmagneten werden. Ganz anders ist die Situation in Deutschland und Mitteleuropa. Vor 150 bis 200 Jahren sind Wolf, Luchs und Bär vom Menschen ausgerottet worden. Nun kehren sie zurück, nachdem ihr Schutz in der EU gesetzlich verankert worden ist. Sie dringen immer weiter vor, vor allem in den ländlichen Raum. Dort sind die Tiere wie Wolf, Luchs und Bär nicht immer willkommen, etwa wenn sie Schafe auf den Weiden töten. Eine Vielzahl der Hobbyjäger sieht in Wolf, Luchs und Bär eine Konkurrenz bei der Jagd auf heimisches Wild. Mit faszinierenden Naturaufnahmen macht Filmautor Holger Vogt die Rückkehr der Raubtiere zu einem Erlebnis und gibt Antworten auf die Frage, wie es sich mit Wölfen, Luchsen und vielleicht auch bald wieder Bären leben lässt. (Text: BR Fernsehen) Der Rauch, der donnert – die Victoria-Fälle
45 Min.Schon aus der Ferne ahnt man etwas Besonderes: Trotz wolkenlosem Himmel hält sich eine Wolkenwand dicht am Erdboden – es sind die Sprühnebel der Victoria-Fälle, die bis zu 300 Meter aufsteigen und kilometerweit zu sehen sind: Mosi oa Tunya, „der Rauch, der donnert“ nennt man hier die Victoria-Fälle. Sie sind die größten Wasserfälle Afrikas und bilden zur Regenzeit den breitesten Wasservorhang der Welt.Bild: BR/Udo ZimmermannDie Sprühnebel der Victoria-Fälle, der größten Wasserfälle Afrikas, steigen bis zu 300 Meter auf und sind kilometerweit zu sehen. Catherine Blinston und Udo Zimmermann erzählen Natur- und Tiergeschichten rund um dieses gigantische Naturschauspiel. Schon aus der Ferne ahnt man etwas Besonderes, trotz wolkenlosem Himmel hält sich eine Wolkenwand dicht am Erdboden – es sind die Sprühnebel der Victoria-Fälle, die bis zu 300 Meter aufsteigen und kilometerweit zu sehen sind: „Mosi oa Tunya“, „der Rauch, der donnert“, werden hier die Victoria-Fälle genannt. Sie sind die größten Wasserfälle Afrikas und bilden zur Regenzeit den breitesten Wasservorhang der Welt.Auf fast zwei Kilometer Länge stürzen die Wassermassen über eine 110 Meter hohe Felswand tief in die Schlucht, in der der Sambesi seinen Weg fortsetzt. Aus der Luft sieht es aus, als würde der Fluss in einer Wolke aus Gischt einfach verschwinden. Catherine Blinston und Udo Zimmermann haben Natur- und Tiergeschichten rund um die Victoria-Fälle dokumentiert: Von Flusspferden, die im Sambesi ihre festen Reviere haben und von Bootsfahrern ängstlich gemieden werden; von Fischadlern, die im fischreichen Sambesi genug finden, um ihre Küken großzuziehen; von „Big Tree“ – einem 800 Jahre alten Baobab-Baum in unmittelbarer Nähe der Schlucht; von dem Regenwald, der im Regen der Sprühnebel eine ganz eigene Mikrofauna bildet und nicht zuletzt, von den Fluss-Elefanten, die auf den Inseln über den Wasserfällen ein Schlaraffenland finden, das sie aber rechtzeitig verlassen müssen, bevor das Hochwasser den Rückweg versperrt. Eine beeindruckende Mischung aus grandiosen Stimmungen rund um die Victoria-Fälle und viele kleine Geschichten zeichnet diese Dokumentation aus. (Text: BR Fernsehen) Raupe auf Reisen
45 Min.Eine Schmetterlingsraupe wird auf einem Zitronenbaum geboren. Hier soll sie wachsen, bis sie sich erst in eine Puppe und dann in einen Schmetterling verwandelt. Aber ein Gewitter macht alles zunichte und führt dazu, dass die kleine Raupe von ihrem Baum fällt und von Wind und Regen davongetragen wird. Die Raupe hat nur drei Tage, um zu ihrem Baum zurückzufinden, nur dort kann ihre Verwandlung in einen Schmetterling stattfinden. Große Reise einer Schmetterlingsraupe: Durch die Reise ums Überleben einer kleinen Raupe entdeckt man den unglaublichen Reichtum der Mikrowelten. Mit opulenten Bildern entführt der Film in eine andere Welt.Die Welt im Kleinen, die uns jeden Tag umgibt. Die Filmautoren begleiten eine kleine Raupe auf ihrer großen Reise durch verschiedene Ökosysteme, immer mit dem Ziel zu überleben. Der Film taucht ein in die Welt dieser Raupe, wo eine Wiese ein unendliches Gräsermeer, ein Teich ein Ozean und ein Gartenweg eine Wüste ist. Liebevoll und mit viel Aufwand produziert, faszinieren die fantastischen Bilder dieses Mikrokosmos. Unter unseren Füßen und überall um uns herum existieren unzählige Parallelwelten, in denen es nur so von Leben wimmelt: Millionen von Tier- und Pflanzenarten gedeihen dort, ohne dass der Mensch es auch nur wahrnimmt. (Text: BR Fernsehen) Das Reich der Löwen: Feindesland
45 Min.Der Zusammenhalt im Löwenrudel ist wichtig für seinen Fortbestand. Die gegenseitige Fellpflege stärkt die soziale Bindung zwischen den Weibchen.Bild: BR/NDR/TMFS Marc MollTierfilmer Owen Prümm hat sechs Jahre lang im Ruaha Nationalpark in Tansania drei Löwenrudel mit der Kamera verfolgt. Der Ruaha Nationalpark in Tansania ist größer als der berühmte Serengeti-Nationalpark und gilt als eines der am besten gehüteten Naturgeheimnisse im Osten Afrikas. Dank riesiger Büffelherden leben hier mehr Löwenrudel als irgendwo sonst in Afrika. Tierfilmer Owen Prümm hat sechs Jahre lang drei Löwenrudel mit der Kamera verfolgt. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Saga vom Kampf ums Überleben, von dramatischen Jagden auf Giraffen, Büffel und Gazellen, von Allianzen und Feindschaften im Königreich der Löwen. Teil zwei folgt am 15.09.23 um 11:20 Uhr im BR Fernsehen. (Text: BR Fernsehen)Das Reich der Löwen: Jagdfieber
45 Min.Beim Aufteilen der Beute wird der freche Nachwuchs vom Vater in die Schranken gewiesen.Bild: BR/NDR/TMFS Marc MollIm Osten Afrikas, im Ruaha Nationalpark in Tansania, leben Dank riesiger Büffelherden mehr Löwenrudel als irgendwo sonst in Afrika. Er ist größer als der berühmte Serengeti-Nationalpark und gilt als eines der am besten gehüteten Naturgeheimnisse im Osten Afrikas: der Ruaha Nationalpark in Tansania. Dank riesiger Büffelherden leben hier mehr Löwenrudel als irgendwo sonst in Afrika. Sechs Jahre hat Tierfilmer Owen Prümm drei Löwenrudel verfolgt. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Saga vom Kampf ums Überleben, von dramatischen Jagden auf Giraffen, Büffel und Gazellen, von Allianzen und Feindschaften im Königreich der Löwen. (Text: BR Fernsehen)Die Reise der Kraniche – Flug ohne Grenzen
45 Min.Wie finden Kraniche einen Weg, den sie nie zuvor geflogen sind? Zwei in Estland geborene Jungkraniche werden mit einem Sender versehen und können dadurch auf ihrem Erst-Flug vom Baltikum ins Winterquartier nach Äthiopien verfolgt werden. Die Reise zweier in Estland geborener Jungkraniche wird mit Sendern verfolgt. Sie fliegen das erste Mal vom Baltikum ins Winterquartier nach Äthiopien. Eine Odyssee von sage und schreibe 6.000 Kilometern, voller Überraschungen und mit Zwischenstopps in der Ukraine, der Türkei und in Israel. Am Boden begleitet werden die jungen Kraniche dabei von den Filmemachern, über Grenzen hinweg, vorbei an alten Kulturen, durch wilde Landschaften und umkämpfte Gebiete. Wie orientieren sich die Vögel, welcher Sinn weist ihnen den unbekannten Weg? Die Filmautoren suchen die Antwort und untersuchen dabei gleichzeitig den Mythos der Kraniche als Symbol für Frieden und Freiheit in verschiedenen Zeiten und Kulturen. (Text: BR Fernsehen)Die Reise der Schneeeulen – Ein Wintermärchen
Die Schneeeule führt ein geheimnisvolles Leben nördlich des Polarkreises. In ganz besonderen Jahren aber tauchen Schneeeulen sogar in Deutschland auf – eine ornithologische Sensation. Der Lebensraum der Schneeeulen liegt nördlich des Polarkreises. In ganz besonderen Jahren jedoch tauchen Schneeeulen sogar in Deutschland auf. Zwischen 2002 und 2014 wurden vereinzelt Schneeeulen in Mitteleuropa gesichtet – eine ornithologische Sensation. Doch was treibt die hervorragend an die arktische Tundra angepassten Schneeeulen plötzlich in unsere Breiten? Schneeeulen und Lemminge bilden seit Jahrtausenden eine Schicksalsgemeinschaft.Etwa alle vier Jahre vermehren sich die Lemminge massenhaft. Dann gibt es für die Schneeeulen genug Futter für die Jungenaufzucht. Die Eulen legen dann bis zu elf Eier und können erfolgreich ihre Küken großziehen. Doch in den letzten Jahren scheinen in einigen Regionen der Tundra die zyklischen Massenvermehrungen auszubleiben. Die beste Anpassung an den Winter ist es, rechtzeitig in den Süden zu fliehen, wie es die meisten Zugvögel tun. Ist der nordische Winter zu kalt, der Schnee zu hoch, müssen die Eulen, um zu überleben, abwandern. Eine abenteuerliche Reise der Schneeeulen beginnt … Klaus Weißmann nimmt in seinem Film die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf diese ungewöhnliche Reise der Schneeeulen. Zu sehen ist, wie sich Tiere vom Norden bis in den Süden den unwirtlichen klimatischen Bedingungen des Winters anpassen, welche ökologischen Zwänge auf der Tierwelt lasten, und welche fantastischen Strategien es gibt, die lebensbedrohliche Kälte zu überleben. (Text: BR Fernsehen) Eine Reise mit dem Lech
45 Min.Die Dynamik der Alpenflüsse bricht die Oberflächenspannung, setzt Tropfen wieder frei und lässt feinen Wasserstaub sogar wieder in die Luft verdunsten.Bild: BR/Udo A. ZimmermannEin Gewitter im Gebirge. Die ersten Tropfen fallen und gehen auf eine lange Reise. Noch sind die Voraussetzungen für alle gleich. Aber bald trennen sich ihre Wege, und jeder Wassertropfen hat andere Schwierigkeiten zu überwinden: 2.000 m Höhenunterschied, tausend Kilometer. Manche erreichen den Lech schneller, andere nie. Die Reise endet im Schwarzen Meer. Ein Gewitter zieht auf, Blitze zucken, die ersten Tropfen fallen vom Gipfelkreuz an der Ravensburger Hütte. Es sind viele Tropfen, die auf die Reise gehen, eine Reise, die vom Hochgebirge bis ins Meer geht. Manche Tropfen Swerden ihr Ziel schneller erreichen, andere nie.Einige dieser Wassertropfen versickern im karstigen Untergrund, andere finden an der Oberfläche ihren Weg und erreichen den Lech, schließlich das Schwarze Meer. Nur wenige Gebirgsflüsse haben heute noch ihren natürlichen Raum, dürfen sich, wie der Lech bei Forchach, jedes Jahr einen neuen Weg suchen. Das eindrucksvolle Ergebnis: kilometerbreite Sand- und Kiesfelder. Mit dem Wasser werden Sand und Steine, die von Gletschern seit den Eiszeiten abgeschliffen wurden, mittransportiert. Die Reibung im Wasser poliert die Steine, bis sie zu runden Kieseln werden. (Text: BR Fernsehen) Rendezvous mit einem Riesenkraken – Die Geschichte von Ellie
45 Min.Florian Graner zeigt das geheimnisvolle Leben Pazifischer Riesenkraken. Dabei baut er ein enges Verhältnis mit den wildlebenden Tintenfischen auf. Parallel dazu verfolgt er die Entwicklung des jungen Weibchens in einem Aquarium. Ellie löst dort zunehmend komplexere Aufgaben. Mit acht Armen, neun Hirnen und manchmal zehn Meter Spannweite sind Pazifische Riesenkraken fremdartige Kreaturen – und mit bis zu einem Zentner Gewicht die größten Oktopusse der Welt. In seiner eindrucksvollen Naturdokumentation zeigt Meeresbiologe und Tierfilmer Florian Graner das geheimnisvolle Leben dieser Verwandten von Schnecken und Muscheln und geht ihrer außerordentlichen Intelligenz auf den Grund.Bei Tauchabenteuern in den Fjorden im Nordosten der USA baut er ein enges Verhältnis mit den wildlebenden, eigentlich sehr scheuen Tintenfischen auf. Dabei gelingen ihm eindrucksvolle Szenen von einem Rendezvous unter Riesenkraken und von der aufopfernden Brutpflege eines Oktopusweibchens vor Seattle: Monatelang bewacht und umsorgt die werdende Mutter ihr Gelege aus Zehntausenden von Eiern, bis die Jungen schlüpfen – und sie erschöpft stirbt. Parallel dazu verfolgt Florian Graner die Entwicklung des jungen Riesenkraken Eleonora im Aquarium von Port Townsend: Ellie löst dort zunehmend komplexere Aufgaben, vor die sie gestellt wird. Die Wandlungsfähigkeit ihres Körpers, die schnelle Auffassungsgabe und die Zugewandtheit des Tintenfisches beeindrucken Florian. Ellie geht regelmäßig auf Kuschelkurs mit ihm. Nach einem Jahr bringt Florian den mächtig gewachsenen Tintenfisch in seinen angestammten Lebensraum zurück – voller Respekt für eine andersartige Intelligenz, einen völlig unterschiedlichen Entwurf der Natur. Denn Riesenkraken sind bizarre Wesen mit rasantem Lebenslauf: Innerhalb von nur vier Jahren werden sie bis zu zehn Meter groß; die „Aliens“ haben Köpfchen, sind neugierig und suchen den Kontakt mit anderen Spezies. (Text: BR Fernsehen) Rentiere auf dünnem Eis
45 Min.Seit Jahrtausenden ziehen Nomaden mit ihren Herden durch die Tundra im arktischen Sibirien, doch die alten Wanderrouten werden durch den Klimawandel bedroht – die Rentiere bewegen sich auf dünnem Eis. Der Klimawandel hat die Nenzen und ihre Rentiere erreicht. Das riesige Gebiet am russischen Polarkreis liegt wie im Fieber. Ureinwohner und Wildtiere spüren die Folgen der Erwärmung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen, das Ausmaß und die Konsequenzen der Veränderungen zu erfassen. Ein Schlüssel zu ihrem Verständnis liegt in der tiefgefrorenen Erde Sibiriens.Dort geraten die natürlichen Fundamente ins Wanken. Riesige Krater, wie der Kessel von Batagai, öffnen sich im tauenden Permafrostboden und legen Urzeitknochen sowie Urzeitgefahren durch Viren und Bakterien frei. Unheilvolle Verkettungen der Erderwärmung: Waldböden trocknen aus und die Taiga gerät in Flammen. Die Packeisfelder vor den Küsten schmelzen und nehmen Eisbären den Lebensraum. Hungrige Bären dringen in menschliche Siedlungen vor oder wildern Kolonien der extrem seltenen Elfenbeinmöwen. Die Veränderungen in der Natur fügen sich mit den Messungen von Forscherinnen und Forschern und Beobachtungen der Ureinwohner zu einem beunruhigenden Gesamtbild: In der russischen Arktis wurde die „Büchse der Pandora“ geöffnet. „Rentiere auf dünnem Eis“ zeigt in beeindruckenden und bedrückenden Bildern bereits real existierende Auswirkungen, Phänomene und unheilvolle Verkettungen der Erderwärmung. Doch es gibt nicht nur Verlierer. Mit dem Abschmelzen des Eises wird das größte Land der Welt auch noch ein bisschen größer. (Text: BR Fernsehen) Rettet die Artenvielfalt
1,7 Millionen Bayern unterschrieben für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Zu welchen Maßnahmen für mehr Artenvielfalt sich die Politik durchringen kann, bleibt abzuwarten. Jan Kerckhoff, Julia Schade und Angelika Vogel begleiten Menschen, die in Sachen „Rettet die Artenvielfalt“ schon jetzt engagiert sind. Dieser Film zeigt das Bayern, dem Artenvielfalt, Nachhaltigkeit und Natur wichtig und wertvoll sind. Das Filmteam begleitet Menschen, die in Sachen „Rettet die Artenvielfalt“ schon jetzt engagiert sind: Eine oberbayerische Familie will ihren Garten naturnah umgestalten, ein Paar in Schwaben baut biologisch alte Gemüsesorten an und in Franken wird erforscht, welche exotischen Bäume und Energiepflanzen zukunftsweisend sein könnten.Naturnaher Garten in Oberbayern: Mit 27,7 Prozent der Berechtigten haben sich im Landkreis Starnberg in Oberbayern besonders viele Menschen für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ eingetragen. Familie Rathert beschäftigt das Thema Artenvielfalt schon länger. Vor ein paar Jahren haben sie hier im Münchner Süden neu gebaut. Besonders der Garten hat es ihnen angetan. Richtig eingewachsen soll es sein, ein bisschen wild und vor allem ein Zuhause bieten für allerlei Getier: Insekten, Vögel, Frösche und alles, was so kreucht und fleucht soll hier Nahrung und Unterschlupf finden. „Im Kleinen die Welt verbessern“ in Schwaben: Das beschreibt wohl am besten, was bei einem Paar in Augsburg ganz oben auf der Agenda steht: Tiere, Obst, Gemüse und Kräuter alles in Bioanbau bzw. artgerechter Haltung gibt es auf ihrer Anbaufläche am Rand der Schwabenmetropole. Benjamin Vogt und seine Frau Ildikó Reményi-Vogt sind die Begründer des Projekts City Farm. Sie wollen: „Lebensräume nutzen und erhalten statt sie zu zerstören!“ Deshalb bauen sie ihr eigenes Bio-Gemüse an, halten ihre eigenen Tiere und setzen auf Nachhaltigkeit. Neue Bäume braucht das Land in Unterfranken: In Veitshöchheim an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau will man herausfinden, wie sich Insekten verhalten in Bezug auf exotische versus heimische Bäume: Welche Bäume besser geeignet sind als Lebensraum, welche widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Klimaveränderungen, das erforscht die Studie „Stadtgrün – Neue Bäume braucht das Land“ für einen intakten Lebensraum in den Städten. Außerdem wollen die Forscher Lösungen finden für die größte Bedrohung für die Insekten: Monokultur in der Landwirtschaft, und zwar mit sogenannten Energiepflanzenfeldern. (Text: BR Fernsehen) Die Rettung der Pinguininsel
Südgeorgien im Südpolarmeer ist ein einzigartiger Lebensraum: Die subantarktische Insel ist Brutplatz von 50 Millionen Vögeln. Doch ein großer Teil der Vogelwelt ist dem Tode geweiht. Durch Wal- und Robbenfänger eingeschleppte Ratten räubern die Nester und töten die Jungvögel. Noch können sich die Populationen erholen, weil es letzte, durch Gletscher abgetrennte, rattenfreie Brutgebiete gibt. Doch der Klimawandel lässt das Eis schmelzen. Schon in fünf Jahren könnten die Ratten die ganze Insel bevölkern. Die von hohen Bergen und Gletschern geprägte Insel im Südpolarmeer gilt als wichtigster Paarungstreff für Pelzrobben, Seeelefanten, Seeleoparden und Seebären, und sie ist Brutplatz von 50 Millionen Vögeln, allein die größte Pinguin-Kolonie zählt 300 000 Tiere. (Text: BR Fernsehen)Die Rhön – Frühling und Sommer
45 Min.Als das „Land der offenen Fernen“ wird die Rhön gern bezeichnet, und das ist sie wie kein anderes Mittelgebirge in Deutschland. Das Biosphärenreservat beheimatet Schwarzstörche und Raben in urigen Buchenwäldern, Uhus, außerdem seltene Borstgrasrasen und bunte Bergwiesen mit Arnika und Diptam und nicht zuletzt orchideenreiche Kalkmagerrasen voller Schmetterlinge und Raritäten wie der Berghexe. Der Film folgt der Natur vom zeitigen Frühjahr bis zum Sommer. Im März findet in der Hochrhön ein einzigartiges Ereignis statt: die Balz der Birkhähne. Oft treiben zu dieser Zeit noch Schneeflocken über die Hochflächen, während in den Tälern bereits der Frühling Einzug gehalten hat.Hier unten blühen schon Märzenbecher und Küchenschelle, bauen Bläßhühner ihre Nester, summen Bienen von Blüte zu Blüte. Wenige Wochen später ist der Winter auch in den Hochlagen vertrieben, allerorts ergrünen die Wälder. In der Krone einer alten Buche krächzen bereits fast flügge Kolkrabenjunge, während wenige Meter entfernt die Küken des Schwarzstorchs gerade erst geschlüpft sind. Eine Fuchsfähe versorgt ihre fünf Welpen, in einem nahen Steinbruch warten zwei Uhujunge auf ihre Mutter. Auf den Kalkmagerrasen im Süden und Osten der Rhön blühen die Orchideen, unter ihnen Raritäten wie Frauenschuh und Bienen-Ragwurz. Hier lebt einer der seltensten Falter Mitteleuropas: die Berghexe. Über rot leuchtende Mohnfelder und wertvolle Ackerbrachen gelangt man in eine alte Kirche und erlebt, wie sich zwei Wochen alte Turmfalken eine Wühlmaus schmecken lassen. Von dort fliegt die Kamera in den nahen Streuobstgürtel des Dorfes. Hier erwachen gerade die jungen Steinkäuze. Eben erst sind sie flügge geworden und noch ein bisschen wackelig unterwegs. Einer von ihnen kann sich nur mit Glück vor den Fängen eines Fuchses retten. (Text: BR) Die Rhön – Vom Sommer zum Winter
45 Min.Als das „Land der offenen Fernen“ wird die Rhön gern bezeichnet, und das ist sie wie kein anderes Mittelgebirge in Deutschland. Das Biosphärenreservat im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen beheimatet Schwarzstörche in urigen Buchenwäldern, Kathedralen von Basaltfelsen, Moore und eiszeitliche Blockschutthalden, Uhus und Wiesenweihen, auch seltene Borstgrasrasen sowie bunte Bergwiesen mit Arnika und Türkenbund und nicht zuletzt orchideenreiche Kalkmagerrasen voller Schmetterlinge. Der Film beginnt mit der sogenannten Blattzeit, der Brunft der Rehe. Manche Bergwiesen sind bereits gemäht, andere stehen hingegen zum Schutz seltener Wiesenvögel wie Bekassine und Braunkehlchen noch unberührt da, wichtig auch für viele Pflanzen und die zahllosen stark bedrohten Insekten.Rhönschafe ziehen in traditionellen Herden über die Wiesen. Eine Ziegenschäferin treibt ihre Herde in den alten Uhu-Steinbruch, damit dieser als Lebensraum erhalten bleibt. In der Kernzone des Biosphärenreservats warten hungrige Schwarzstörche auf ihre Eltern. Unter ihnen balgen die Jungfüchse. Doch die Wälder bergen auch urtümliche Zeugen erdgeschichtlicher Vergangenheit: Basalt, mit einzigartigen eiszeitlichen Blockhalden und imposanten Prismenwänden. Auf den Feldern reift das Getreide, Lebensraum eines der seltensten Greifvögel Deutschlands, der Wiesenweihe. Ein Schutzprogramm hat den bedrohten Vogel vor allem in der Bayerischen Rhön wieder heimisch werden lassen. Nach einem kurzen farbenprächtigen Herbst treiben rasch wilde Stürme den Winter ins Land. Die Rhön, vor allem die Hochlagen, scheint zu erstarren. Doch auch diese Jahreszeit spart nicht mit Schönheiten. Wie ein zerbrechlicher Glaspalast wirkt das Schwarze Moor an einem späten Novembertag. Bald liegt hier oben mehr als ein halber Meter Schnee – für die Tiere eine karge Zeit. Rehe und Bussarde müssen sehen, wie sie satt werden, während der Fuchs dank seines guten Gehörs mit den huschenden Mäusen unter der Schneedecke eher leichtes Spiel zu haben scheint. Für die Menschen bringt der Winter willkommene Abwechslung: wunderschöne Ausblicke ins „Land der offenen Fernen“, Paragleiten, Langlauf- und Abfahrtski sowie Schneewandern sind allerorten beliebt. Und Ende Februar erscheinen trotz Schnee und Kälte wieder die ersten Frühlingsboten … (Text: BR) Der Riesenotter
45 Min.Fünf Expeditionen machen sich auf, um die Big Five Südamerikas aufzuspüren, fünf seltene und für den Kontinent charakteristische Tierarten. Dabei dringen sie in eine faszinierende, geheimnisvolle Welt weitab des Vertrauten vor. Die Expeditionsteilnehmer – Biologen und Artenschützer, einheimische Führer und ein Filmteam – beschreiten einen mühevollen Weg und lassen die letzten Siedlungen weit hinter sich. Die Expedition führt ins Dreiländereck Brasilien, Bolivien und Peru. Mit Proviant für mehrere Wochen, 300 Kilogramm Filmausrüstung und einigen Fässern Benzin macht sich das Kamerateam auf den Weg zum Manu-Nationalpark. Mit dem Boot geht es flussaufwärts ins Quellgebiet des Amazonas.Das Ziel sind die Riesenotter in den Altarmen des Rio Manu. Und tatsächlich gelingt es, eine Familie dieser kräftigen und eleganten Fischjäger aus nächster Nähe zu beobachten, und zwar sowohl bei der Aufzucht ihrer Neugeborenen als auch bei ihren Konfrontationen mit den allgegenwärtigen Kaimanen. Aus diesen Kämpfen gehen häufig ganz unerwartete Sieger hervor. Die weltweite Zerstörung der natürlichen Lebensräume von Wildtieren macht auch vor Peru nicht Halt. Geführt von Wissenschaftlern der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, gelingt es dem Filmteam, die zerstörerischen Auswirkungen der Goldgräberei im Land zu dokumentieren. Der durch den aktuellen Run auf Gold angefachte rücksichtslose Abbau des Edelmetalls wirkt sich auch auf die Lebensbedingungen der Riesenotter aus. So beobachtet die Expedition einen Solitario, einen Riesenotter, der seine Familie verlassen hat und auf der Suche nach einer neuen Heimat nicht mehr weiterzukommen scheint. Aufgehalten wird er von abgelagerten Giften, Zerstörung der Natur sowie von Menschen und ihren Hunden, die Jagd auf den Otter machen. Für das Überleben der Tiere im Tiefland von Peru wird entscheidend sein, ob es ihnen gelingt, wenn sie im Alter von zwei bis drei Jahren ihre Familie verlassen müssen, diese neuen Barrieren zu überwinden. (Text: BR Fernsehen) Romantisches Mecklenburg – Tausend Seen und ein Meer
Bis heute hat Mecklenburg nichts von seinem Charme verloren. Zwischen Elbe und Darß liegt das weite Land mit Rapsfeldern, dunklen Wäldern, alten Alleen und herrschaftlichen Gutshäusern, mit tausend Seen und einem Meer. Zwischen Elbe und Darß liegt Mecklenburg. Tiere und Pflanzen finden hier noch ausreichend Raum und Nahrung. Tierfilmer Christoph Hauschild gelingen fantastische Aufnahmen von jagenden Seeadlern und balzenden Schwarzstörchen; er blickt in die Kinderstuben von Rohrweihe, Siebenschläfer und Eisvogel. Durch den Film führt eine Gauklerfamilie. Nach alter Tradition zieht sie durch das Land, von der Müritz an die Ostsee, von den Feldberger Seen nach Schwerin. In den Dörfern machen die Schausteller Halt und spielen mit selbst geschnitzten Puppen alte Märchen.Während die Fischer hinaus auf die klaren Seen fahren, um Karpfen, Hechte und die seltenen Maränen zu fangen, lauschen die Dorfkinder begeistert den Erlebnissen vom „Fischer un sien Fru“. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Seeadler wie in Mecklenburg. Im März drehen die balzenden Paare rasante Loopings und bauen ihre gewaltigen Nester. Vor der Kamera des hoch in den Bäumen in einem Tarnzelt verborgenen Tierfilmers werden ihre Jungen allmählich größer, bis sie im Sommer ausfliegen und sich am See um die besten Happen streiten. Im Winter versammeln sich die Adler in großer Zahl an den letzten Eislöchern und stoßen hinab in Schwärme von Hunderten Blessrallen. (Text: BR Fernsehen) Die Rückkehr der Biber: Wilde Baumeister
45 Min.Gourmet: Im Sommer wagen sich Biber bei Einbruch der Dämmerung sogar in Weizenfelder vor, die in der Nähe der Gewässer liegen.Bild: BR/Doclights GmbH/NDR/Klaus Weißmann/Wilma KockDie Rückkehr der Biber ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Naturschutzes in Deutschland. Lange Zeit gejagt und nahezu ausgerottet, leben heute wieder mehr als 35.000 Biber in der Bundesrepublik – Tendenz steigend. Mehr als zwei Jahre war Klaus Weißmann den scheuen Bibern auf der Spur. Schritt für Schritt erzählt der Film „Die Rückkehr der Biber“ die spannende und teils kuriose Erfolgsgeschichte der sympathischen Nager Mittlerweile ist Deutschlands größter Nager in vielen Gebieten wieder heimisch. Doch nur selten bekommt man die meist nachtaktiven Tiere tatsächlich zu sehen.Mehr als zwei Jahre ist Klaus Weißmann den scheuen Bibern auf der Spur und dokumentiert ihre Ausbreitung in Deutschland. Ende der 1920er-Jahre waren in Deutschland nur noch 200 Biber an der Mittleren Elbe bei Dessau heimisch. Streng geschützt überlebten hier die bis zu 35 kg schweren Elbebiber. Zu dieser Zeit waren die großen Nager nahezu in ganz Europa verschwunden. Lediglich in Norwegen, Frankreich und Russland gab es weitere kleine Populationen mit wenigen Hundert Tieren. Die Jagd nach ihrem wertvollen Pelz und dem schmackhaften Fleisch dezimierten früh ihre Bestände. Auch das sogenannte „Bibergeil“, ein moschusähnliches Duftsekret, das in der Medizin als Schmerzmittel Verwendung fand, wurde den Tieren Mitte des 19. Jahrhunderts zum Verhängnis. Fast unbemerkt kehrten die Biber zurück. Die Tiere besiedelten zunächst die naturnahen Auwälder entlang der Flüsse. Während ausgewachsene Bibereltern ihrem Revier das ganze Jahr treu bleiben, müssen ältere Jungbiber auf Wanderschaft gehen und sich neue Reviere suchen. Als die besten Reviere entlang der großen Ströme besetzt waren, drängten die abwandernden Jungbiber in kleinere Flüsse, in die Hochlagen des Schwarzwalds und sogar in die von Menschen entwässerte Kulturlandschaft. Doch wo der Biber auftaucht, sorgt er vielerorts für Ärger: Die Tiere stauen Gräben oder plündern Weizenfelder. Die großen Nager ernähren sich bevorzugt von Sträuchern und Baumrinde, fällen im Herbst Bäume und bauen Dämme. Die neu angelegten Gewässer fluten oftmals Wiesen oder Keller. Wo man jedoch die Biber gewähren lässt, bringen sie die „Wildnis“ zurück: Die friedlichen Pflanzenfresser schaffen es sogar, begradigte Kanäle und intensiv genutzte Äcker zu renaturieren und wertvollen Lebensraum für sich und andere, oft seltene Tiere, zu schaffen. (Text: BR Fernsehen) Die Rückkehr – Wölfe in Bayern
Wölfe sind in Bayern auf dem Vormarsch – und sie polarisieren. Wo sind die geschützten Raubtiere unterwegs, wie breiten sie sich aus? Kann es zu unerwarteten Begegnungen kommen, und wo verlaufen die Fronten zwischen Schützern und Gegnern? Seit 2014 haben sich die ersten Wolfs-Pärchen in Bayern gefunden. Im Veldensteiner Forst ist sogar schon das erste Rudel beobachtet und gefilmt worden. Höchstwahrscheinlich werden sich die Wölfe von dort aus weiter ausbreiten. Aber mit der Zahl der Wölfe werden auch die Konflikte zunehmen. Und noch hat die Politik für viele Probleme, die die Beutegreifer mit sich bringen, keine Lösung.Sind Elektrozäune genug Schutz für Rinder und Schafe? Werden sie sich im Alpenvorland errichten lassen, insbesondere auf den steilen Hängen der Almen? Wie gefährlich oder gefährdet sind Herdenschutzhunde? Welche Maßnahmen sind nötig, damit sie zwar Wölfe von den Nutztieren fernhalten, aber nicht Spaziergänger mit Hunden angreifen? Und vor allem: Wie behalten Wölfe ihre natürliche Scheu vor dem Menschen? In Niedersachsen und den östlichen Bundesländern laufen neugierige Wölfe offenbar Joggern mit Hunden hinterher und ziehen am helllichten Tag durch Dörfer. In Deutschland dürfen sogenannte „Problemwölfe“ in letzter Konsequenz geschossen werden. Aber eine generelle, wenn auch staatlich kontrollierte Bejagung von Wölfen wäre derzeit undenkbar. Anhand der Entwicklung in Bayern besteht die Chance, die Rückkehr eines faszinierenden, aber sehr umstrittenen Wildtiers in unsere Lebenswelt mitzuerleben sowie die durchaus kontroversen Reaktionen. Das Filmteam verfolgt aus nächster Nähe die jüngsten Geschehnisse, zeigt die vielen Fragen, die diese aufwerfen, und endet mit einem „open end“ – ganz im Sinne dessen, was einer der Wissenschaftler sagt: „Die Rückkehr der Wölfe nach Bayern ist etwas Historisches.“ Historisch ist die Rückkehr nicht nur, was den Artenschutz angeht, sondern auch, wie und ob es verschiedenste Interessensgruppen schaffen werden, mit den Problemen, die der Wolf mit sich bringt, umzugehen. Noch ist nicht klar, wie viele Zugeständnisse Politik, Landwirtschaft, Jäger, Forstwirtschaft, Naturschützer, aber auch die breite Bevölkerung machen werden, um den Wolf wieder heimisch werden zu lassen. Die Rückkehr des Wolfes ist ein brisantes Projekt, bei dem viel schiefgehen kann. Sollte es gelingen, wird es ein Meilenstein für den Artenschutz sein. (Text: BR Fernsehen) Sägefische – Neptuns vergessene Kinder – Neptuns vergessene Kinder
45 Min.Über Sägefische ist kaum etwas bekannt. Denn bevor man begann sie zu erforschen, waren sie fast überall ausgerottet. Ein Biologe und ein Fischexperte begeben sich auf eine abenteuerliche Reise: Sie wollen die letzten Sägefische der Erde fangen, um sie zu züchten und so vor dem Aussterben zu retten. Obwohl sie bis zu acht Meter lang werden und ihre Säge eine der spektakulärsten Waffen im Tierreich ist, weiß man fast nichts über Sägefische. Waren sie früher in allen tropischen und subtropischen Meeren zu Hause, gibt es sie heute fast nur noch im äußersten Norden Australiens.Der Biologe Stirling Peverell und der Fischexperte Lyle Squire begeben sich auf eine abenteuerliche Reise. Sie wollen die letzten Sägefische der Erde fangen, um sie zu züchten und so vor dem Aussterben zu retten. Es ist eine Reise ins Abenteuer – denn wo die letzten Sägefische leben, jagen auch über sechs Meter lange Tigerhaie, die Seewespe, eine Quallenart, die als giftigstes Tier der Welt gehandelt wird und nicht nur das: Es sind die krokodilreichsten Strände der Erde. Doch nur hier, in einem der letzten unberührten Flecken der Erde, kann die Zukunft des Sägefisches gesichert werden. (Text: BR Fernsehen) Safari Tansania
45 Min.Elephants family on pasture in African savanna . Tanzania, Africa.Bild: Shutterstock / Shutterstock / Copyright (c) 2014 Aleksandar Todorovic/Shutterstock. No use without permission.Safari – dieses Wort versprüht Magie. Safari, das sind spannende Tierbeobachtungen in freier Wildbahn mit geheimnisvollen Lauten. Dieser Film schildert die Eindrücke und Erlebnisse einer Safari in den weltberühmten Wildschutzgebieten und Nationalparks von Tansania. Serengeti, Ngorongoro, Tarangire und Lake Manyara locken mit einer faszinierenden Tierwelt und einer einzigartigen Landschaft. Gehen Sie in diesem Film mit auf Pirschfahrt, erleben Sie einen Besuch bei den Massai und sehen Sie Tansanias komfortable Lodges mitten in der Wildnis. Kurzum, erleben Sie hautnahes Afrika-Feeling. (Text: BR Fernsehen)Sambesi – Quelle des Lebens
45 Min.Die spektakulären Viktoriafälle locken alljährlich unzählige Besucherinnen und Besucher an. Doch der Fluss, der sie speist, ist über weite Strecken nahezu unbekannt: der Sambesi. Noch nie zuvor ist der mächtige Strom so umfassend porträtiert worden wie in der zweiteiligen Naturdokumentation des österreichischen Naturfilmers Michael Schlamberger. Der Sambesi durchfließt die prächtigsten Ökosysteme des afrikanischen Kontinents und erlaubt einen Blick auf alle klassischen Tierarten. Als viertlängster Fluss Afrikas erstreckt er sich über fast 2.600 Kilometer und durchfließt sechs Staaten.Der erste Teil der Folge zeigt ihn über die ersten 1.000 Kilometer von der Quelle bis zu den Viktoriafällen. Der Sambesi beginnt seinen Weg ganz unscheinbar, versteckt im Dickicht bewaldeter Hügel im Nordwesten Sambias. Als schmales Rinnsal durchströmt er unauffällig die Grenzwälder Sambias und des Kongo. Erst in Angola öffnet sich die Landschaft an seinen Ufern. In dem dortigen Mosaik aus Savanne und Wald leben Riesen-Rappenantilopen. Sie galten lange Zeit als ausgestorben, erst 2004 wurden sie in Angola wiederentdeckt. Doch diese nur noch 250 Tiere sind die Letzten ihrer Art. Einige hundert Kilometer von seiner Quelle entfernt hat sich der Sambesi, gespeist von zahlreichen Nebenflüssen, bereits zu einem stattlichen Fluss entwickelt und kehrt in großen Kurven von Angola nach Sambia zurück. Hunderte von Büffeln, die gegen Ende der Trockenzeit anderswo weit und breit kein anderes Wasser finden, versammeln sich an seinen Ufern. Immer wenn im November schließlich am Flussoberlauf heftige Regenfälle niedergehen, schwillt der Strom gewaltig an. Dann starten etwa 200 Kilometer entfernt riesige Gnuherden zu einer der größten Tierwanderungen Afrikas. Ihr Ziel ist der vom Sambesi überschwemmte Liuwa Nationalpark in Sambia. Wenn sie dort ihren Nachwuchs zur Welt bringen, beginnt für die dort lebenden Hyänenclans eine Zeit des Überflusses. Während der Regenzeit erreicht der Fluss an manchen Stellen eine Breite von mehr als 25 Kilometern. Die Graslandschaft verwandelt sich in eine Seenplatte und lockt unzählige Vögel an. Das ansässige Volk der Losi muss seine Dörfer für viele Wochen verlassen. Etwas weiter flussabwärts vereinigt sich der Sambesi mit dem Chobe-Fluss, der einzigen ständigen Wasserquelle in einer sonst völlig ausgedörrten Landschaft. Bis zu 120.000 Elefanten kommen hier zusammen – mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Weiter Richtung Osten verlässt der Sambesi das flache, offene Land und erreicht eine Landschaft, in der er sich in ein aufgewühltes Wildwasser verwandelt. Mehr als einhundert Meter stürzt es über die Viktoriafälle in die Tiefe. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Abenteuer Wildnis und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail