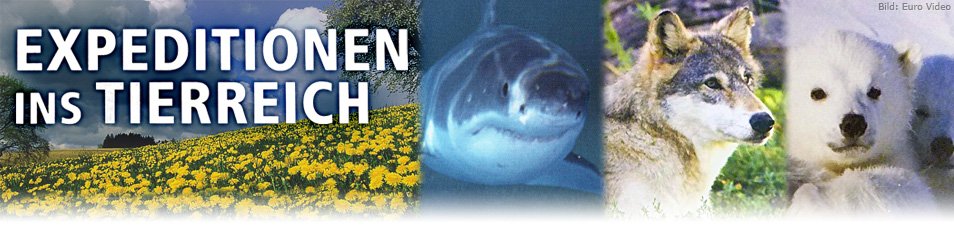unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 11)
Unsere Meere: Naturwunder Ostsee
45 Min.„Unsere Meere“ ist eine atemberaubende, vierteilige Serie über die Nord- und Ostsee. Über zwei Jahre lang porträtierte der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend mit neuester Drohnen- und Unterwassertechnik sowie Satellitenbildern die beiden Meere. So entstanden intime Einblicke in das Leben seltener Tiere, manche Verhaltensweise wurde bisher noch nie gefilmt. Die dritte Folge „Naturwunder Ostsee“ führt zur größten Seehundkolonie der Ostsee auf die dänische Insel Anholt. Im kristallklaren Wasser bekommen die Jungtiere Schwimmunterricht.Dank der extrem fetthaltigen Milch, mit der sie ernährt werden, wachsen sie schnell. Schon nach vier Wochen werden sie von ihren Müttern verlassen. Allein auf sich gestellt erkunden sie neugierig die Welt. Auf Schwedens größter Insel lebt die seltene Gotland-Ringelnatter. Sie jagt im Meer nach Fischen. Das ist einzigartig: Kein anderes Reptil geht in der Ostsee auf Nahrungssuche. Ein Verhalten, das zuvor noch nie gefilmt wurde. Der Kleine Belt ist die Heimat eines Hummers. Dass dieser Pionier hier vorkommt, ist eine Sensation. Auf der Suche nach einer Bleibe muss der Hummer manche Hürde meistern. Das Leben der Seehasen ist auch nicht einfach. Im Winter kommen die Fische an die Küste Mecklenburgs. Nachdem die Weibchen ihre Eier gelegt haben, überlassen sie ihrem Partner die Brutpflege. Die Herausforderungen für den Vater sind zahllos: Ständig muss sein Nachwuchs mit sauerstoffreichem Wasser versorgt, vor Räubern wie Seesternen und Strandkrabben geschützt und vor Stürmen bewahrt werden. Das Seehasenmännchen gibt alles, doch wird das am Ende reichen? (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 04.12.2024 NDR Unsere Meere: Unbekannte Nordsee
45 Min.Für die atemberaubende vierteilige Serie „Unsere Meere“ porträtierte der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend über zwei Jahre lang mit neuester Drohnen- und Unterwassertechnik sowie Satellitenbildern die beiden Meere Nordsee und Ostsee. So entstanden intime Einblicke in das Leben seltener Tiere- Manche Verhaltensweise wurde bisher noch nie gefilmt. In der zweiten Folge „Unbekannte Nordsee“ wird die außergewöhnliche Jagdtaktik von Delfinen vor der Küste Schottlands gezeigt. Sie machen sich die starke Gezeitenströmung des Moray Firth zunutze und geben dieses Wissen an ihren Nachwuchs weiter.Ihre Beute sind große Lachse, doch sie werden immer seltener. Die Großen Tümmler haben sich an die Veränderung angepasst, aber das gelingt nicht allen. Die Raubmöwen auf Fair Isle jagen normalerweise anderen Seevögeln ihre Beute ab. Durch die Überfischung der Nordsee wird diese aber immer spärlicher. Um das Überleben ihrer Küken zu sichern, mussten sich die Raubmöwen umstellen. So gerieten die Papageitaucher in ihr Visier. Die Basstölpel auf Helgoland kämpfen mit anderen Problemen. Für den Nestbau verwenden sie immer öfter Überreste von Fischernetzen. Viele der Vögel strangulieren sich, die roten Felsen werden immer öfter zur Todesfalle. Es gibt aber auch positive Entwicklungen: Fischotter waren einst in ganz Großbritannien vom Aussterben bedroht, die Shetlandinseln waren einer ihrer letzten Zufluchtsorte. Mittlerweile erleben die agilen Wassermarder ein Comeback. Der Film folgt einem jungen Weibchen, das zum ersten Mal auf die Jagd geht: in den Wellen der Nordsee. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 27.11.2024 NDR Unsere Meere: Unbekannte Ostsee
45 Min.Für die vierteilige Serie „Unsere Meere“ porträtierte der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend über zwei Jahre lang mit neuester Drohnen- und Unterwassertechnik sowie Satellitenbildern die Nord- und Ostsee. Entstanden sind intime Einblicke in das Leben seltener Tiere, manche Verhaltensweise wurden bisher zuvor noch nie gefilmt. In der Folge „Unbekannte Ostsee“ geht es nach Estland. Hier leiden Kegelrobben zunehmend unter der Klimaerwärmung. Früher kamen die Jungen im späten Winter auf dem Eis der Ostsee zur Welt.Nun gebären die Mütter ihre Babys dicht gedrängt auf kleinen Inseln. Angesichts der hohen Temperaturen droht ihnen ein Hitzschlag. Wie werden die Kegelrobben das Problem lösen? Einer ganz anderen Herausforderung müssen sich die Eiderenten auf der dänischen Gruppe der Erbseninseln (Ertholomene) stellen. Die Hauptnahrung der Entenvögel, die Miesmuschel, wird aufgrund steigender Wassertemperaturen immer kleiner. Bereits geschwächt beginnen die Eiderenten ihre Brutsaison, müssen aber ständig hungrige Möwen in Schach halten, die es auf ihre Küken abgesehen haben. Auch die Meerforellen auf der Nachbarinsel Bornholm stehen vor einem Problem: Zum Laichen müssen sie in die Bäche ihrer Geburt aufsteigen. Nun ist die Mündung aber durch eine Sandbank blockiert. Nur ein Sturm mit starker Brandung könnte den Weg frei machen. Weiter östlich bildet im finnischen Schärengarten Seegras eine „Unterwasser-Savanne“. Ideale Bedingungen für Grasnadeln. Die außergewöhnlichen Fische sind Meister der Tarnung und lassen die Zuschauerinnen und Zuschauer an ihrem einmaligen Paarungsspiel teilhaben. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 11.12.2024 NDR Unsere Wälder – Netzwerk der Tiere – Folge 1
45 Min.Der Wald ist ein magischer Ort, der nur langsam seine Geheimnisse preisgibt. Eine Art Superorganismus, mit einem faszinierenden Zusammenspiel von Pflanzen, Pilzen und Tieren. In der ersten Folge seiner zweiteiligen Dokumentation „Unsere Wälder“ berichtet der vielfach preisgekrönte Naturfilmer Jan Haft von den erstaunlichen Verbindungen der Lebewesen im Wald, von hauchzarten Pilzen, die sich von Nadelbaumzapfen ernähren, hungrigen Käfern mit giftigem Biss, magischen Lichtern, die durch die Nacht tanzen, oder den imposanten Kämpfen der Wildschweinkeiler. Kein Wald gleicht dem anderen. Je nach regionalem Klima und Bodenbeschaffenheit herrschen unterschiedliche Pflanzen vor, die ihrerseits großen Einfluss auf die Tierwelt haben.Im Frühjahr etwa ertönt im Inneren der Bäume ein merkwürdiges Rauschen und Gluckern. Die Sonne hat Zucker in den Wurzeln und Stämmen aktiviert. Als süßer Saft steigt er im Inneren der Bäume empor und versorgt Vögel, Insekten und viele andere mit wertvoller Energie. Die Hochglanzdokumentation schildert die erstaunlichen Verbindungen zwischen den Lebewesen in den heimischen Wäldern, beleuchtet das gewaltige Netzwerk der kleinen und großen Arten. Denn „Unsere Wälder“ sind keineswegs nur das Reich der Bäume, sondern auch ein spannendes Netzwerk der Tiere. (Text: NDR) Unter Afrikas Affen – Das Abenteuer
Vor der Küste Zentralafrikas liegt eine geheimnisvolle Insel im Atlantik: Bioko. Bedeckt von dichten Regenwäldern ist sie die Heimat für eine der seltensten Affenarten der Welt. Bisher gab es noch keinen Film über die vom Aussterben bedrohten Tiere: Drills- dies ist das erste intime Porträt und zeigt erstmals ihren Lebensraum, der zu den artenreichsten der Erde zählt. Für die Tierfilmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg und ihr Team sollte es zu einem wahren Höllenritt werden. Drohnen stürzen im Dschungel ab, hartnäckige Tropenkrankheiten stellen selbst erfahrene Mediziner vor Rätsel, und die Drills kommen den Filmern nicht nur einmal gefährlich nah.Aber die Strapazen lohnen sich in vielerlei Hinsicht. Die Küste der Insel ist jedes Jahr das Ziel zahlloser Meeresschildkröten, die hier ihre Eier ablegen. Dem internationalen Team gelingen einzigartige Aufnahmen sowohl von der Eiablage als auch von den lebensgefährlichen ersten Schritten der kleinen Schildkröten, kurz nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind. Im Inneren von Bioko ragen die steilen Wände einer uralten Caldera in den Himmel. Das Innere dieses erloschenen Vulkans haben wahrscheinlich weniger Menschen betreten als den Mond. Für Oliver Goetzl und sein Team eine waghalsige mehrtägige Kletterpartie. In der Caldera angekommen gelingen ihnen nicht nur weitere Aufnahmen der Drills, sondern auch erste Bilder von Schwarzen Stummelaffen, einer Primatenart, die noch seltener und schwieriger zu filmen ist. Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg – Preisträger des Wildscreen Animal Behavior Awards – haben sich der Herausforderung dieses extremen Drehorts gestellt. Sie sind die Spezialisten für besonders schwer zu filmende Tiere wie Vielfraße, Lippenbären oder Polarwölfe. Unterstützt wird das Duo vom Drill-Experten Justin Jay. 2010 gelingen dem amerikanischen Biologen erste Aufnahmen der Affen in freier Wildbahn. Seitdem erforscht er intensiv Biokos Primaten. Oliver und Ivos Knowhow hinter der Kamera in Kombination mit dem detaillierten Wissen des Affen-Forschers Justin Jay waren die besten Voraussetzungen für den Dreh. So entstand das erste und einzige Porträt über das heimliche Leben der Dschungel-Könige in einem ihrer letzten Refugien. (Text: hr-fernsehen) Unter Raubkatzen und Ameisenbären – Mit Lydia Möcklinghoff in Brasiliens Tierwelt
45 Min.Mitten im Pantanal, dem größten Feuchtgebiet der Erde, ist die Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff den Geheimnissen der Großen Ameisenbären auf der Spur. Die Dynamik von Hochwasser und Trockenzeit lässt ein einzigartiges Mosaik aus Flüssen, Seen, Sümpfen, Galeriewäldern und Pampa entstehen. Weit ab von großen Städten liegen vereinzelt Farmen in der Wildnis wie die Fazenda Barranco Alto. Hier forscht Lydia Möcklinghoff.Mit dem Pferd oder Kanu kommt sie auch an schwer erreichbare Orte, um Kamerafallen aufzustellen. Auf ihrem Weg begegnen ihr Riesenotter, Jaguare, Pumas, Hyazintharas und natürlich Große Ameisenbären.Einige von ihnen kennt sie schon seit Jahren. Sie sind für sie wie alte Bekannte.Gerade im Pantanal kann man den großen Erfolg von Artenschutzprojekten tagtäglich erleben. Viele Säugetiere und exotische Vögel waren im vergangenen Jahrhundert nahezu ausgerottet. Doch nur was man kennt, kann man schützen. Deshalb sind Lydia und viele andere Biologen weiterhin im Pantanal unterwegs, um den Arten des südamerikanischen Kontinents eine sichere Zukunft zu bieten. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 03.11.2021 NDR Die verrückte Welt der Hörnchen
45 Min.Hörnchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Tieren. Überall auf der Welt sind sie zu sehen. Sie begleiten die Menschen auf Spaziergängen im Park oder im Wald, fordern ihren Anteil am Picknick und amüsieren mit ihren akrobatischen Kletterkünsten. Die Hörnchen haben mittlerweile fast alle Lebensräume der Erde besiedelt, man begegnet ihnen in Städten, im Wald, in Wüsten, in den Bergen und im hohen Norden. Die Eichhörnchen und ihre Artverwandten sind heutzutage nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Der Film erzählt spannende und unterhaltsame Geschichten aus der Welt eines der populärsten Säugetiere des Planeten Erde. Manche Hörnchen können fliegen, viele leben am Boden oder in Bäumen, einige bevorzugen die Kälte oder die Hitze.Ob Jung oder Alt, es gibt kaum einen Menschen, der sich dem Charme eines drollig dreinschauenden Hörnchens mit vollen Backen entziehen kann. Die Vielfalt im Reich der Hörnchen ist faszinierend und beeindruckend zugleich. Dieser Naturfilm entführt in die faszinierende Welt dieser kleinen Wesen und zeigt in unterhaltsamen Geschichten, wie sie sich auf der ganzen Welt so erfolgreich behaupten konnten. Er enthüllt die zauberhafte Welt der Hörnchen und bringt eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung und Faszination auf den Bildschirm. (Text: NDR) Die verrückte Welt der Tintenfische – Die Welt der Kopffüßer
45 Min.In den Tiefen der Meere lebt eine Gruppe von Tieren mit unglaublichen Fähigkeiten. Knochenlose Kreaturen, die Farbe und Form verändern können. Saugnäpfe machen sie zu effizienten Jägern: Tintenfische. So unterschiedlich wie ihre Fähigkeiten, ist auch die Tiergruppe selbst: Oktopusse sind achtarmige Alleskönner und Sepien die Chamäleons der Meere. Sie haben zwei weitere Tentakel, die sie entfalten können, um Beute zu machen. Genauso wie Kalmare. Sie haben besonders große Augen, mit denen sie sogar in der Tiefsee leben können. Was alle vereint: Sie sind intelligent, anpassungsfähig und haben seit Millionen von Jahren die Ozeane der Welt erobert.Vor der Küste Brasiliens leben besonders räuberische Kraken, die bei der Jagd auf Krabben sogar an die Oberfläche kommen. Bei Ebbe lauern sie ihrer Leibspeise im seichten Wasser auf, eine beeindruckende Leistung für eine verwandte Art von Muscheln und Schnecken! In der Tiefsee lauern skurrile Tiere wie der Vampirtintenfisch. So gruselig sein Name auch klingt, er ernährt sich ausschließlich von zerfallenden organischen Stoffen im Wasser und ist daher eher so etwas wie die „Müllabfuhr“ der Meere. Riffkalmare sind Rekordbrecher im Tierreich: Sie kommunizieren, indem sie mehrmals pro Sekunde die Farbe wechseln können. Sie haben noch einen weiteren Trick in petto: Mit der einen Körperhälfte drohen sie ihren Konkurrenten und mit der anderen locken sie Weibchen an. Der Mimik-Oktopus hat eine ganz eigene Methode, seinen Feinden aus dem Weg zu gehen. Er kann nicht nur Farbe und Form verändern, er ahmt sogar das Verhalten anderer Tiere nach. Von der Seeschlange bis zum Feuerfisch, bis zu 15 verschiedene Tierarten hat er im Repertoire, wenn er sie einmal genau beobachtet hat. Im Nordwesten der USA ist Meeresbiologe und Tierfilmer Florian Graner einem besonderen Tintenfisch auf den Fersen: dem Pazifischen Riesenkraken, dem größten Oktopus der Erde! Dank seiner langjährigen Erfahrung mit Tintenfischen, weiß Florian Graner, wo er nach dieser Tintenfischart suchen muss. Doch was passiert, wenn Mensch und dieses fremde Tier aufeinandertreffen? Oktopusse, Sepien, Kalmare und unheimliche Tiefseebewohner: Keine Tiergruppe ist so außergewöhnlich wie die der Tintenfische! (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 29.09.2021 NDR Vietnams geheimnisvoller Norden – Im Reich der Bergwälder
45 Min.Vietnam gehört zu einem der artenreichsten Länder der Erde, und doch ist über das Leben vieler Tiere dort bisher wenig bekannt. Viele leben nur an einem einzigen Ort. Jährlich werden Dutzende Arten neu entdeckt. Dieser Naturfilm zeigt neben den weltberühmten Kalksteinformationen der Halong-Bucht, der pulsierenden Hauptstadt Hanoi und dem dichten Dschungel-Nationalparks einige bisher nie gefilmte Arten und Verhaltensweisen und erklärt, warum das Land ein Hotspot der Biodiversität ist. Ein Drittel aller Tiere Vietnams gibt es nur in diesem Land, sonst nirgendwo auf der Welt. Und immer wieder werden neue Arten entdeckt! Allein 90 neue Reptilienarten wurden in den letzten zwei Jahrzehnten beschrieben.Viele der Tiere leben allerdings nur an einem einzigen, eng begrenzten Ort. Um diese zu erreichen, waren einige aufwendige Expeditionen nötig. Lange Fußmärsche in die entlegensten Winkel der Bergregenwälder Nordvietnams und zahlreiche Stunden auf wackeligen Booten brachten das Kamerateam immer wieder an ihre Grenzen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, denn es sind einzigartige Aufnahmen entstanden, unter anderem von dem scheuen Fleckenroller oder der vom Aussterben bedrohten Krokodilschwanzechse. Ein besonderes Augenmerk legten die Filmemacher jedoch auf das Pangolin, ein Schuppentier. Diese Gattung ist das meistgewilderte Tier der Welt. Um deren Schicksal zu dokumentieren, suchte das Team nach einer Möglichkeit, Schuppentiere in Freiheit, aber auch in Gefangenschaft begleiten zu können. Schließlich stießen die Filmer auf die Organisation Save Vietnam’s Wildlife. Der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit. Es sind Aufnahmen entstanden, die zuvor so noch nie zu sehen waren, wie zum Beispiel die ersten Schritte eines frisch geborenen Pangolin-Babys. Welche Abenteuer das kleine Pangolin erlebt, was ein Fleckenroller mit Kaffee zu tun hat und warum Cat-BaLanguren nur auf einer einzigen Insel leben, das zeigt diese neue Universum-Dokumentation. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 04.09.2024 NDR Vietnams tropischer Süden – Im Reich des Wassers
45 Min.Im Süden Vietnams herrscht tropisches Klima mit deutlich üppigerer Vegetation als im Norden. Im Vietnam-Krieg wurde jedoch ein Großteil der Natur zerstört. Weite Teile Südvietnams wurden von den US-amerikanischen Truppen mit dem Entlaubungsmittel Agent Orange besprüht, um den Vietcongs die Tarnung durch den dichten Dschungel zu nehmen. Mittlerweile haben sich Pflanzen und Tiere ihr Reich zurückerobert. Die zweite Folge „Wildes Vietnam“ zeigt einige dieser Erfolgsgeschichten. Überquert man den Wolkenpass in der Mitte Vietnams, ist es, als betrete man ein anderes Land.Während im Norden raues, kühles Klima herrscht, ist der Süden ganzjährig tropisch warm. Unweit der Millionenstadt Ho-Chi-Minh City liegt ein letztes kleines Paradies. Umringt von landwirtschaftlichen Flächen schützt der Cat Tien Nationalpark den letzten intakten Flachlandregenwald Vietnams. Hier folgte das Team einer der verbliebenen 300 Südlichen Gelbwangen-Schopfgibbon-Familien in Vietnam. Es sind faszinierende Verhaltensstudien dieser seltenen Primaten gelungen, die zu den Hauptdarstellern des Films werden. Reist man vom Cat Tien Regenwald noch tiefer in den Süden Vietnams, trifft man unweigerlich auf Wasser. Der Mekong ist die Lebensader Südvietnams, alles fließt, gleitet und tuckert auf dem Fluss, dem „neunarmigen Drachen“, wie die Einheimischen ihn nennen. Das Mekongdelta ist das drittgrößte der Erde und war einst eine endlose Wasserwildnis. Heute wird hier mehrmals im Jahr Reis geerntet. Und auf den unzähligen Wasserwegen treiben die Vietnamesen regen Handel. Natürliche Gebiete gibt es kaum noch. In einem kleinen Schutzgebiet trafen die Kameraleute auf zwei junge Zwergotter, die im Wald eher unerwartete Beute jagten. Darüber hinaus erzählt der Naturfilm die Erfolgsgeschichte der seltenen Siam-Krokodile, die bereits als ausgestorben galten und nun dank strenger Schutzmaßnahmen die Feuchtgebiete am Mekong zurückerobern. Doch nicht immer gibt es schöne Geschichten zu erzählen. Der illegale Wildtierhandel ist ein großes Problem in Vietnam, selbst in den Nationalparks werden die Tiere illegal bejagt. Und damit nicht genug. Der Tourismus explodiert förmlich in Vietnam. Jedes Jahr werden neue Übernachtungsrekorde gemeldet. Überall im Land weichen Naturräume neuen Hotels und Straßen. So stehen die Tiere im tropischen Süden Vietnams vor großen Herausforderungen. Wie sie diese meistern, welche Tiere den Kampf verlieren könnten und welche Comebacks sich im Reich des Wassers abspielen, erzählt die letzte Folge des spektakulären Zweiteilers „Wildes Vietnam“. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 04.09.2024 NDR Die Viktoriafälle – Afrikas Garten Eden
45 Min.Schon aus 30 Kilometer Entfernung kann man es sehen: Wie bei einem brodelnden Vulkan erhebt sich eine glutrote Wolke aus der Erde. So erlebt man die Viktoriafälle bei Sonnenaufgang. „Der Rauch der donnert“, nennen ihn deshalb die Einheimischen. Der Wasserfall im Herzen Afrikas stürzt über eine Breite von fast zwei Kilometern über mehr als 100 Meter in die Tiefe. 1855 entdeckt David Livingstone die Fälle. Tief beeindruckt beschrieb er den Wasserfall „als das Schönste, das er je in Afrika zu Gesicht bekam“. Er benennt sie darauf hin nach seiner Königin.Tatsächlich sind die Fälle noch heute ein Naturschauspiel, das seines gleichen sucht. Gegenüber den Wasserfällen existiert ein Miniaturregenwald. Entstanden nur durch die lebenspendende Gischtwolke der Victoriafälle. Jenseits dieser Wälder ist das Land trocken und geht fast nahtlos in die Savanne über. Gerade in der Trockenzeit beginnt daher eine ungewöhnliche Migration: Elefantenfamilien kommen aus dem 100 km entfernten Hwange Nationalpark hierher. Während in ihrer Heimat alles vertrocknet ist, gibt es oberhalb der Fälle eine Vielzahl von immergrünen Inseln: kleine Oasen in denen die Elefanten die Zeit der Dürre verbringen. Mehrmals pro Woche müssen sie die Insel wechseln, sonst wären diese schnell leergefressen. Dann kommt es zu einem wundervollen Spektakel: Überall schwimmen die Elefanten wie an einer Perlenschnur durch den Sambesi. Aber nicht nur die Elefanten unterliegen dem ständigen Wandel zwischen Trocken- und Regenzeit. Marabus und Paviane sind besonders betroffen. In der Trockenzeit geht es für sie um Leben und Tod. Nur durch ungewöhnliche Strategien haben dann eine Chance zu überleben. (Text: NDR) Vom Harz bis zur Nordsee – Die Rückkehr der Lachse
45 Min.Einst war der Lachs in den großen Strömen Rhein, Elbe und Weser weit verbreitet, starb dann aber in den meisten Flüssen Deutschlands aus. Zu hohe Wehre und die Zerstörung naturnaher Bäche und Flüsse verhinderten den sprungfreudigen Wanderfischen endgültig die Rückkehr in ihre angestammten Laichgebiete. Doch nicht alle Menschen haben sich damit abgefunden. Viele Naturfreunde träumen von der Wiederkehr der Lachse in heimische Gewässer und kämpfen für die Renaturierung von Bächen und Flüssen. Mehrere Tausend Lachse wurden in den letzten Jahren in Bächen ausgesetzt.Der Film folgt den Junglachsen auf ihrem abenteuerlichen Weg durch einige der schönsten Landschaften Niedersachsens. Doch ihre Reise ist gefährlich: Wehre, Turbinen, Fischernetze und natürliche Feinde wie Fischotter und Kormoran machen den kleinen Lachsen das Leben schwer. In eindrucksvollen Bildern porträtiert der Film nebenbei die wunderbare Tier- und Naturwelt Niedersachsens, die entlang der Flüsse zu entdecken ist. Hier leben noch Wildkatze, Fischotter oder Waschbär. Fischfreunde warten gespannt auf den ersten Rückkehrer. Wann wird es der erste Lachs schaffen? (Text: NDR) Vom Harz zur Nordsee – Die Rückkehr der Lachse
Von der Quelle bis zur Weser – Die Geheimnisse der Hunte
45 Min.Die Hunte im Westen Niedersachsens hat viele Gesichter. Kein anderer Fluss des Landes fließt durch so viele unterschiedliche Lebensräume. Zwei Jahre lang begleiteten die Naturfilmer Svenja und Ralph Schieke den Fluss und seine wilden Bewohner mit der Kamera. Mithilfe von Drohnen, Zeitlupenkameras, Teleobjektiven, extremen Nahaufnahmen und Zeitraffern ist ein eindrucksvolles Porträt dieser niedersächsischen Flusslandschaft entstanden. Auf ihrem Weg von Melle im Wiehengebirge im Südwesten von Niedersachsen bis nach Elsfleth an der Weser strömt das Wasser der Hunte zunächst als kleiner Bach in die norddeutsche Tiefebene.Im kalten, klaren Wasser leben Bachflohkrebse, von denen sich die Larven der Feuersalamander ernähren. Nur wenige Kilometer hinter den Bergen fließt die Hunte durch saftige Wiesen, auf denen sich Feldhasen wilde Verfolgungsjagden bei der Balz liefern. Eines der Highlights der Flussreise sind die weiten Feuchtwiesen und Niedermoore am Dümmer, Niedersachsens zweitgrößtem See. Hier leben Scharen von Gänsen und seltenen Wiesenvögeln, die das Gebiet zu einem der wertvollsten Lebensräume in Europa machen. Besonders die langbeinige Uferschnepfe hat sich hier enorm vermehrt. Gleich hinter dem Dümmer schließen sich einige der größten Moorgebiete Deutschlands an, in denen mittlerweile auch Wölfe ihre Welpen großziehen. Nach den Mooren fließt die Hunte weiter in die Wildeshauser Geest, mit 1500 Quadratkilometern einer der größten Naturparks in Deutschland. In den Sandgruben der trockenen Geest haben scheue Uhus und bunte Bienenfresser ein neues Zuhause gefunden. Wo Heideflächen auf dem Sand wachsen, jagen seltene Bienenwölfe Honigbienen. Zwischen Wildeshausen und Oldenburg wird die Hunte dann auch als Flusslauf richtig wild: In weiten Schleifen fließt sie durch Waldgebiete mit mächtigen Baumriesen. Nach Oldenburg erreicht die Hunte dann das Marschland. Gerade im Herbst sind die saftigen Wiesen der Anziehungspunkt für Tausende von nordischen Gänsen. Schließlich mündet die Hunte nach knapp 190 Kilometern quer durchs wilde Niedersachsen in die Weser. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 12.02.2025 NDR Vorpommerns Auen – Schreiadler und Biber
45 Min.Vorpommerns Küste zieht jährlich Millionen Besucher*innen in die Region. Bekannt sind die Kreidefelsen von Rügen, der Leuchtturm von Hiddensee, auch die faszinierende Landschaft des Darß. Dahinter liegen Vorpommerns Auen, eine verborgene Wasserwelt mit Flüssen, Niedermooren und Wiesen und einer reichen Tierwelt. In den unzugänglichen Flusstälern Vorpommerns hat der Schreiadler, die seltenste Adlerart in Deutschland, überlebt. Nur 100 Paare davon leben noch in Deutschland, 80 Prozent der Exemplare in Vorpommern. Jedes Jahr ziehen die Letzten ihrer Art aus den Winterquartieren in Afrika zurück nach Vorpommern.Eine intensive Landwirtschaft und der immer weiter steigende Bedarf an Holz nehmen ihnen die Lebensgrundlage. Wie kein anderer Landkreis trägt Vorpommern die Verantwortung für das Überleben der Schreiadler. Der Anfang ist gemacht. Umfangreiche Renaturierungen entlang der Flüsse lassen Niedermoore wieder wachsen und geben auch anderen Tieren eine Heimat. Der Film porträtiert das Leben der Schreiadler in den Flusstälern Vorpommerns. Eindrücklich zeigt er, mit welchen Problemen er in Deutschland nach seiner Rückkehr aus Afrika zu tun hat. Futtermangel ist das größte Problem. Das Filmteam startet ein Experiment. In Absprache mit den Schreiadler-Experten vor Ort wollen sie versuchen, ein Adlerpaar mit Futter zu unterstützen. Wird der Nahrungsspezialist die Fütterung annehmen? Mit der Ausweisung des Naturparks Flusslandschaft Peenetal beginnen umfangreiche Renaturierungsvorhaben entlang der Flüsse. Es gilt, die entwässerten Niedermoore wieder zu vernässen und so das Wachstum der Moore anzuregen. Große Flachseen sind dort entstanden, wo der Moorkörper schon fast verschwunden war. Hier siedelten sich Sumpfschwalben wie die Weißbartseeschwalbe an. Kranich und Fischotter ziehen hier ihre Jungen groß. Im Dickicht der Weiden bauen Biber ihre Burgen und ziehen ihren Nachwuchs auf. Der Film fasziniert und überrascht mit Einblicken aus dem Inneren einer Biberburg. Aus der Luft betrachtet wird klar, wie abwechslungsreich Vorpommerns Auen sind. Im Tal der Hirsche lebt das größte Landsäugetier Deutschlands. Beeindruckend sind die Aufnahmen aus dem Helikopter, wenn 100 Hirsche über die Wiese laufen oder Kraniche zu ihren Schlafplätzen einfliegen. (Text: NDR) Das wahre Dschungelbuch
45 Min.Rudyard Kiplings Klassiker „Das Dschungelbuch“ von 1894 spielt in einem verträumten fiktiven Indien. Doch die Tiere, über die Kipling schrieb, die gibt es heute noch. Nur mit einem Unterschied: die Herausforderungen und die Kämpfe, die sie überstehen müssen, aber auch die Gesetze des Dschungels – nämlich jene, die Kipling sich ausgedacht hat – haben sich im heutigen, modernen Indien gewandelt. Obwohl alles frei erfunden ist, basiert die Geschichte auf Fakten. (Text: NDR)Wale – Clevere Giganten
45 Min.Rick Rosenthal filmt eine Gruppe männlicher Pottwale. Pottwale leben das Matriarchat, erreichen junge Bullen die Geschlechtsreife, verlassen sie ihre Familie und schließen sich einer ‚Männerrunde‘ an.Bild: NDR/doclights/TMFS/Wild Logic/Kai BensonSie sind die größten Tiere, die die Erde bevölkern, schwebende Giganten im Ozean: Wale. Doch der Mensch weiß nahezu nichts über das, was sie in ihrem Innern bewegt. Erst ganz allmählich kommen Wissenschaftler den hohen Intelligenzleistungen der Wale auf die Spur. Pottwale zum Beispiel besitzen das größte Gehirn überhaupt, doch wozu genau setzen sie es ein? Auch Meeresbiologe und Naturfilmer Rick Rosenthal taucht seit Jahrzehnten mit Walen, seine Erfahrungen zeigen ihm deutlich: Wale sind nicht nur clever, sie reagieren auch emotional.Rick Rosenthal bricht auf zu einer besonderen Reise: von Alaska über Mexiko zu den klaren Gewässern vor den Cook Islands, nach Norwegen, zu den Falklandinseln und Azoren. Ob unter Wasser oder mithilfe einzigartiger Flugaufnahmen, er ist immer auf der Suche nach neuesten Erkenntnissen darüber, wie clever Wale wirklich sind. Bereits im Anflug auf die felsige Küste Alaskas entdeckt Rick Rosenthal aus dem Flugzeug ein einsames Buckelwalweibchen, das in extrem flachem Wasser schwimmt. Es macht dem Besitzer einer Zuchtfarm für Lachse das Leben schwer. Denn während Buckelwale normalerweise kein Interesse an jungen Lachsen haben, ist dieses Weibchen auf den Geschmack gekommen: Seit Jahren taucht es genau dann auf, wenn die kleinen Lachse in der Bucht freigelassen werden. Routiniert zirkelt das Walweibchen die Fische ein, erledigt Tausende in nur wenigen Sekunden. Dieses Kalkül und diese Präzision faszinieren selbst Wissenschaftler. In diesem Jahr übertrifft das Walweibchen allerdings alle Erwartungen. Orcas sind berühmt dafür, erfolgreich im Team zu jagen. In den eisigen Gewässern Norwegens erlebt Rick, wie routiniert die Schwertwale Sardinen in die Enge treiben. Gemeinsam kesseln sie ganze Schwärme ein, drängen sie gegen die Fjordküste und können es sich sogar leisten, wählerisch zu sein: Das Nahrungsangebot ist derart üppig, dass die Orcas hier nur die „Filestücke“ ihrer Beute fressen, Fischkopf und -flossen bleiben übrig. In der Baja California vor Mexiko herrscht dagegen Nahrungsknappheit. Dort müssen Orcas wehrhafte Beute erlegen, um überleben zu können: Im Zweierteam machen die Schwertwale Jagd auf giftige Stachelrochen. Erstmals gelingen Rick Filmaufnahmen, die zeigen, wie sie Stachelrochen brutal und extrem effizient „entwaffnen“. Dabei haben die mächtigen „Killerwale“ auch eine ganz andere, äußerst emotionale Seite, wie Rick auf den Falklandinseln erlebt. Vor den Cook Islands wird Rick selber zum „Kulturforscher“ der Wale: Bei einem seiner Tauchgänge im kristallklaren Wasser lauscht er den Liedern zweier männlicher Buckelwale. Die beiden Gesänge unterscheiden sich zunächst, doch nach einer Weile beginnt Rick, Ähnlichkeiten herauszuhören. Die weltbekannte Buckelwalforscherin Nan Hauser hilft Rick zu verstehen, was er in diesem Moment „live“ hört: Die beiden Buckelwale lernen Strophen voneinander und übernehmen das Gehörte in ihr eigenes Lied. Auf diese Weise transferieren die Männchen Informationen, die über Tausende Kilometer weitergegeben werden. Sie kreieren sogar eigene Sommer-Hits, die im Südpazifik kursieren. Für die Forscher ein Beweis von Kultur unter Walen, für Rick darüber hinaus ein äußerst bewegender Moment auf seiner über zwei Jahre andauernden Reise. Bei all seinen Begegnungen mit Schwert- und Buckelwalen, Grau- und Pottwalen erlauben die großen Meeressäuger intime Einblicke in ihr Leben, mit Neugier und Respekt begegnen sich beide Seiten. Nach seiner Reise ist Rick Rosenthal sich einer Sache wirklich sicher: Mit jeder neuen Erkenntnis über Wale stellen sich weitere spannende Fragen. Die cleveren Giganten haben längst noch nicht alle ihre Geheimnisse preisgegeben. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 20.11.2019 NDR Wales – Großbritanniens wilder Westen
45 Min.Wales ist der kleinste Landesteil Großbritanniens und steckt voller Mythen und Legenden. Schroffe Gebirge im Norden, sanfte Hügellandschaften im Süden und raue Klippen entlang der Küste. Eine Region der Gegensätze. So hat sich auch J. R. R. Tolkien für seine weltberühmte Trilogie „Der Herr der Ringe“ von der Landschaft inspirieren lassen. Im Norden von Wales liegt Snowdonia, eine Berglandschaft mit spektakulärer Kulisse: Wildziegen tragen im Herbst heftige Brunftkämpfe aus. Ihre enge Verwandtschaft mit Steinböcken wird dabei offensichtlich.Im Süden von Wales liegt die Region der Brecon Beacons: Die Hügellandschaften erinnern stark an das vom J. R. R. Tolkien beschriebene Auenland und sind auch die ideengebende Region dafür. Während hier in den niederen Lagen Füchse ihren lebhaften Nachwuchs aufziehen, durchstreifen frei lebende walisische Bergponys die riesigen Graslandschaften der höheren Lagen. An der rund 2.700 Kilometer langen Küste leben etwa 5.000 Kegelrobben. Im Herbst werden die Jungtiere geboren und müssen oftmals verheerenden Stürmen trotzen. Die nur drei Quadratkilometer große Insel Skomer ist die Heimat von bis zu einer Dreiviertelmillion Seevögel. Die Stars unter ihnen sind die unverwechselbaren Papageitaucher. Nachdem sie acht Monate auf dem offenen Meer verbracht haben, kehren sie im April nach Skomer zurück, um hier ihren Nachwuchs auszubrüten. Die Felseninsel Skokholm beherbergt eine Brutkolonie von rund 80.000 Basstölpeln, es ist die weltweit drittgrößte Brutkolonie dieser faszinierenden Flugakrobaten! Auch Delfine finden an der walisischen Küste ein üppiges Nahrungsangebot. Dabei bedienen sie sich einer völlig unerwarteten Nahrungsaufnahme! Zwei Jahre lang hat der Naturfilmer Hans-Peter Kuttler die reichhaltige Natur in Wales porträtiert. In diesem Naturfilm wird mit hochstabilisierten Flug-, Zeitlupen- und Miniaturkameras und Kameraschienen die faszinierende Natur von Großbritanniens wildem Westen hochwertig und aus neuen Blickwinkeln präsentiert. (Text: NDR) Wale vor unserer Küste
Anfang 2016 strandeten 30 Pottwale an der Nordseeküste, 20 von ihnen verendeten qualvoll vor deutschen Deichen. Die Bilder der sterbenden Wale bewegen Wissenschaftler, Medien und viele Bürger gleichermaßen. Pottwale sind mit bis zu 20 Metern Körperlänge und 60 Tonnen Gewicht die größten Raubtiere der Erde. Sie jagen in der Tiefsee nach Tintenfischen. Warum haben sich 30 Walbullen in die flache Nordsee verirrt? War es das zur Jahreswende 2015/2016 wütende Sturmtief „Frank“, das die Wale in die Nordsee warf? Folgten die Wale der vom Sturm weggedrifteten Beute, den Tintenfischen? Geriet die Navigation der Wale durcheinander? Oder hat extremer Lärm die Wale taub und damit blind gemacht? Der Meeresbiologe, Taucher und Naturfilmer Florian Graner will den Grund für die Wal-Strandungen herausfinden.Seine Spurensuche beginnt dort, wo die Pottwalbullen herkamen, am Polarkreis vor Norwegens Küste. Doch auch andere Walarten, die vor Norwegen leben, tauchen immer wieder im Norden Deutschlands auf: Seit 2015 werden vermehrt Finn-, Buckel- und Zwergwale sowie Delfine vor den Küsten gesichtet. Große Tümmler schwimmen in die Ostseeförden und nähern sich Menschen ohne Scheu. Auch ein Orca (Schwertwal) lag plötzlich tot am Strand vor Sylt. Warum werden gerade jetzt die verschiedensten Walarten in der Nord- und Ostsee beobachtet? Florian Graner recherchiert und findet überraschende Erklärungen. Eine Walart liegt dem Meeresbiologen besonders am Herzen: der Schweinswal. Er ist der einzige heimische Wal und einer der kleinsten Walart weltweit. Kaum jemand kennt das scheue Tier, das im Sommer vor den Stränden der Nord- und Ostsee seinen Nachwuchs zur Welt bringt. Vor Jahren hat Florian Graner seine Doktorarbeit über den Schweinswal geschrieben. Seitdem hat sich die Welt dieses Säugetieres dramatisch verändert. Zu den Stellnetzen, in denen sich viele Wale verfangen und dann ertrinken, kommen Schadstoffe und Müll im Meer. Doch die größte Gefahr ist auch für ihn der Lärm, der ständig zunimmt. Vor allem durch die Schifffahrt und die Offshore-Baustellen für Windenergie, deren Rammen das Meer erschüttern. Wale orten mit Schall. Ihre Orientierung und Kommunikation läuft über das Gehör. Wird es durch Lärm geschädigt, können sie keine Nahrung mehr finden und verhungern. Florian Graner trifft Wissenschaftler, die die Schweinswale erforschen, um sie besser schützen zu können. Die spannende Naturreportage dringt mit bewegenden Bildern in die Welt der Wale vor den deutschen Küsten vor und macht deutlich, warum es auch an Nord- und Ostsee so wichtig ist, sich um den Schutz der Wale zu kümmern. (Text: NDR) Waschbären – Einwanderer aus Wild West
Einst wurde der Waschbär nach Deutschland geholt, weil man ihn als Pelzlieferanten brauchte. Heute nehmen die Tiere überhand in der Natur, so mancher möchte sie gern wieder loswerden. Über die Waschbären kursieren Schauergeschichten. Was wirklich wahr daran ist, zeigt dieser Film. Es stimmt, dass Waschbären Allesfresser sind. Dennoch gehören Geschichten über ihre Fressgier, zum Beispiel die eines Jägers, dass sich ein Rudel Waschbären auf ein Reh stürzte, um es zu erlegen, zu den Märchen. Die Wissenschaft hat das Jägerlatein längst widerlegt.In Deutschland leben heute etwa eine halbe Million Waschbären, die selbst in Großstädten wie Kassel ihr Unwesen treiben. Ihre Verbreitung hat durch die Pelztierfarmen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angefangen. Der Züchter Rolf Haag und Forstmeister Freiherr Sittich von Berlepsch beschlossen damals, zwei trächtige Pärchen auszuwildern, denn die Qualität der Felle von in freier Wildbahn lebenden Waschbären war deutlich besser als die von den Tieren in Gefangenschaft. Laut eines Zeitzeugen sollen dabei sogar Wehrmachtssoldaten Spalier gestanden haben, während eine Kapelle die Nationalhymne spielte. Die Waschbären fanden ideale Bedingungen vor und vermehrten sich fleißig. Das umso mehr in den Zeiten, in denen kaum noch Jagd auf sie gemacht wurde, weil niemand mehr an Waschbärpelzen interessiert war. Plötzlich sorgten sich die Jäger um alle anderen Tiere in Feld und Wald, die mutmaßlich von den Waschbären gefressen wurden. Viele forderten, den Waschbär in Deutschland auszurotten. Das gilt bis heute. Umfangreiche Untersuchungen darüber, welchen Einfluss Waschbären auf die heimische Tierwelt haben, gab es lange nicht. Die Biologen Frank Uwe Michler und Berit Köhnemann begannen ab 2006 mit der Erforschung, die überraschende und größtenteils beruhigende Ergebnisse brachte. Dieser Doku-Fiktion-Film zeigt in vielen Spielszenen die Geschichte der Waschbären in Deutschland, Ausschnitte aus ihrem Leben in Wäldern und Städten und von der Arbeit der Wissenschaftler. Ein Fazit: Es ist fast unmöglich, die Waschbären in Deutschland wieder auszurotten. (Text: NDR) Die Weihnachtsinsel und der Palmendieb
Auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean findet man Krebse überall, nicht nur im Meer: hoch oben in den Palmen, im Wald, auf dem Golfplatz, in Tempeln und in den tiefsten Höhlen. Auf der Weihnachtsinsel, die mit 135 Quadratkilometern etwa ein Drittel größer ist als die Nordseeinsel Sylt, gestalten Krabben das gesamte Ökosystem, sie kultivieren den Boden und bestimmen, was im Wald wächst. Ihren Namen verdankt die Weihnachtsinsel dem britischen Kapitän William Mynors, der sie im Jahr 1643 am 25. Dezember entdeckt hat. Australien, zu dessen Staatsgebiet die Insel gehört, liegt mehr als 1.000 Kilometer südlich.Und auch der nächste Nachbar Java ist Hunderte Kilometer entfernt. Berühmt ist das Eiland für die Roten Krabben. Jedes Jahr zu Beginn der Regenzeit wandern sie ans Meer, um an der Küste ihre Eier abzulegen. Kurz vor Neumond ist es so weit: Die bis zu 120 Millionen Krebse färben die Strände blutrot. Ein Spektakel, das auch den wahren Herrscher der Insel aus der Deckung lockt: den Palmendieb. Palmendiebe sind die größten Landkrabben der Erde. Für sie ist das Schauspiel vor allem aus kulinarischer Sicht interessant, denn die Roten Krabben stehen bei den Palmendieben ganz oben auf dem Speiseplan. Der Film folgt dem Lebenslauf des Palmendiebs, vom tropischen Ozean, in dem er als Larve die ersten Monate verbringt, bis tief in den Wald. Nichts ist vor seinen Scheren sicher, die kräftiger sind als der Kiefer eines Löwen. Palmendiebe werden bis zu 100 Jahre alt und können einen Durchmesser von einem Meter erreichen. Auf der Suche nach Nahrung machen sie vor nichts Halt, selbst Opfergaben in Tempeln sind vor ihren Scheren nicht sicher. Auch die anderen Bewohner der Weihnachtsinsel kommen im Film nicht zu kurz, denn sie alle sind mit den Krabben auf die eine oder andere Art verbunden. Seien es die zahlreichen Seevögel, die auf der Weihnachtsinsel nisten, die geselligen Flughunde oder die Menschen, die es aus allen Erdteilen hierher verschlagen hat. Kameramann und Regisseur Moritz Katz und sein australischer Filmpartner und ehemaliger Ranger der Weihnachtsinsel Braydon Moloney filmten über zwei Jahre lang das Leben der skurrilen Krabben. Entstanden ist ein humorvolles Bild der Insel und ihrer ungewöhnlichen Bewohner. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 19.12.2018 NDR Wenn es Nacht wird im Ozean – Wesen der Tiefe
Nacht für Nacht vollzieht sich in den Meeren dieser Welt ein wundersamer Wandel. Wenn die Akteure des Tages in ihren Verstecken verschwunden sind, tauchen seltsame Wesen aus der Tiefe auf. Manche sehen aus wie gallertartige Kakadus, andere wie durchsichtige Gürtel, wieder andere durchziehen mit ihren Nesselfäden das Wasser wie ein riesiges dreidimensionales Spinnennetz. Sie sind die Vorhut der größten Tierwanderung der Welt. Die wenigsten von ihnen hat je ein Mensch gesehen. Ihnen folgen hungrige Fische wie die blinkenden Laternenfische.Und Tintenfische, die wiederum Jagd auf die Laternenfische machen. Sie finden schließlich ihren Meister in Delfinen, die schon Stunden vorher auf die Ankunft der Tiere aus der Tiefsee warten. Rick Rosenthal, Meeresbiologe und Unterwasserfilmer mit über 30-jähriger Erfahrung, wagt ein ganz besonderes Abenteuer: Er will die geheimnisvollen Nachtwanderer unbedingt vor die Kamera bekommen. Mitten in der Nacht taucht er in den stockdunklen tropischen Pazifik, weitab vom Land über einem 3.000 Meter tiefen Unterwassercanyon. Verliert er den Kontakt zum Basisschiff, ist er verloren. Sein erster Tauchgang endet mit einer Enttäuschung: Er bekommt nur wenige, unscheinbare Tiere zu sehen. Doch das kann nicht alles sein. Rund eine Milliarde Tonnen, so schätzen Wissenschaftler, beträgt die Masse der Kreaturen, die allnächtlich Hunderte bis Tausende Meter aufsteigen. Sie alle haben dasselbe Ziel: in die tagsüber lichtdurchfluteten und dadurch nährstoffreichen oberen Wasserschichten zu gelangen. Rick Rosenthal begleitet eine Expedition des renommierten Tiefseeforschers Bruce Robison und beobachtet fasziniert, was dessen ferngesteuertes Tauchboot alles vor die Kamera bekommt. Eine Welt, in die er als Taucher niemals vorstoßen kann. Die gewaltige Tierwanderung, so erfährt er, wird vom Licht gesteuert. Die lichtscheuen Wesen brauchen den Schutz der Dunkelheit, um vor ihren Feinden sicher zu sein. Sie folgen einem Helligkeitswert, der ein Prozent des normalen Tageslichts entspricht. Wenn der Mond scheint, kommen die Tiere nicht so weit nach oben. Das ist in der Nacht, in der Rick taucht, der Fall. In der nächsten Neumondnacht wagt Rick einen neuen Tauchgang. Wird er dieses Mal die größte Tierwanderung der Welt hautnah miterleben? „Wenn es Nacht wird im Ozean“ ist ein Film mit faszinierenden Tieren, die selbst von Wissenschaftler bislang kaum beobachtet werden konnten. Eine Dokumentation über ein Ereignis, das zwar jede Nacht immer wieder aufs Neue geschieht und dennoch so gut wie noch nie von jemandem gesehen worden ist. So unbekannt wie die dunkle Seite des Mondes. (Text: ARD-alpha) Das Weserbergland – Sagenhaftes Niedersachsen
45 Min.Wilde Ponys streifen durch lichte Wälder, Eisvögel tauchen in glasklaren Bächen nach Fischen und Fuchskinder spielen ungestört vor ihrem Bau am Rand eines Wiesentals: Das Weserbergland gehört zu den schönsten Naturregionen Norddeutschlands. Kaum jemand kennt diesen Landstrich so wie Jürgen Borris. Der Naturfotograf lebt seit Jahren im Weserbergland, seinem liebsten Fotomotiv. Für diese Naturdokumentation geht er auf Entdeckungsreise ins wilde Herz Niedersachsens. Der Frühling verwandelt die Wälder im Weserbergland in eine Welt voller Licht und Schatten: Wo die Sonne durch die jungen Blätter der Eichen und Buchen auf den Waldboden fällt, genießen Exmoor-Ponys ein Sonnenbad.Die wilden Ponys sind die „Landschaftspfleger“ im Wald und schützen die Natur, indem sie das zarte, junge Grün der Bäume abknabbern. Dadurch wird auf Dauer ein offener Wald geschaffen, wie er vor Jahrtausenden einmal weite Teile Europas bedeckte. Diese Wälder inspirierten schon die Gebrüder Grimm: Sie waren im Weserbergland zu Hause und so manches ihrer Märchen hat hier seinen Ursprung. Im Bachlauf eines Wiesentals hat Jürgen Borris seine Kamera in Position gebracht. Er beobachtet eine Wasseramsel, die ihre Jungen füttert. Mit viel Geduld und etwas Glück gelingen ihm auch Fotos vom Eisvogel und Feuersalamander. Um Dachse und Füchse zu beobachten, muss Borris sein Tarnzelt aufbauen. Am Rand eines Feldes, im Schutz von Büschen und Sträuchern, versorgt die Fuchsmutter ihre Jungtiere. Die Fuchskinder trauen sich schon allein aus dem Bau, wenn die Mutter auf Beutezug geht. Im Sonnenlicht spielen sie unermüdlich, bis ihre Mutter wiederkommt, um sie zu säugen. Eine besondere Verbindung hat der Naturfotograf zu einer Rotte Wildschweinen. Die wehrhaften Tiere haben sich inzwischen so sehr an ihren regelmäßigen Besucher gewöhnt, dass Borris die Bachen und ihre Frischlinge aus geringer Entfernung fotografieren kann. Nicht einmal die mächtigen Keiler scheinen sich noch an seiner Gegenwart zu stören, unbeeindruckt beginnen sie im Herbst heftige Kämpfe um die Gunst der Weibchen. Nach einem Sommer, der Kirschen und Bienenhonig gebracht hat, beginnt die Apfelernte in den Wiesentälern des Weserberglandes. Im Wald ist jetzt die Zeit der Hirsche: Mit erbitterten Kämpfen buhlen Dam- und Rothirsche um ihren Harem. Erst wenn der erste Schnee fällt, kehrt in den Märchenwäldern und Wiesentälern wieder Stille ein. Auch die hat Fotograf und Naturliebhaber Borris unterwegs in „seinem“ Weserbergland lieben gelernt. (Text: NDR) Wilde Azoren – Wunderwelt im Atlantik
45 Min.Mitten im Atlantik erhebt sich ein gigantisches Unterwassergebirge. Mit seinen höchsten Spitzen durchdringt es die Wasseroberfläche und bildet die Inselgruppe der Azoren: jede der neun Inseln eine fantastische Welt für sich. Für Seevögel sind die üppig bewachsenen Inseln vulkanischen Ursprungs ein Brückenkopf zwischen Amerika und Europa. Sturmtaucher- und Seeschwalbenkolonien überziehen die Steilküsten. In den Gewässern des Archipels leben die größten Tiere der Welt: Blauwale. Sie sind auf der Durchreise und treffen auf ihrem Weg von den arktischen Gewässern in wärmere Bereiche des Atlantiks auf Finnwale, Buckelwale und Pottwale.Für über 20 Walarten auf ihrem langen Weg von und in die arktischen Gewässer ist das Meer vor den Azoreninseln ein üppiger Futterplatz: Mit dem Golfstrom gelangen aus den Tiefen des Ozeans Tausende Tonnen Krill, Biomasse, aus südlichen Gewässern. So treffen vor den Küsten der Azoren riesige Meeressäuger wie Blauwale, Finnwale, Buckelwale, Pottwale oder Schwertwale auf die größten Fische der Ozeane: Walhaie, Blauhaie oder den seltenen Mondfisch, den größten Knochenfisch der Erde. Wie Wesen aus einer anderen Welt wirken die Salpen, die aus großer Tiefe an die Oberfläche aufsteigen. Sie sind walzenförmig, fächerartig oder langgestreckt, sehen aus wie runde, durchsichtige Köcher oder transparente Plastikröhrchen. Manche Individuen hängen zusammen und bilden Bänder, die acht Meter Länge und mehr erreichen. Selten kommen Salpen in großen Mengen vor. An der Südküste der Insel Pico fällt der Vulkanhang steil ab. Nur wenige Seemeilen vor der Küste liegt der Meeresboden bereits in 2.000 Metern Tiefe. Im Scheinwerferlicht des Tauchboots erscheinen fremdartige Wesen. Manche drehen sich um die eigene Achse, andere wieder ziehen wie eine Schlange vorbei, die nächsten senden bunte Lichtsignale. Die Azoren haben aber mehr als das Unterwasserspektakel zu bieten. Die Landschaften der Inseln mit Basalthöhlen und Wasserfällen sind ebenso spektakulär wie fruchtbar. Überall finden sich grüne, teils von Seen und Teichen durchzogene Vulkankrater. Sie sind ein Süßwasserreservoir für die hier lebenden Vögel, aber auch für Zugvögel, die aus Europa und Amerika kommen und sich auf den Azoren treffen, um hier zu überwintern. Darunter sind Strandpieper, Kiebitzregenpfeifer, Steinwälzer und Steinschmätzer. Ihnen bieten die Kraterlandschaften ein sicheres Refugium mit ausreichend Nahrungsangebot. Im Lavagestein der Steilküsten brüten Gelbschnabel-Sturmtaucher gut versteckt in kleinen Felslöchern. Ihre Flugleistungen sind rekordverdächtig: Kaum flügge geworden, ziehen die Jungtiere mit den Eltern über den Atlantik, um dort den Winter zu verbringen. Ein einziges Ei wurde im Frühjahr in die karge Nisthöhle gelegt. Nistplätze gibt es genug auf den vulkanischen Azoren, wo sich im brüchigen Lavagestein Höhlensysteme weit über die Inseln erstrecken. Die Gelbschnabel-Sturmtaucher bevorzugen die kleinen Höhlen und Löcher an den Steilküsten. Sobald das Junge geschlüpft ist, verbringen die Elterntiere den ganzen Tag mit der Nahrungssuche am Wasser. Erst wenn es Nacht geworden ist, kommen sie für wenige Stunden zum Nest zurück, um das Jungtier zu versorgen. Das Geschrei der Sturmtaucher gleicht einem krächzenden Wimmern und erfüllt bei Anbruch der Nacht ganze Küstenstriche. Hunderte Meter, ja oft mehrere Kilometer erstrecken sich die gewaltigen Höhlenröhren über die Inseln. Sie verlaufen in Fließrichtung der einst flüssigheißen Lava von den Vulkanen talwärts. Irgendwann gibt es den Punkt, wo der Höhlenschlund das Meer erreicht, ein Sammelplatz für Unterwassertiere. Im Scheinwerferlicht der Kameras nutzen Fische die Gelegenheit und stoßen in einen Garnelenschwarm. Muränen tauchen auf und vertilgen die Garnelen zu Hunderten. Große Rochen, Oktopusse und Bärenkrebse sind weitere Bewohner dieses düsteren Reichs ohne Tageslicht. An der Meeresoberfläche gleitet langsam die Portugiesische Galeere dahin. Die Quallenart hat einen transparenten, bläulich schimmernden, ca. 15 Zentimeter langen Körper mit vielen Nesselarmen. Die Nesselfäden sind hochgiftig. Wenn sie nicht eingezogen sind, können sie als bis zu 20 Meter lange Giftschnüre im Wasser nach Beute angeln. Meereslebewesen wie Fische, Garnelen, Salpen, aber auch andere Quallen werden durch diese Fangfäden in wenigen Sekunden getötet. Dann wird die Beute ins Zentrum der Galeere gezogen, zersetzt und verspeist. Die Portugiesische Galeere ist eine Kolonie von Polypen, deren Einzeltiere im Verbund spezielle Fertigkeiten entwickeln und alleine nicht mehr lebensfähig sind. Das größte Lebewesen des Planeten ist der Blauwal. Ein Exemplar ist zum Atmen an die Meeresoberfläche aufgestiegen. Sein mächtiger Körper ist gut 25 Meter lang. Nur mit Brille, Schnorchel und Flossen gleiten die Kameraleute ins Wasser. Sobald der dunkle Schatten näher kommt, holen sie einmal noch tief Luft und tauchen ab. Der Wal zieht wenige Meter vor den Tauchern vorbei. Die Atemluft wird knapp, denn es dauert eine Weile, bis der riesige Blauwal sich wieder entfernt hat. Fährt man mit dem schnellen Schlauchboot von der Insel Pico nach Süden, ist bald kein Land mehr in Sicht. Wer dann ins Wasser geht und abtaucht, fühlt sich sehr allein und einsam im weiten riesigen Ozeans. Vor allem, wenn ein Blauhai auf die Kamera zuschwimmt, majestätisch und ruhig. Nicht selten kommen die Tiere mit der Nasenspitze bis auf wenige Zentimeter an die Kameralinse heran und drehen dann ab. Es kommt vor, dass die lange Brustflosse über die Schulter des Kameramanns streicht. Blauhaie sind sanfte „Primaballerinas“, sie sind nicht hektisch, aber neugierig. Erich Pröll: Der Hai, den Nuno Sa filmte, hatte Reste eines Thunfischs zwischen den Zähnen. Schwarze Schwertwale hatten den Fisch attackiert und zerstückelt. Nuno gelingen Aufnahmen, wie der Hai den Thunfisch zerlegt, das alles passiert wenige Zentimeter vor der Kameralinse. Jutta Anna Wirth hält einem anderen Taucher den Rücken frei, sie dirigiert einen anderen Hai langsam zur Seite, während der andere sich auf den vor ihm konzentriert und versucht, gute Aufnahmen zu machen. Spannend wird aber das Auftauchen nach eineinhalb Stunden. Der erste Blick über Wasser, kein Boot weit und breit, nur leichte Dünung und weiter Ozean. Die Taucher treiben an der Meeresoberfläche, die Sonne steht schon tief. Es ist einer der großen Augenblicke auf den Azoren, wunderschön und doch etwas beklemmend: weit in der Ferne die 2.500 Meter hohe Spitze des Vulkans Pico, rot angeleuchtet von der Abendsonne, unter ihnen das dunkle Meer mit seinen Haien. Doch dann nähert sich tatsächlich das Motorboot, der Skipper hat das Taucherteam gefunden. Corvo ist die kleinste Insel der Azoren, ein erloschener Vulkan und ganz im Westen gelegen. Ebenso wie Flores ist sie schon Teil der amerikanischen Kontinentalplatte. Der riesige Krater erhebt sich direkt aus dem Meer. In der Caldera befinden sich sumpfige, kleine Seen. Einmal im Jahr, im Oktober, wird Corvo von Birdwatchern aus aller Welt belagert. Sehnsüchtig erwarten sie das jährliche Erscheinen der Zugvögel aus zwei Kontinenten: Amerika und Europa. Manche Vögel kommen sogar aus Grönland auf die Azoren. Hier trifft Europa auf Amerika: über Wasser die winzigen Vögel mit ihren gigantischen Flugleistungen, in den Tiefen des Ozeans die Kontinentalplatten mit ihren Urgewalten, die für die Entstehung der Inselgruppe verantwortlich sind. Die in UHD-Qualität gedrehte „Universum“-Dokumentation zeigt die kleine Inselgruppe im Atlantik als Brückenkopf zwischen Nord und Süd, Ost und West, zu Wasser wie zu Luft. Während es auf den Inseln selbst keine großen Wildtiere gibt, ist die Biodiversität rund um die Inseln einzigartig. Die Lava- und Basaltfelsen sind aufgrund ihrer exponierten Lage im Atlantik eine Drehscheibe für die größten Tiermigrationen im Atlantik. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 29.11.2017 NDR Wilde Dynastien: Die Revolte der Schimpansen
45 Min.
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail