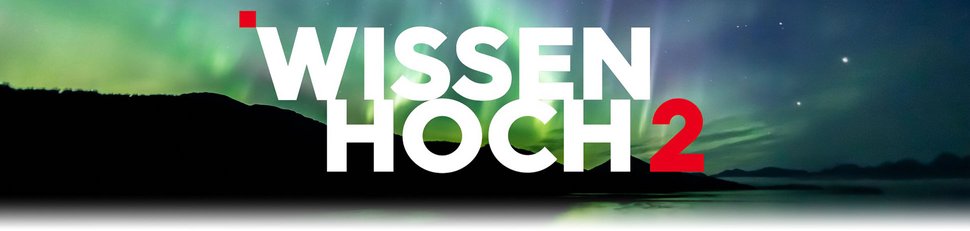119 Folgen, Folge 49–72
49. mRNA – Hype oder Hoffnung?
Folge 49mRNA-Impfstoffe sind die Hoffnungsträger im Kampf gegen die Coronapandemie. Ihr Potenzial geht weit darüber hinaus. Das Wirkprinzip soll der Medizin ganz neue Behandlungsmethoden eröffnen. Für einen therapeutischen Ansatz erschien die mRNA-Technologie lange Zeit ungeeignet. Nun ist die Erwartung da, dass sich mit ihr in Zukunft eine Vielzahl von Krankheiten behandeln lässt – darunter Krebs, HIV, Malaria, Herz-Kreislauf- und Autoimmunerkrankungen. Aber wie genau funktioniert dies? mRNA-Impfstoffe transportieren die Bauanleitung für ein Virusprotein in die Zellen, die daraufhin beginnen, das fremde Biomolekül herzustellen.Das Immunsystem fährt die Abwehrkräfte gegen das Virus hoch, obwohl es nur einen kleinen, ungefährlichen Teil des Erregers kennt. Was auf dem Papier einfach klingt, ist im lebenden Organismus ein ähnlich komplexes Vorhaben wie eine Landung auf dem Mars. Die mRNA-Forschung nahm vor gut drei Jahrzehnten ihren Anfang mit dem Wunsch, individuelle Therapien gegen Krebs zu entwickeln. Heute gibt es klinische Studien, die die Regeneration des Herzmuskels unmittelbar nach einem Infarkt mit einer Therapie auf mRNA-Basis untersuchen. Von mRNA-Präparaten und Vakzinen könnten auch Menschen mit Autoimmunkrankheiten oder HIV profitieren. Und: Influenzaviren bringen immer neue Stämme hervor. Ein mRNA-Impfstoff könnte schneller angepasst werden als herkömmliche Impfstoffe – und wäre somit treffsicherer. Über 150 verschiedene Therapien und Impfstoffe auf mRNA-Basis sind inzwischen weltweit in der Entwicklung. Aber welches Potenzial hat die mRNA Technologie wirklich? Wo sind die Risiken? Was haben Wissenschaftler aus Corona gelernt? Ist die mRNA-Technik die neue Wunderwaffe der Medizin – oder bloß ein Hype? (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mo. 31.01.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 03.02.2022 3sat 50. Das Geheimnis unseres Schlafs
Folge 50Praktisch jedes Tier schläft. Auch wir. Doch warum müssen wir fast ein Drittel unseres Lebens in einem so wehrlosen Zustand verbringen? Was bedeutet guter Schlaf, und wie bekommen wir ihn? Wissenschaftler blicken immer tiefer in das schlafende Gehirn und entdecken, wie leistungsfördernd der Schlaf sein kann. Ob Nachteule oder Frühaufsteher: Der Schlaf ist zentral für unsere Gedächtnisleistung, er reguliert unsere Emotionen und stärkt unser Immunsystem. Warum bekommen wir häufig zu wenig Schlaf, und was steht auf dem Spiel, wenn wir schlecht schlafen? Die Funktionen des Schlafs waren lange Zeit ein Rätsel.Doch die Forschung gewinnt nun immer mehr Erkenntnisse: Eine Studie belegt, dass sich die Gehirnströme eines Menschen anregen lassen, um die Phasen des Tiefschlafs zu verlängern. Bei Kleinkindern hat sich gezeigt, dass selbst ein kurzes Nickerchen nach dem Erlernen von etwas Neuem dazu beitragen kann, dass diese Informationen haften bleiben. Außerdem gibt es Hinweise, dass unterbrochener Schlaf genauso schädlich sein kann wie gänzlich fehlender Schlaf. Im Interdisziplinären Schlafzentrum am Pfalzklinikum in Klingenmünster beschäftigt sich Dr. Hans-Günter Weeß seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen und wünscht sich „eine neue Schlafkultur“. Dies wirke sich nicht nur positiv auf unsere Gesundheit und Lebenserwartung aus, auch die Arbeitswelt und Wirtschaft profitiere von ausgeschlafeneren Mitarbeitern, die weniger Fehler machen und seltener krank sind. Je mehr Wissenschaftler die wichtige Rolle unseres Schlafs verstehen, desto klarer wird eines: Diese biologische Funktion ist ebenso bedeutend wie komplex. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 17.02.2022 3sat 51. Gefährlicher Müll – verborgene Deponien der Gemeinden
Folge 51Bis in die 1970er-Jahre hat jede Gemeinde ihren Abfall dorthin gekippt, wo gerade Platz war. Welcher Müll wo genau liegt, bleibt bis heute oft unklar. Eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit. In Deutschland existieren schätzungsweise bis zu 100.000 solcher Müllkippen. Ob sie im Altlastenkataster der Gemeinden eingetragen sind und wer für die Sanierung haftet, ist oft unklar. Viele der unkontrollierten Kippen sind nach Jahrzehnten noch problematisch. Während die Deponierung und Wiederverwertung heutzutage bis ins Kleinste geregelt sind, war man damals froh, die Abfälle einfach irgendwo in einer Grube entsorgen zu können. In den Jahren des Wirtschaftswunders wuchsen die Müllmengen immer weiter an.Sie belasten heute das Grundwasser durch Schadstoffe oder setzen giftige Deponiegase frei. Helmut Meuser, Professor für Bodensanierung und Bodenschutz an der Hochschule Osnabrück, untersucht solche alten Müllkippen und warnt: „Wir müssen die Standorte im Auge behalten – und möglichst sanieren.“ Doch das ist teuer. Viele Städte und Gemeinden als Verursacher der Altlasten scheuen die enormen Kosten. Beseitigung und Sanierung einer einzelnen Fläche kosten schnell viele Millionen Euro. Die Altlasten sind nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sie sind auch völlig wertlos für das Rohstoffrecycling. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 03.03.2022 3sat 52. Atmen
Folge 52Atmen ist mehr als ein lebensnotwendiger Reflex. Jeder Mensch macht täglich rund 20.000 Atemzüge. Atemtiefe und Atemrhythmus beeinflussen sehr, ob wir uns wohlfühlen oder gestresst sind. Unser Atemzentrum sitzt im unteren Rückenmark und steuert die Ein- und Ausatmung. Bis zu 15.000 Liter Luft fließen täglich durch die Lunge und versorgen alle Körperzellen mit Sauerstoff. Wie können wir diese Lebenskraft noch besser für unsere Gesundheit nutzen? Unser Organismus braucht ständig Sauerstoffnachschub. Die Lunge ist die wichtigste Schnittstelle zwischen der Innen- und Außenwelt.Tief in den Bronchien der Lunge sitzen Millionen dünnhäutiger Bläschen. Durch ihre feinen Membranen gelangt der Sauerstoff ins Blut. Es ist eine gigantische Fläche, 40-mal größer als die menschliche Körperoberfläche und äußerst sensibel. Sie muss ein Leben lang vor Viren, Bakterien und Schadstoffen geschützt werden. Zum Glück weckt schon der allererste Atemzug die wichtigsten Immunzellen der Lunge.Die Atmung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit: Wer zum Beispiel zu flach und zu hektisch atmet, bekommt nicht genug Sauerstoff und stresst sein vegetatives Nervensystem. Kohlendioxid, das wir ausatmen, ist mehr als ein bloßes Abfallprodukt der Energiegewinnung. Es steuert unseren Hunger nach Luft. Doch was passiert, wenn man minutenlang die Luft anhält, und wie fühlt sich das Atmen auf dem höchsten Punkt der Erde an? Könnte sich ausgerechnet Sauerstoffmangel als neue Therapie für Herzpatienten eignen?Die 3sat-Wissenschaftsdokumentation folgt dem Atem auf den höchsten Gipfel, in die Unterwasserwelt und in die Labore renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um die Geheimnisse einer Fähigkeit zu lüften, ohne die das Leben nicht möglich wäre. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 24.03.2022 3sat 53. Unter Hochspannung – Wie sicher sind unsere Stromnetze?
Folge 53Elektrizität bewegt die Welt. Unterbrechungsfreie Stromversorgung und Netzstabilität sind technisch aufwendig. Die Energiewende verlangt eine neue Infrastruktur. Kommt diese rechtzeitig? Schon 2022 gehen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz, deren Energie dann fehlt. Wann die erste große Stromtrasse grünen Windstrom von der Küste im ganzen Land verteilen wird, ist noch unklar. Der Netzausbau ist umstritten. Brauchen wir ihn? Atom- und Kohlestrom sorgen bisher für die Grundlast unseres Netzes, die immer verfügbar sein muss. Sie liegt derzeit in Deutschland zwischen 40 und 80 Gigawatt.Der Kohleausstieg bis 2038 ist beschlossene Sache. In Zukunft sollen zu einem Großteil Windkraftanlagen in Küstennähe diese Grundlast übernehmen. Die Produktion ist die eine Sache, der Transport die andere. Zwei Hauptprobleme gilt es dabei technisch zu lösen: den Ausgleich der Energieschwankungen an windarmen Tagen und den Aufbau eines Gleichstromnetzes quer durch Deutschland. Denn das Wechselstromnetz, das bislang die elektrische Energie zu den Verbrauchern gebracht hat, ist für den Transport von Strom über mehr als 300 Kilometer Länge nicht geeignet – die Verluste und Kosten wären zu hoch.Die Alternative zu überregionalen Stromtrassen: regenerative Energie regional produzieren und verbrauchen. Doch im Süden stehen bisher keine großen Windparks wie etwa im Norden zur Verfügung. Stromtrassen-Gegner sind überzeugt, dass vor allem Photovoltaik die Lücke schließen kann. Selbst wenn dies rechnerisch möglich ist, fehlt jedoch auf lokaler Ebene im Stromverteilnetz die intelligente Anbindung neuer Stromquellen und Stromspeicher. Bei vielen Stadtwerken liegen die Informationen über die vielfältigen neuen Stromquellen aus Wind-, Sonne-, Wasserkraft, Biomasse oder Erdwärme noch nicht in digitaler Form vor – und steuern lassen sie sich schon gar nicht.Sollte der Strom für die Grundlast, aber auch die Leistungsspitzen dauerhaft fehlen, droht der Blackout. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ohne umfassende Erneuerung der Stromnetze kann die Energiewende nicht gelingen.Das Filmteam besucht unter anderem in Brauweiler bei Köln den Stromfrequenz-Wächter für das kontinentaleuropäische Verbundnetz mit seinen fast 500 Millionen Menschen und erklärt die technischen Grundlagen, die notwendig sind, damit überall jederzeit Strom verfügbar ist. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 31.03.2022 3sat 54. Mein Essen und ich: Personalisierte Ernährung
Folge 54Aktuelle Studien zeigen: Jeder Mensch verwertet Kohlenhydrate, Fette oder Proteine anders. Eine personalisierte Ernährung soll die Leistungsfähigkeit steigern und beim Abnehmen helfen. Daher geht beim Speiseplan der Trend zur Individualisierung. Die Wissenschaft weltweit arbeitet an einer Präzisionsformel, die auf den Einzelnen zugeschnitten ist. Können DNA-Tests und Analysen des Mikrobioms die ideale Ernährung für die Gesundheit bestimmen? Dass erhöhte Blutzuckerwerte zu Übergewicht führen und Diabetes mellitus Typ 2 auslösen können, wissen viele Menschen.„Weitaus weniger bekannt ist, dass es bei jedem Menschen andere Lebensmittel sind, die den Blutzuckerspiegel nach oben treiben“, sagt Prof. Christian Sina, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Für „WissenHoch2“ lässt er seine These prüfen. Vier Probanden kontrollieren zwei Wochen lang ihren Blutzuckerspiegel und dokumentieren, wie dieser auf verschiedene Lebensmittel reagiert. Prof. Sina ist sicher: „Es macht keinen Sinn, Lebensmittel pauschal in ‚gesund‘ und ‚ungesund‘ einzuteilen. Vielmehr sollte man die Menschen in verschiedene Kategorien einteilen und herausfinden, was jeder persönlich am besten verträgt.“ Der Grundstein für diese Forschung wurde in Israel gelegt. Prof. Eran Elinav vom Weizmann Institut in Rehovot entwickelte einen Algorithmus, der mithilfe von Stuhlproben-Analysen individuelle Ernährungsempfehlungen erstellt. Unsere Darmbakterien scheinen nicht nur darüber zu bestimmen, welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, sondern auch, zu welcher Tageszeit. Der Algorithmus ist mittlerweile Teil einer Ernährungs-App, die mehr als 70.000 Menschen nutzen. DNA-Analysen zur Erstellung personalisierter Diätpläne werden in Deutschland bereits seit einigen Jahren angeboten, allerdings kritisieren Verbraucherschützer und Wissenschaftler die mangelnde Evidenz. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn baut Prof. Katja Lotz ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk auf. Die Ökotrophologin will herausfinden, wie groß das Potenzial einer personalisierten Ernährung ist. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 21.04.2022 3sat 55. Gesünder arbeiten, besser leben: Teilzeit für alle?
Folge 55Präsenzpflicht, Vierzigstundenwoche und starre Hierarchien – jahrzehntealte Arbeitsmodelle stehen auf dem Prüfstand. Unternehmen müssen kreativ werden, um neue Mitarbeitende zu finden. Rund drei Millionen Fachkräfte werden in Deutschland ab 2025 fehlen, Tendenz steigend. Ältere, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationsgeschichte sind inzwischen unverzichtbar. Experten aus Medizin, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie gestalten den Wandel. Die COVID-19-Pandemie hat unsere Arbeitswelt durcheinandergeworfen: Manche Jobs in der Veranstaltungsbranche, aber auch in der Hotellerie und Gastronomie wurden über Nacht überflüssig. Viele Menschen mussten sich eine neue Arbeit suchen.Für andere Arbeitnehmende wurden lang umkämpfte Privilegien in kürzester Zeit selbstverständlich: Homeoffice und selbstbestimmteres, flexibles Arbeiten. Wie können der Betrieb als sozialer Ort und die Bindung an das Unternehmen erhalten bleiben, wenn der Lebensmittelpunkt nicht mehr zwingend in der Nähe des Unternehmens liegt? Es findet ein Umdenken in der Arbeitswelt statt. Alte Modelle und Strukturen werden auf den Kopf gestellt.Aus den Niederlanden kommt ein Modell zu uns, das die Pflege vor Ort neu organisiert. Wenn durch weniger Bürokratie und mehr Eigenverantwortung die Motivation steigt und der Krankenstand sinkt, bleibt mehr Zeit für die individuelle Pflege, ohne dass die Kosten steigen. In Deutschland setzen einzelne Handwerksbetriebe bei vollen Auftragsbüchern auf die Viertagewoche, weil sie nur so Nachwuchs finden. In Norwegen unterstützt der Staat Firmen dabei, ältere Menschen freiwillig länger im Job zu halten. Viele sind auch jenseits der 60 gern berufstätig, denn das bedeutet für sie, weiterhin einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Soziologie, Medizin, Neurobiologie und Wirtschaftswissenschaften untersuchen diese Entwicklungen und gestalten sie gemeinsam mit Arbeitskräften, Unternehmen und Gewerkschaften. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 28.04.2022 3sat 56. Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten
Folge 56Eine Revolution der Weltraumforschung steht bevor: Die NASA rechnet fest damit, dass bald ein Planet mit Sauerstoff in der Atmosphäre gefunden wird – ein direkter Hinweis auf Leben im All. Rund 5000 Exoplaneten sind bereits bekannt. Es werden täglich mehr. Auf ihnen könnte Leben möglich sein. In der Atmosphäre des Planeten K2–18b zum Beispiel wurde bereits Wasser nachgewiesen. Die Entdeckung außerirdischen Lebens ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana am 25. Dezember 2021: An Bord der europäischen Ariane-5-Rakete: das teuerste und beste Weltraumteleskop, das je gebaut wurde.Das James-Webb-Weltraumteleskop. Es wird die Erforschung der Exoplaneten in völlig neue Dimensionen katapultieren. Rund einen Monat später hat das Teleskop sein Ziel rund 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreicht. Der Hauptspiegel ist entfaltet, mit ersten Bildern rechnen die Weltraumbehörden im Sommer. „Wir werden Planeten beobachten können, die etwa so groß sind wie die Erde. Und wir werden feststellen können, ob ihre Atmosphäre Wasser, Methan oder Kohlendioxid enthält“, so Laura Kreidberg, Direktorin und Astrophysikerin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Sie erforscht dort mit ihrem Team die Atmosphäre der Exoplaneten und sucht nach der Antwort auf eine Menschheitsfrage: Sind wir allein – oder gibt es da draußen im Universum noch anderes Leben?Exoplaneten sind Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Wie Erde, Jupiter oder Saturn kreisen sie um einen Stern. Inzwischen kann die Wissenschaft immer genauer die Umweltbedingungen dieser außerirdischen Welten bestimmen. Könnten darunter Planeten sein, die bewohnbar und so lebensfreundlich sind wie die Erde? Diese Frage ist derzeit eine der spannendsten in der Astronomie. Ein lebensfreundlicher Planet müsste zwei Bedingungen erfüllen: Er muss seinen Stern in der „habitablen“ Zone umkreisen – der Zone, in der die Temperatur flüssiges Wasser an der Planetenoberfläche überhaupt ermöglicht. Und es muss auf diesem Planeten Wasser geben. Die Dokumentation „Leben im Weltall? Die Entdeckung der Exoplaneten“ begleitet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA, Deutschland, Spanien, Großbritannien und der Schweiz bei ihrer Suche nach außerirdischen Welten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 12.05.2022 3sat 57. Rätselhaftes Bauchgefühl – Wie klug ist unsere innere Stimme?
Folge 57Unser Leben stellt uns ständig vor Entscheidungen. Dabei verlassen wir uns häufig auf unser Bauchgefühl. Was steuert unsere Intuition – und sollten wir ihr wirklich immer vertrauen? Oft hat unsere „innere Stimme“ recht. Dann sind wir stolz, wenn wir intuitiv die richtige Wahl treffen. Fehlentscheidungen hingegen können schmerzhaft oder auch teuer sein. Welche anderen Ressourcen haben wir, um vernünftige Entscheidungen zu fällen? Häufig glauben wir, völlig frei von Einflüssen zu sein, wenn wir „aus dem Bauch heraus“ entscheiden. Dabei übersehen wir, welche irrationalen Zusammenhänge unser Gehirn herstellt, wenn wir die Antwort auf eine Frage nicht kennen: So werden wir beispielsweise bei Schätzfragen unbewusst von willkürlichen Zahlen beeinflusst, die uns kurz zuvor begegnet sind.Diesem „Ankerphänomen“ begegnen wir auch im Alltag, etwa beim „Sale“ im Möbelhaus oder beim Gebrauchtwagenkauf. Der Kognitionspsychologe Christian Stöcker erklärt, welchen kognitiven Verzerrungen wir unterliegen und wie wir sie umgehen können. An Beispielen aus der Kommunikations-, Wirtschafts- und Klimaforschung wird deutlich, wie elementar das Verständnis von kognitiven Prozessen ist, um bessere Entscheidungen zu treffen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.06.2022 3sat 58. Scheitern als Chance – Wie wir aus Fehlern lernen
Folge 58Irren ist menschlich. Trotzdem verbinden viele Menschen mit Fehlern Angst, Scham und Schuldgefühle. Dabei zeigt die Forschung: Wir müssen lernen, zu scheitern, um erfolgreich zu sein. Denn die wichtigste Erkenntnis der Fehlerforschung ist: Je mehr Fehler sichtbar werden, desto seltener wiederholen sie sich. Deshalb sollten wir Fehler als Chancen begreifen. Schon in der Schule lernen wir durch den Rotstift: Fehler sind etwas Schlechtes. Der falsche Ansatz, sagt Theo Wehner. Der Psychologe ist Professor für Organisationspsychologie an der ETH Zürich und beschäftigt sich schon seit 40 Jahren mit den Denkmustern hinter Fehlern.Für ihn bedeutet Fehlerkultur Lernkultur. „Im Schatten fehlerhafter Handlungen werden Gewohnheiten, Organisationsprinzipien und Entscheidungsstrukturen sichtbar, die für individuelle Lernprozesse genutzt werden können.“ Seine Erkenntnis: Wie oft ein Mensch Fehler macht, hängt nicht von seinem Charakter ab, sondern von der Situation: Stress, Zeitdruck oder fehlendes Wissen erhöhen die Fehlerwahrscheinlichkeit. Doch es gibt Fälle, wo Fehler im schlimmsten Fall Menschenleben kosten. Deshalb geht es in risikoreichen Bereichen wie zum Beispiel der Sicherheit der Energieversorgung, der Medizin und der Luftfahrt nicht primär um Fehlervermeidung, sondern um Fehlererkennung. Nach schweren Unglücken entwickelte die NASA im Auftrag der amerikanischen Luftfahrtbehörde in den 1970er-Jahren ein anonymes Fehlermeldesystem für Piloten und Crewmitglieder. Die individuelle Furcht vor Strafen fiel weg, Tausende Fehler wurden gemeldet und analysiert. Die Folge: Die Luftfahrt wurde immer sicherer. Das Prinzip solcher Meldesysteme wird mittlerweile auch in der Medizin angewendet.Christoph Mayer modelliert und analysiert am Institut für Informatik der Universität Oldenburg Störungen und Fehlerquellen in unserem Energieversorgungssystem. Der Mathematiker und sein Team wollen unsere Stromversorgung resilienter machen – und damit weniger fehleranfällig. Besonders der Mensch als Fehlerquelle ist für Christoph Mayer interessant – sowohl bei der Arbeit im und am Versorgungssystem als auch als Auslöser absichtlicher und krimineller Manipulation von außen. Doch auch die Technik selbst ruft immer wieder neue Fehlerquellen hervor. Hier hat der Mensch den entscheidenden Vorteil: Er weiß, flexibel zu handeln. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 09.06.2022 3sat 59. Überleben im Wasser – Von der Kulturtechnik des Schwimmens
Folge 59Wasser ist für die Menschheit wichtigstes Gesundheits- und Lebenselixir – es bedeutet aber auch Lebensgefahr. Verliert das Wasserwesen Mensch eine seiner wichtigsten Kulturtechniken? Lange Wartelisten, geschlossene Bäder: Fachverbände schlagen Alarm, was die Schwimmfähigkeit von Kindern angeht. Fast zwei Drittel der Zehnjährigen sind Nichtschwimmer. Die Coronapandemie hat den Trend noch verstärkt. Das birgt gefährliche Folgen. „Schwimmkurse völlig ausgebucht“, meldet die „Allgäuer Zeitung“. Die DLRG schätzt, dass allein in Niedersachsen rund 75.000 Kinder auf einen Platz im Schwimmkurs warten.Bis zu drei Jahre kann es dauern, bis wieder Plätze frei werden.Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung kann nur mittelmäßig bis gar nicht schwimmen. Dabei sind Schwimmen und Training im Wasser immer noch ein Breitensport, ein umfassendes Heilmittel und vor allem eine Fähigkeit, die Leben retten kann. „Der Mensch hat eine ganz wesentliche Phase seiner Entwicklungsgeschichte im Wasser verbracht“, sagt der Evolutionsbiologe Carsten Niemitz. In seiner ebenso revolutionären wie umstrittenen Theorie beschreibt er, dass der Mensch den aufrechten Gang in nährstoffreichen Ufergewässern gelernt haben könnte. Doch obwohl der Mensch als einziger Primat ein Unterhautfettgewebe besitzt, das ihn im Wasser ein wenig warmhalten kann, ist Schwimmen eine Technik, die wir erst erlernen müssen. Aber selbst die besten Schwimmer überleben im kalten Ozeanwasser nur ein paar Minuten. Meik Spiller vom Maritimen Kompetenzzentrum im niedersächsischen Elsfleth bringt Berufsschülern nautischer Berufe bei, Überlebensanzüge und Rettungsinseln zu benutzen – in einem Becken, das Sturm, hohe Wellen und Gewitter simulieren kann. Dass Schwimmen und der Kontakt mit Wasser positive gesundheitliche Effekte haben, ist gut belegt. Übergewichtige Menschen etwa haben in Therapiebecken oft die einzige Möglichkeit für eine erfolgversprechende Rehabilitation. Eisschwimmen, wie es Hans-Jörg Ransmayer aus Österreich in einem Bergsee demonstriert, beugt einer britischen Studie zufolge sogar einer Alzheimer-Erkrankung vor. Die Kälte hat einen regenerativen Effekt auf das Gehirn. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 23.06.2022 3sat 60. Gefährliches Gas – auf der Jagd nach den Methanlecks
Folge 60Forschungsteams messen weltweit immer höhere Konzentrationen von Methan in der Atmosphäre – ein klimagefährliches Gas. Wer ist für die Freisetzung dieser großen Methanmengen verantwortlich? Entweicht das Methan aus den Erdgasnetzen der Städte? Aus Pipelines? Oder bei der Förderung von Öl und Gas? Methan ist für ein Viertel der Erderwärmung verantwortlich. Der Anstieg muss schnellstens gestoppt werden, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Methanquellen gibt es viele – auch natürliche: Das Gas wird bei Waldbränden freigesetzt und entsteht bei Fäulnisprozessen in Feuchtgebieten.Auch Mülldeponien, die Massentierhaltung und das Heizen und Kochen mit Holz produzieren, global betrachtet, große Mengen von Methan. Rund 40 Prozent des derzeitigen Anstiegs der Methankonzentration in der Atmosphäre aber gehen auf das Konto von Erdgas, das kann die Wissenschaft zweifelsfrei belegen. Der Film ist auf Spurensuche in den USA, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich und begleitet Forschende, die mithilfe von Spezialkameras, Satellitenbildern und aufwendigen Datenanalysen Schritt für Schritt beweisen, wie und wo das Methan austritt. Ursache sind zu einem großen Teil Lecks an schlecht gewarteten Gas- und Ölförderanlagen. Zwar gäbe es längst technische Möglichkeiten, die Anlagen rund um die Uhr auf Methanlecks zu überprüfen. Doch die Suche nach den Methanaustritten und die Investition in technische Lösungen ist für die Gas- und Ölindustrie offensichtlich zu mühsam und kostspielig. Selbst dann, wenn sie durch die Lecks bei sogenannten Super-Emissionen zum Teil extrem große Mengen ihres wertvollen Produktes verliert. Über 80 Millionen Tonnen des gefährlichen Klimagases gelangen jedes Jahr weltweit in die Atmosphäre, weil aus Öl- und Gasförderanlagen eine gigantische Menge an Erdgas entweicht. Sie entspricht etwa dem jährlichen Verbrauch von Erdgas in Deutschland und Frankreich zusammen. Auch wenn durch den Ukraine-Krieg momentan die Versorgungssicherheit im Fokus der Politik steht: Wollen Deutschland und die EU ihre Klimaziele erreichen und die Erderwärmung eindämmen, müssen sie die wichtigsten Förderländer zu einer sauberen Produktion von Erdgas verpflichten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 01.09.2022 3sat 61. Neue Therapien gegen Parkinson
Folge 61Die Parkinsonkrankheit betrifft Millionen Menschen weltweit. Einige Symptome lassen sich mit Medikamenten lindern. Heilung ist bisher nicht möglich. Stammzelltherapien bringen Hoffnung. Parkinson ist die zweithäufigste Erkrankung des Gehirns. Treten untrügliche Symptome auf – stockende Bewegungen, Tremor, schleppender Gang – ist bereits die Hälfte der Zellen zerstört.Bewegungs- und Dopamintherapien können die Erkrankung nur noch verzögern. Parkinson betrifft vor allem die Hirnregion, die den flüssigen Ablauf von autonomen Bewegungen steuert.Die neurodegenerative Erkrankung geht mit einem Dopaminmangel im Gehirn einher. Zu diesem Mangel kommt es, weil die Nervenzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren, absterben. Warum genau dies geschieht, ist noch nicht ganz klar. Nur wenige Menschen haben eine genetische Prädisposition dafür, an Parkinson zu erkranken. Studien hatten einen Zusammenhang zwischen Pestiziden und Parkinson erkannt. In Frankreich ist Parkinson deshalb als Berufskrankheit in einigen Bereichen von Gartenbau und Landwirtschaft anerkannt. Im Tierversuch mit Ratten hatten amerikanische Forschende bewiesen, dass es einen direkten Weg für ein Parkinson auslösendes Protein vom Magen bis ins Gehirn gibt.Prof. Dr. Daniela Berg vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein und ihr Team haben nun einen Durchbruch bei der Früherkennung von Parkinson geschafft: Sie sind die weltweit Ersten, die über einen Bluttest das fehlgefaltete Protein Alpha-Synuclein aus Nervenzellen nachweisen können. Die Hoffnung ist, dass ein frühzeitiges Erkennen der Erkrankung und eine entsprechende Dopamin-Substitution den degenerativen Verlauf abschwächen kann.Mit fokussiertem Ultraschall veröden die Neurologen an der Uniklinik in Kiel den Bereich im Hirn, der den starken Tremor in der Hand verursacht. Nur Heilung gibt es bislang nicht. Deshalb versucht die Forschung, Stammzellen so umzuprogrammieren, dass sie Dopamin produzieren und die abgestorbenen Nervenzellen ersetzen können. Dr. Agnete Kirkeby von der Universität Kopenhagen ist nun so weit, dass sie bald dem ersten Menschen in einem Heilversuch Dopamin-erzeugende Neuronen implantieren kann. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 22.09.2022 3sat 62. Die Herz-Revolution – wie wir gesünder alt werden
Folge 62Das Herz ist der Motor unseres Körpers. Es schlägt im Lauf des Lebens rund drei Milliarden Mal. Präzise Herzmedizin und Prävention sorgen für viele gesunde Jahre – sogar bei Herzfehlern. Moderne Bildgebung stellt das Herz nahezu gläsern dar. Herzoperationen haben selbst für sehr junge oder sehr alte Menschen an Schrecken verloren. Und: Das Herz ist ein Muskel, der sich trainieren lässt. Wir können viel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen tun. Kinderherzchirurgen beheben erfolgreich schwerste angeborene Herzfehler, die man früher nicht operieren konnte. „Vor allem Operationen von Neugeborenen sind kompliziert. Ihre Organe sind noch sehr klein, und das Herz ist kaum größer als eine Walnuss“, sagt der Kinderherzchirurg Prof. Jürgen Hörer.Auch alte Menschen mit Vorerkrankungen gewinnen durch den rasanten medizinischen Fortschritt an Lebensqualität, denn viele Eingriffe werden schonend mit kleinen Schnitten über die Gefäße zum Herz vorgenommen. Mit spezieller KI geschulte OP-Roboter erledigen Routine-Katheter-Eingriffe genauer als menschliche Hände. Damit es gar nicht zu Herzkomplikationen kommt, sollten gesunde Menschen und solche, die eine Herz-OP hinter sich haben, eine klare Prämisse befolgen: die Kraft des Herzens zu erhalten. Das geht nur mit Bewegung und Sport einerseits und Ruhe und Entspannung andererseits. Ständig den Herzmuskel zu trainieren, so Expertinnen und Experten, sei genauso wichtig wie das tägliche Zähneputzen. Durch die rasanten Fortschritte in der Herzmedizin und die präzisen Informationen zur Prävention ist die Lebenserwartung bei uns in den vergangenen 60 Jahren um fast 20 Jahre gestiegen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 29.09.2022 3sat 63. Katastrophenschutz – Wie gut sind wir vorbereitet?
Folge 63Ukrainekrieg, Extremwetterlagen, die Pandemie und Versorgungsengpässe bestimmen unseren Alltag. Wie können wir schneller und wirksamer auf immer neue Krisen und Gefährdungen reagieren? Jede dieser Notlagen ist für die Wissenschaft und für die Gesellschaft ein unfreiwilliges Großexperiment in Sachen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. Es deutet sich ein Paradigmenwechsel an: Nicht auf die Profis warten, selbst handeln, ist das Gebot der Stunde. Die größte deutsche Naturkatastrophe der letzten Jahrzehnte war im Juli 2021 die Flut im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen mit rund 180 Toten.Feuerwehrleute berichten ein Jahr danach über ihre Erfahrungen. Sie fordern mehr Personal und ausfallsichere Kommunikation. Denn in der Katastrophennacht brachen zuerst das Handynetz und dann der Digitalfunk zusammen. Dominic Kudlacek, Professor für International Safety Management an der Hochschule Bremerhaven, erforscht, wie gute Einsatzkoordination im Katastrophenfall aussieht. Er erprobt mit Studierenden im Selbstversuch, wie viele Vorräte wir tatsächlich brauchen, um 14 Tage ohne Strom und Wasser zu überleben.Der Film blickt nach Österreich, wo die Menschen seit Jahrhunderten mit Lawinen, Hochwasser, Erdrutschen und Unwettern kämpfen. In den entlegenen Tälern sind die Betroffenen manchmal tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Margreth Keiler forscht an der Universität Innsbruck und prophezeit, dass solche Phänomene durch den Klimawandel weiter zunehmen werden. Deshalb hat sie Computermodelle entwickelt, mit denen sich die nächsten Katastrophen und ihre Auswirkungen vorhersagen lassen.“Never let a good crisis go to waste“ – keine Krise soll ungenutzt vertan werden, soll Winston Churchill einst gesagt haben. Eine Krise, die sich inzwischen zum Dauerproblem entwickelt hat, ist Corona. Der Pandemie-Manager der Bundesregierung, Generalleutnant Carsten Breuer, ist überzeugt: Um auf eine Krise optimal zu reagieren, muss man etablierte Regelungen kurzfristig ändern können. Der Bundeswehrgeneral ist trotzdem ein Fan des Föderalismus. Dezentrale Strukturen zwingen Entscheider, vor Ort Lösungen zu finden, die dann möglichst viele mittragen.Krieg war im Herzen Europas bislang keine reale Gefahr. Das hat sich mit der Ukrainekrise geändert. Wie kann sich eine Gesellschaft gegen ständige Bedrohung wappnen? An der medizinischen Fakultät der Universität von Tel Aviv erforscht Katastrophenmanagerin Bruria Adini, wie die israelische Bevölkerung mit Raketenbeschuss, Erdbebengefahr und andere Bedrohungen umgehen soll. Hier ist der Paradigmenwechsel schon vollzogen: Alle lernen, wie sie sofort helfen können. Eine große Rolle spielen dabei moderne Apps und gute Vernetzung. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 06.10.2022 3sat 64. Ökosystem Garten – wie Mensch und Natur profitieren
Folge 64In Pandemie- und Krisenzeiten erfreut sich der Garten neuer Wertschätzung. Grüne Oasen bieten nicht nur Nahrung und Erholung. Das Ökosystem schützt dieArtenvielfalt und entlastet das Klima. Rund 37 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen Garten. Schon ein kleiner Stadtgarten kann einen Beitrag zu mehr Biodiversität leisten. Gartenarbeit fördert die körperliche und seelische Gesundheit. Außerdem macht die Ernte von Obst und Gemüse glücklich. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen, dass immer mehr Menschen ihre Gärten naturnaher gestalten und so wertvolle Biotope entstehen.Flächendeckend nützt zudem der regionale Anbau von Obst und Gemüse dem Klima, weil lange Transportwege entfallen. Gleichzeitig gelten die Anforderungen, die an die Landwirtschaft gestellt werden, hier in besonderem Maß – Wasserverbrauch reduzieren und weniger Dünger und Pestizide einsetzen. Alte Pflanzensorten sollen es richten. Sie haben zwar einen geringeren Ertrag als Pflanzen aus dem Gartencenter, sind jedoch in jeder Hinsicht robuster als Gewächshauspflanzen. Robust – das gilt auch für die Gärtnerinnen und Gärtner. Die Arbeit im Grünen befriedigt das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und Selbstwert. Schon allein der Blick auf das Grün hat erwiesenermaßen eine heilende Wirkung. Der Therapiegarten in der Wiener Klinik Hietzing ist für den Arzt und Psychotherapeut Dr. Fritz Neuhauser mittlerweile das wichtigste Instrument in seiner Arbeit mit depressiven Menschen. Meist kann er die Medikamente seiner Patientinnen und Patienten reduzieren, da das Gärtnern bei Schlafproblemen, Nervosität und Angstzuständen hilft. Auch die kulturellen und sozialen Dimensionen des Gartens spielen in der Forschung eine Rolle. Das gemeinschaftliche Gärtnern schafft Vertrauen und Integration. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 13.10.2022 3sat 65. Moderner Krieg – wie neue Waffen das Militär verändern
Folge 65Intelligente Waffen, neue Taktiken und vernetzte Strategien läuten eine militärische Zeitenwende ein. Drohnen, Satelliten, KI und autonome Systeme entscheiden über Krieg und Frieden. Zahlenmäßige Überlegenheit ist nicht mehr entscheidend. Das zeigt der Krieg in der Ukraine. Die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee gegenüber einer übermächtigen Nuklearmacht hat alle überrascht. Flexibilität und vernetztes Agieren machen den Unterschied. Die Schlagkraft von einfachen Drohnen kann es durchaus mit Luft-Boden-Raketen aufnehmen.Und tragbare Panzerabwehrwaffen wie das amerikanische „Javelin System“ haben den bisherigen Erfolg der ukrainischen Verteidiger maßgeblich mitbestimmt. Einige Beobachter sprechen schon vom Ende des Panzers. Selbstfahrende Kettenfahrzeuge, die je nach Bedarf als Rettungsfahrzeug, Aufklärer, Schützenpanzer oder Drohnenträger eingesetzt werden können, sind wendiger und günstiger. Lange Zeit galt Lufthoheit als Schlüssel für einen militärischen Erfolg. In der Ukraine haben die Russen diese aber nach über einem halben Jahr Krieg noch immer nicht erreicht. Satellitengestützte Aufklärung ist offenbar wichtiger als die Anzahl von Kampfjets. Konstantin Wittwer und Stefan Hoge schauen auf den aktuellen Stand der militärischen Entwicklungen in Europa, Israel und den USA. Sie sind bei einer der größten Übungen der NATO-Streitkräfte dabei und begleiten ein Forschungsteam in Estland bei der Entwicklung neuer autonomer Waffensysteme. Sogenannte Fire-and-Forget-Waffen können, sobald sie ausgelöst sind, Freund und Feind unterscheiden und ihr Ziel selbstständig finden. Und „Loitering munitions“ warten einfach auf den Gegner. Das Völkerrecht hat bislang keine Antworten darauf. Ausgangspunkt der Recherchen waren die ersten Monate des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee gegenüber einer scheinbar übermächtigen Nuklearmacht hat alle überrascht. Dort treffen moderne Strategien auf eine Kriegsführung aus dem 20. Jahrhundert. Was bedeutet dies für das NATO-Bündnis und die Modernisierung der Bundeswehr? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 27.10.2022 3sat 66. Licht aus – Wie Kunstlicht die Natur verändert
Folge 66Wenn Lichtverschmutzung die Nacht zum Verschwinden bringt, gerät ein fundamentaler Taktgeber für das Leben auf der Erde aus der Balance. Tiere und Pflanzen sind durch Kunstlicht bedroht. Viele Organismen haben ihre evolutionäre Nische im Dunkel der Nacht gefunden und müssen sich nun an helle Nächte anpassen. Manchen gelingt das, für viele aber wird die Helligkeit zur Todesfalle. Arten sterben aus. Findet die Wissenschaft Lösungen für das Problem? Tatsächlich sind mehr als die Hälfte aller Tiere nachtaktiv. Ihre Sinnesorgane, ihr Verhalten, ihre Orientierung und ihr Stoffwechsel sind auf Dunkelheit sowie Mond- und Sternenlicht abgestimmt.Zahllose künstliche Lichtquellen in Städten, Dörfern, Industriegebieten, auf Werbeflächen, Straßen und Wegen und selbst im Weltall erzeugen durch Reflexion und Streuung einen diffusen Lichtnebel, den Lichtsmog. Das Kunstlicht stört die natürliche Lebensweise der Tiere und Pflanzen, zerstört Biotope und nicht zuletzt die Artenvielfalt: Die Lichtverschmutzung gilt in der Fachwelt seit Kurzem als eine mögliche Hauptursache für das globale Artensterben. Doch noch immer wird die Dringlichkeit des Themas von der breiten Öffentlichkeit und der Politik unterschätzt. Im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts helfen Menschen in ganz Deutschland beim bundesweit größten Feldexperiment zur Lichtverschmutzung Wasserinsekten zu fangen, zu bestimmen und zu zählen. Franz Hölker, Ökologe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin, und sein Forschungsteam wollen herausfinden, wie viele Tiere in der Todesfalle der Laternen landen. Peter Südbeck, Leiter des niedersächsischen Nationalparks Wattenmeer, eine der immer noch dunkelsten Regionen in Europa, beobachtet bei Zugvögeln seit einiger Zeit eine besorgniserregende Veränderung des Verhaltens. Das Wattenmeer ist ein globaler Verkehrsknotenpunkt, Rast- und Futterplatz für Millionen von Vögeln. Bohrplattformen, Schiffe und Lichtsmog führen dazu, dass die Vögel von ihrer Route abkommen. Immer mehr sind dann so erschöpft, dass sie es nicht mehr zum überlebenswichtigen Rastplatz schaffen. Der Film ist eine Reise durch die Nacht zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, der Natur und nicht zuletzt der Menschheit wieder mehr natürliche Dunkelheit zurückzugeben. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 30.10.2022 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 03.11.2022 3sat 67. Rätsel Long COVID – Der lange Weg zur Heilung
Folge 67Jeder zehnte Deutsche leidet auch noch Wochen und Monate nach einer Coronainfektion unter verschiedenen Symptomen. „Long COVID“ heißt die neue Krankheit, für die es noch keine Heilung gibt. Kurzatmigkeit, schwere Erschöpfung, Muskelschmerzen, Konzentrationsschwäche: Viele Patientinnen und Patienten können monatelang nicht arbeiten, nicht einmal ihren Alltag bewältigen. Weltweit hat die Forschung zu dieser postvirale Erkrankung gerade erst begonnen. An der Berliner Charité untersucht Professor Carmen Scheibenbogen, ob eine fehlgeleitete Immunreaktion die Ursache sein könnte. Sie erforscht, welche bereits zugelassenen Medikamente gegen Long COVID infrage kämen. „Jeder Patient ist anders, es wird nicht die eine Therapie für alle geben. Dazu kommt, dass wir es bislang mit einer Ausschlussdiagnose zu tun haben. Es gibt nicht den einen Biomarker zum Nachweis der Erkrankung“, sagt die Wissenschaftlerin, die aktuell mehrere mit Bundesmitteln geförderte Studien hierzu leitet.Am wenigsten erforscht ist bislang Long COVID bei Kindern und Jugendlichen. Die Häufigkeit der Erkrankung wird bei ihnen mit ein bis 13 Prozent der infizierten Kinder angegeben. Eine aktuelle Long-COVID-Studie zu Therapien und Reha-Maßnahmen leitet Dr. Daniel Vilser von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena. An der Universitätsklinik Erlangen hat Dr. Bettina Hohberger erste Erfolge nach einem Heilversuch mit einem ursprünglich in der Augenheilkunde eingesetzten Medikament. Angesichts der hohen COVID-Infektionszahlen rechnen Expertinnen und Experten mit sehr vielen Long-COVID-Betroffenen. „WissenHoch2“ gibt einen Überblick über die aktuellen Erkenntnisse zu Long COVID und begleitet Patientinnen und Patienten bei ihrem mühsamen Kampf gegen die Krankheit. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 10.11.2022 3sat 68. Hitzestress im Mittelmeer – Ökosystem in Gefahr
Folge 68Mit dem Projekt „Manaia“ sollen Seegraswiesen im Mittelmeer geschützt werden. Dazu sammeln Taucher die Samen der Pflanze.Bild: phoenix/ZDFDas Mittelmeer ist nicht nur eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt, es beherbergt auch zehn Prozent aller Arten. Doch Tourismus, Klimawandel und Industrie gefährden das Ökosystem. Das Mittelmeer erwärmt sich um 20 Prozent schneller als der weltweite Durschnitt. Im Sommer erreicht es Rekordwerte von fast 30 Grad Celsius. Auch der pH-Wert des Wassers sinkt schneller als in anderen Meeren. Eine Gefahr für viele Lebewesen. Mit zunehmender Wassertemperatur werden die Bedingungen für Bakterien und Viren besser, die vor allem eine Gefahr für die Austernindustrie darstellen: Immer wieder kommt es zu Massensterben von Milliarden Jungaustern. Besonders dramatisch sind Hitzewellen.Frédéric Gazeau vom „Institut Français de la Mer“ in Villefranche warnt: „Viele Arten haben eine Wärmetoleranz, die auf etwa 25 bis 28 Grad begrenzt ist. Wenn die Wassertemperatur mehrere Wochen lang über diesen Wert hinausgeht, werden wir mit Sicherheit eine hohe Sterblichkeitsrate bei diesen Organismen haben.“Das Mittelmeer wird nicht nur immer wärmer, auch seine Chemie verändert sich: Kommt CO2 mit Wasser in Kontakt, entsteht Kohlensäure, was letztlich den pH-Wert des Wassers senkt und es somit saurer macht. Wird das Wasser saurer, schadet dies besonders den Meeresbewohnern, die Kalkschalen bilden – wie Muscheln und Flügelschnecken. Doch es gibt auch ein wenig Hoffnung: Am „Laboratoire d’Océanographie“ an der Côte d’Azur wird erforscht, inwieweit Seegras dazu beitragen kann, das Klima zu regulieren und die Umweltveränderungen in den Meeren abzumildern. Eine zentrale Rolle spielen außerdem Meeresschutzgebiete wie das etwa 90.000 Quadratkilometer große Pelagos-Schutzgebiet im Mittelmeer, das eine bemerkenswerte Vielfalt an Wal- und Delfinarten beheimatet. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 17.11.2022 3sat 69. Rituale, Esoterik, Aberglaube: Sinnsuche zwischen Spiritualität und Wissenschaft
Folge 69Die christlichen Kirchen in Deutschland verzeichnen Rekordaustritte. Gleichzeitig halten viele Menschen an Ritualen fest oder suchen nach neuen Glaubensansätzen, die Halt und Lebenshilfe geben. Neben Horoskopen und Sternzeichen gewinnen Stars aus der Lifecoaching-Szene und Ritualdesigner immer mehr Anhänger. Mit neuen Angeboten wie online-Meditation oder individuellen Feiern für Taufe, Ehe oder Tod befriedigen sie das Bedürfnis nach Spiritualität. Anhand der Astrologie prüft die Wissenschaftsdokumentation, was Aberglaube und was Wissenschaft ist, und klärt mithilfe der Kognitionspsychologie die Frage, warum manche Menschen in zufälligen Begebenheiten glauben, Bedeutung zu erkennen.Der Astrophysiker David Gruber sagt: „Astrologie ist keine Wissenschaft, sondern nichts anderes als eine spirituelle Gestirnsreligion.“Spiritualität ist als „Spiritual Care“ auch in der klassischen Medizin angekommen. Die Erkenntnis, dass schwer kranke Menschen auch auf spiritueller Ebene Unterstützung brauchen, ist im Gesundheitswesen inzwischen weithin anerkannt. Die klassische Seelsorge muss heute der religiösen Pluralität gerecht werden und neue Angebote machen. Rituale, Esoterik und Glaube: Oft geht es um Lebenshilfe, darum, das eigene Leben glücklicher gestalten zu können. Im Social-Media-Zeitalter gewinnen die Stars der Lifecoaching-Szene immer mehr Anhänger. Einige von ihnen sind dadurch sehr reich geworden. Sie meditieren online und verschicken aufmunternde Botschaften. Was gelingt ihnen, was den etablierten Religionen und ihren Vertreterinnen und Vertretern nicht gelingt? Rituale enthalten Elemente, die nicht nur kognitiv erfassbar, sondern auch biologisch fühlbar sind. Dabei wirken rhythmische Wiederholungen, Düfte und Musik verstärkend auf das vegetative Nervensystem und das Gehirn ein. Die Neurowissenschaft erklärt, was bei religiösen Erfahrungen im Gehirn passiert – „Neurotheologie“ nennt sich dieses junge wissenschaftliche Forschungsgebiet. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 15.12.2022 3sat 70. Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und warum?
Folge 70Wir halten uns für so aufgeklärt wie nie zuvor. Doch was wissen wir wirklich über Sexualität, Lust und sexuelle Orientierung? Was offenbart die Wissenschaft über unser wandelbares Sexleben? Junge Menschen, die an ihrem biologischen Geschlecht zweifeln. Eine Ehefrau und Mutter, der klar wird: „Ich liebe eigentlich Frauen.“ Betagte Menschen in Pflegeeinrichtungen, die darauf bestehen, ihre Sexualität ausleben zu dürfen: Steht unser Sexualleben Kopf? Sexualität beginnt schon im Mutterleib, begleitet uns bis zum Tod und ändert sich – ein Leben lang.Doch was prägt unsere sexuelle Orientierung und Aktivität stärker: die Gene oder die Umwelt? Obwohl Themen wie sexuelle Diversität und Identität lebhaft diskutiert werden, herrscht zum Teil noch großes Unwissen – selbst über das Lust- und Sexleben der heterosexuellen Mehrheit. Die Wissenschaft weiß inzwischen, dass Kinder lange vor der Pubertät beginnen, ihren Körper zu erkunden, und so mitunter entdecken, dass sie dabei Lust und wohlige Gefühle empfinden. Viele Eltern versuchen, das aus Unsicherheit oder Scham zu unterbinden – und können damit den späteren unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper und der Lust erschweren. Dabei unterscheidet sich kindliche Sexualität grundlegend von der Sexualität Erwachsener, so Sexualpädagogin Anke Erath. „Kindliche Sexualität ist spontan und spielerisch. Kinder entdecken so ihren Körper und den der Altersgenossen.“ Damit gelassen umzugehen und sie gleichzeitig vor unerwünschten Übergriffen älterer Kinder und Erwachsener zu schützen, kann gelingen, wenn Eltern offen mit Kindern über Sexualität sprechen. Manche Erwachsene wenden sich aber auch erschrocken ab, wenn die eigenen Eltern im Pflegeheim einmal körperlich übergriffig werden oder den Wunsch nach Sexualität und Privatsphäre äußern. Ohne professionelle Unterstützung haben alte Menschen in Pflegeeinrichtungen kaum eine Chance, ihre Bedürfnisse auszuleben. Gerade Nähe und Intimität sind im höheren Alter wichtig für psychische und physische Gesundheit, zeigt eine aktuelle Berliner Studie. Und auch für eine funktionierende Beziehung. Nicht wenige Jugendliche, die äußern, in einem Körper mit dem „falschen“ biologischen Geschlecht zu stecken, erfahren, dass ihr Leidensdruck nicht ernst genommen wird. Gleichzeitig nehmen Diagnosen der sogenannten Genderdysphorie seit Jahren explosionsartig zu. Zu einem Großteil sind es Mädchen, die ihr Geschlecht wechseln wollen. Wie kann man sichergehen, dass eine so fundamentale Entscheidung wissenschaftlich fundiert getroffen wird? Die belgische Neuroendokrinologin Julie Bakker hat mit Betroffenen Tests durchgeführt. „In unserer Studie reagierten die Gehirne der Transgenderjugendlichen in bestimmten Situationen so wie die des Geschlechts, mit dem sie sich identifizierten.“ Sich zum eigenen Geschlecht hingezogen zu fühlen, ist in unserer Gesellschaft nicht mehr mit Strafe oder Nachteilen verbunden. Ist das der Grund, warum es immer mehr Outings gibt? Oder ändert sich unsere sexuelle Orientierung im Lauf eines Lebens? So wie sich auch die sexuelle Aktivität verändert? Welche medizinischen oder genetischen Faktoren spielen eine Rolle dafür, ob wir ein aktives, erfülltes Sexualleben führen? (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Di. 03.01.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 12.01.2023 3sat 71. Die Fertigessen-Falle – Wie Tütenprodukte unsere Ernährung verändern
Folge 71 (43 Min.)Convenience-Food aus der Fabrik wird in vielen Großküchen eingesetzt. Schaden die hoch verarbeiteten Lebensmittel unserer Gesundheit, oder sind sie gar qualitativ besser als Selbstgekochtes? Spanische Forschende haben einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr stark verarbeiteter Lebensmittel und hohem Blutdruck nachgewiesen. Fertiggerichte sind oft zu süß, zu salzig und haben Zusatzstoffe wie Aromen, Konservierungs-mittel, Transfettsäuren und Phosphate. Der Fachkräftemangel in Großküchen hat den Einsatz von vorproduzierten Essen verstärkt. Es wird mit fertig geschnittenem und geschältem Gemüse gearbeitet, oft kommen ganze Tellergerichte tiefgefroren aus der Fabrik und werden nur noch aufgewärmt.Die Kundinnen und Kunden merken es kaum. Im Sensoriklabor der Fachhochschule Münster untersucht der Ernährungswissenschaftler Guido Ritter, woran das liegt: Haben wir uns schon zu sehr an den Geschmack von Fertiggerichten gewöhnt? Im Vergleichstest „vom Profi selbst gekocht“ gegen Fertiggericht sind manche Testesser tatsächlich im Zweifel. Selbst in der Küche zu Hause verarbeiten wir viel mehr Fertiggerichte, als uns bewusst ist. Denn frische Ravioli aus dem Kühlregal sind ebenso hoch verarbeitet wie Ravioli aus der Dose. Heißt das automatisch, dass diese Produkte minderwertig sind? Die Hersteller dieser Convenience-Produkte versprechen, dass mit ihren Komponenten das Kochen immer gelänge, hygienisch einwandfrei, schneller und auch noch preiswerter sei. Doch stimmt das wirklich? Der Lebensmittelchemiker Hauke Hilz von der Hochschule Bremerhaven analysiert, warum die Industrie so preiswert arbeiten kann und wie viel Fleisch und Fisch als teure Zutaten wirklich drin sind in einem Fertiggericht. Mit erschreckenden Ergebnissen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 26.01.2023 3sat 72. Der neue Wettlauf ins All – Wie private Firmen den Weltraum erobern
Folge 72Milliardäre wie Elon Musk, Richard Branson und Jeff Bezos sowie Unternehmen weltweit schicken Raketen, Menschen und Technik ins All. Ein neues Space Age bricht an. Wer macht das Rennen? Auch China kämpft mit um die Vorherrschaft im Weltraum. Und seit die NASA 2011 Raketenstarts aus Kostengründen beendet hat, konkurrieren private Unternehmen um ein gewaltiges Zukunftsgeschäft mit Weltraumtourismus, Satellitenbetrieb und Rohstoffabbau im All. Firmen wie Space X, Blue Origin, Axiom Space und viele mehr haben sich bereits heute im Weltraumgeschäft klar positioniert.Unternehmergeist und auch wissenschaftlicher Fortschritt haben den Traum von der menschlichen Eroberung des Alls mehr als 50 Jahre nach der Mondlandung erneut befeuert. Das außerirdische Design-Hotel wird bereits geplant, der Rohstoffabbau im All erprobt. Doch ohne staatliche Weltraumforschung geht es nicht. Die Wissenschaftsdokumentation „Wettlauf ins All“ begleitet exklusiv die Mond-Analog-Mission „ARCHES“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zum sizilianischen Ätna. Dort erproben Forschungsteams die Unterstützung menschlicher Raumfahrtmissionen mittels Robotertechnologie. Schon heute ist klar: Damit eines Tages Menschen auf anderen Planeten landen können, müssen wissenschaftliche Missionen wie diese erfolgreich sein. Es zeichnet sich auf allen Ebenen ab: Der neue Wettlauf ins All hat begonnen. „WissenHoch2“ – ein Thema, zwei Formate: Um 20:15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21:00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit einem interdisziplinären Team von Experten. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 09.02.2023 3sat
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail