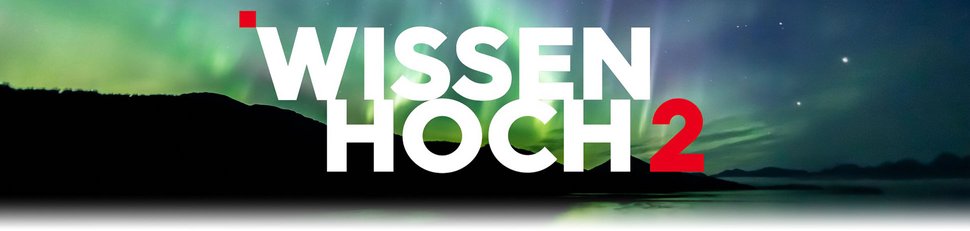119 Folgen, Folge 73–96
73. Mein Avatar und ich: Wie KI Bewusstsein erlangt
Folge 73Waren Maschinen früher nur Helfer, werden sie heute zu Weggefährten. Der Mensch spricht mit seinem Auto oder mit Alexa. Akzeptieren wir die Technik mehr, je ähnlicher sie uns wird? Künstliche Intelligenzen haben Beethovens 10. Sinfonie vollendet, die Faltung von Proteinen entschlüsselt und können in Debatten mithalten. Welche Beziehung haben wir zu sozialen Robotern, die als Servicekräfte bedienen oder Pflegebedürftige unterhalten? Ingolf Baur ist für die Wissenschaftsdokumentation „Mein Avatar und ich“ unterwegs und fragt, was ein Roboter haben muss, damit der Mensch bereit ist, ihn als sozialen Partner zu akzeptieren.Mit Agnieszka Wykowska, Psychologin, Hirnforscherin und Philosophin am „Italienischen Institut für Technologie“ in Genua, bespricht Ingolf Baur Fragen wie „Braucht es ein Gesicht, oder muss die Maschine Gefühle verstehen oder gar zeigen können?“ Agnieszka Wykowska meint: „Wir tendieren dazu, alles zu vermenschlichen. Wir sehen sogar Gesichter in Autofronten. Das wird noch verstärkt, wenn ein Roboter menschenähnliches Verhalten zeigt.“ In einem Altenheim in Rendsburg erlebt Ingolf Baur, welche Beziehung Pflegebedürftige zu Robotern aufbauen. Hannes Eilers von der FH Kiel testet dort den Robotereinsatz im Auftrag der Ersatzkassen. Die Roboter singen mit den betagten Menschen, spielen Spiele mit ihnen oder demonstrieren Physioübungen – nur beten dürfen sie nicht mit ihnen. Die Systeme dort funktionieren autonom. Das bedeutet, sie können nicht auf einen KI-Server im Hintergrund zugreifen, sind damit aber datenschutzrechtlich unbedenklich. KI-Server im Hintergrund steuern aber schon sehr viel von unserer Kommunikation. Sie machen nicht nur Vorschläge, was wir als Nächstes lesen, essen oder kaufen sollten: Es gibt auch „Chatbots“, die als persönliche Ansprechpartner dienen. In Boston trifft Ingolf Baur Hossein Rahnama. Der perfektioniert am Massachusetts Institute of Technology (MIT) das Aussehen und die Kommunikation mit solchen Chatbots. Er glaubt: „Wir können mittlerweile auf solche Rechenleistungen und Datenmengen zugreifen, dass wir eine digitale Version jeder Person, auch von Ingolf Baur, erschaffen und sie bald sogar empfindungsfähig werden lassen können.“ Werden wir in Zukunft unterscheiden können, ob Ingolf Baur aus Fleisch und Blut vor der Kamera steht oder sein digitaler Klon? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.03.2023 3sat 74. Bye-bye Beton – Nachhaltiges Bauen fundamental neu denken
Folge 74Stahl und Beton sind das Fundament unserer modernen Welt. Doch der Alleskönner unter den Baustoffen hat einen hohen Preis, seine Klimabilanz ist verheerend. Bauen muss neu gedacht werden. Bei der Zementherstellung für Beton werden in Deutschland rund 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen. Erste innovative Projekte zeigen Alternativen für nachhaltiges Bauen. Aber können Holz, Lehm und Fasern tatsächlich flächendeckend Stahlbeton ersetzen? Traditionelle Baustoffe wie Holz oder Lehm werden dank konsequenter Digitalisierung als neue Hightech-Materialien wiederentdeckt. In der modernen Gesellschaft erscheint Lehm als exotischer Baustoff der Vergangenheit.Doch viele sehen in ihm ein Baumaterial der Zukunft und eine ökologische Alternative zu Beton. Während im österreichischen Schlins ein Haus aus Stampflehm entstehen soll, hat Gnanli Landrou von der ETH Zürich eine spezielle Lehm-Mixtur entwickelt, die sich genauso verarbeiten lässt wie Beton. Auch organische Materialien wie Holz haben einen großen Vorteil gegenüber Beton: Ihre Verwendung spart nicht nur Energie ein, sondern produziert sogar negative Emissionen. Der Physiker Hans Joachim Schellnhuber ist überzeugt: „Wenn wir jetzt die Bäume nutzen, indem sie über Photosynthese das CO2 wieder rausziehen, bauen wir unsere künftigen Gebäude, ja ganze Städte aus Luft-CO2.“ Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU München gehen sogar noch einen Schritt weiter: Bei ihrem Baubotanik-Projekt werden die Bäume selbst Teil der Architektur. Andernorts gibt es Ideen, die das Bauen mit biogenen Fasern radikal neu denken. Die Dokumentation „Bye-bye Beton“ stellt mit einer Reise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz die spannendsten Projekte, Baustellen und Gebäude vor. Innovative und nachhaltige Konzepte sowie alltagstaugliche Beispiele zeigen, was schon heute möglich ist – und was morgen vielleicht schon Standard sein wird. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 23.03.2023 3sat 75. Im Bann des Mondes – Leben mit Gravitation und Gezeiten
Folge 75 (45 Min.)Ob bei Ebbe und Flut, der Nachtruhe oder dem Paarungsverhalten bei Tieren: Der Mond hat seine unsichtbare Kraft im Spiel. Doch der Erdtrabant hat noch weit mehr Macht über unseren Planeten. Der Mond bewegt Ozeane und hat gleichzeitig Einfluss auf die Geschwindigkeit der Erdumdrehung. Ohne den Mond hätte ein Tag nur acht Stunden – unser Leben sähe also ganz anders aus. Auch verschiedene Tierarten lassen sich in ihrem Lebensrhythmus vom Mond leiten. Ohne den Mond würde sich die Erde nicht nur schneller drehen, auch ihre Ausrichtung würde sich maßgeblich ändern.Denn durch seine Anziehungskraft stabilisiert der Mond die Erdachse und sorgt so für verlässliche Jahreszeiten auf unserem Planten. Auch die Gezeiten spielen für das Leben auf der Erde eine zentrale Rolle: Sie erzeugen klimastabilisierende Strömungen, definieren unser Landschaftsbild und haben die Evolutionsgeschichte beeinflusst. In Frankreich und Indien lässt sich die Kraft des Mondes sogar in Form einer spektakulären Gezeitenwelle, die sich entgegen der Flussströmung bewegt, beobachten. Viele Tierarten richten ihre biologische Uhr nach den Mondphasen aus: Im Labor können der Korallenforscher Anthony Bertucci und sein Team nachvollziehen, inwieweit das Mondlicht den Fortpflanzungszyklus von Korallen bestimmt. Auch in Australien, genauer gesagt auf der Weihnachtsinsel im Indischen Ozean, lässt sich ein atemberaubendes Naturspiel beobachten, das mit dem Mond in Verbindung steht: Jedes Jahr zwischen Oktober und November wimmelt es dort von Millionen Roter Landkrabben, die auf dem Weg zum Meeresufer sind. Einmal am Wasser angekommen, beginnt ein Millionen Jahre alter Fortpflanzungsritus, wobei die Weibchen ihre befruchteten Eier im Meer ablegen. Die Krebse wissen instinktiv, dass der Meeresspiegel während dieser Zeit, kurz vor dem Neumond, am günstigsten steht. Welchen Einfluss hat der Erdtrabant noch auf das Leben auf unserem Planeten? Und wie lässt sie sich erklären, die geheimnisvolle Macht des Mondes? Diesen und anderen Fragen geht die Dokumentation „Im Bann des Mondes“ nach. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Di. 28.03.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 30.03.2023 3sat 76. Braucht die Welt Kryptogeld? – Harald Lesch sucht Antworten
Folge 76Die Vision von Kryptowährungen erzählt nicht von schneller Rendite, sondern von einer Technologie, die für mehr Macht über unser Vermögen und für mehr globale Gerechtigkeit sorgen könnte. Neben Bitcoin gibt es eine Reihe weiterer Kryptowährungen. Und mit ihnen auch die Krypto-Millionäre: Wer früh in die neuen digitalen Währungen investierte, konnte über Nacht reich werden. Doch der Traum vom schnellen Geld ist für die meisten erst einmal verpufft. Auf den Krypto-Frühling folgt ein Krypto-Winter. Im Frühjahr 2022 brechen die Kurse ein. Altgediente Finanzfachleute warnen erneut: Das digital erzeugte Geld sei nicht mehr als die nächste große Blase.Stimmt das? Und hat nicht jede Münze auch eine zweite Seite? Und mit der sich selbst Sparen wieder lohnen soll in einer Zeit, in der die Inflation die Stabilität vieler Währungen infrage stellt. Was ist dran an diesen Versprechen? Und was kosten die Kryptowährungen tatsächlich? Sind sie klimapolitisch verträglich? Brauchen wir sie wirklich? Werden die Algorithmen von Kryptowährungen unser Leben verändern? Harald Lesch begibt sich als kritischer Wissenschaftler auf die Reise und sucht Antworten auf all diese Fragen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 20.04.2023 3sat 77. Eifersucht – Urgefühl oder Beziehungskiller?
Folge 77 (45 Min.)Eifersucht ist eine Emotion, die Menschen schon im Alter von sechs Monaten empfinden können. Ihre Ausprägung ist jedoch individuell und reicht bis zur wahnhaften, mitunter tödlichen Wut. Eifersucht ist ein höchst zwiespältiges Gefühl. Sie kann Freundschaften, Partnerschaften und Familienbande schützen – oder zerstören. Sie kann zu mehr Wertschätzung, Leistungsbereitschaft und Selbstreflektion führen – oder Selbstzweifel, Wut und Angst auslösen. Tatsächlich ist Eifersucht ein noch wenig erforschtes Gebiet der Psychologie. Und das, obwohl sie in so vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt: „Eifersucht findet überall dort statt, wo es um Beziehungen geht.Das kann zum Beispiel am Arbeitsplatz sein. Eifersucht kann aber auch unter Geschwistern auftreten oder unter Gleichaltrigen in der Schule“, so Susanne Döll-Hentschker, Professorin für Psychotherapie an der Hochschule Frankfurt. Übersteigerte Eifersucht kann sich kontraproduktiv auf jede Art von sozialem Miteinander auswirken, und in einigen Fällen zerstören Eifersüchtige sogar Leben. „Fremdgefährdung, aber auch Selbstgefährdung, das ist bei der Eifersucht immer ein Thema“, beobachtet der Psychiater Harald Oberbauer. Er leitet eine Eifersuchtssprechstunde in den Tirol Kliniken in Innsbruck. Wie präsent die Emotion im Alltag ist, zeigt auch eine Onlinebefragung von Civey, die mit über 5000 Personen exklusiv für 3sat durchgeführt wurde. Hier geben rund 20 Prozent der Menschen an, grundsätzlich eifersüchtig zu sein. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 33 Prozent. Niemand möchte gern eifersüchtig sein. Es fühlt sich an wie eine Charakterschwäche. Dabei spornt ein gesundes Maß an Eifersucht an, wie Studien zeigen. „Eifersucht ist das Salz in der Suppe“, sagt Harald Oberbauer und meint damit, dass Eifersucht die Wertschätzung einer Beziehung zeigt. Eifersucht kann auch Freundschaften beleben, denn als Alarmzeichen fördert sie freundschaftserhaltende Maßnahmen. Das gilt auch generell: Eifersucht kann ein Hinweis dafür sein, dass etwas gerade in der Beziehung nicht stimmt. Ein guter Zeitpunkt also für Selbstreflektion. Können auch Tiere eifersüchtig sein? Im Wiener Forschungsinstitut „Clever Dog Lab“ soll ein Experiment mit Hunden helfen, das herauszufinden. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 07.05.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 11.05.2023 3sat 78. Unsere Hand – Geniestreich der Evolution
Folge 78 (44 Min.)Mit jeweils 27 Knochen sind Hände ein anatomisches Wunderwerk. Wir können mit ihnen schreiben und Dinge erschaffen, dank der Feinmotorik sind unsere Hände ein perfektes Multifunktionswerkzeug. Computer verdrängen Handarbeit, Handys ersetzen den Kugelschreiber. Dabei sind unsere Hände und Finger an Feinmotorik und Sensorik kaum zu übertreffen. Und oft lassen erst Unfälle oder Erkrankungen den Wert dieses einzigartigen Super-Organs erkennen. Unsere Hände können schwere Dinge heben, fest zugreifen oder ganz präzise einen Stift übers Papier führen. Mit unseren Fingern können wir tasten, streicheln – oder in Windeseile über die Tasten eines Klaviers fliegen.An der Deutschen Sporthochschule Köln untersucht Ingo Froböse mit seinem Team anhand von Leistungstests bei E-Sportlerinnen und -Sportlern erstmals wissenschaftlich, welche Hand- und Fingerfertigkeiten sie bei ihrem Sport entwickeln und wie sich diese Fähigkeiten stärken lassen. Die Hand ist auch eine Art Sinnesorgan, mit dessen Hilfe sich alltäglich Sehbehinderte orientieren können. In den Fingerbeeren befinden sich zahlreiche Tastkörperchen. Sie lassen die Haut darüber mehr empfinden als an anderen Stellen des Körpers. Doch vor allem, wenn eine Hand durch einen Unfall oder durch Amputation verloren geht, erkennen Menschen den Wert der Hand. Neurobiologinnen und Neurobiologen weltweit arbeiten an der Entwicklung von Prothesen, die Betroffene wieder mit allen Fingern greifen und fühlen lassen können. Die Wissenschaftsdokumentation „Unsere Hand – Geniestreich der Evolution“ folgt Kindern beim schwierigen Prozess des Schreibenlernens, beobachtet eine erfahrene Pianistin bei ihrer feinmotorischen Leistung und zeigt, wie unser Leben buchstäblich in unseren Händen liegt: beim Bouldern. Was passiert dabei in den Händen und im Gehirn in Millisekunden? (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mi. 24.05.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 25.05.2023 3sat 79. Heilung für chronisch Kranke? – Vom Profit zur Prävention
Folge 79Rund 40 Prozent der Menschen in Deutschland leiden an einer chronischen Krankheit, manche über Jahrzehnte. 25 Millionen gesunde Lebensjahre gehen uns dadurch jedes Jahr verloren. Die Auslöser von chronischen Erkrankungen sind häufig ein Wechselspiel von Genen, Umweltfaktoren und Lebensstil. Die Folgen belasten alle: die Betroffenen, die Gesellschaft und die öffentlichen Kassen. Wie könnte ihnen besser geholfen werden? Allein die Behandlung der aktuellen Diabetes-Typ-2-Patientinnen und -Patienten kostet 21 Milliarden Euro pro Jahr – und jeden Tag kommen 1600 Erkrankte dazu. Dabei könnte Früherkennung verbunden mit einer Änderung des Lebensstils und einer besseren medizinischen Begleitung häufig die Chronifizierung verhindern.„Wenn man auf das deutsche Gesundheitssystem blickt, dann sind gerade chronisch Kranke bei uns eher schlecht oder schlechter versorgt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir ein sehr stark zergliedertes Gesundheitssystem haben“, mahnt der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrates für Gesundheit und Pflege, Prof. Dr. Ferdinand Gerlach. Untersuchungen, Therapien und die Behandlung von Folgeschäden bringen viel Geld ein. In einem Gesundheitssystem, das auf Akutversorgung ausgerichtet ist, rechnen Krankenkassen sowie Ärztinnen und Ärzte in Deutschland auch bei chronisch Erkrankten viele Leistungen einzeln ab. Dabei kommt es nicht selten zu einer Überversorgung, die jedoch die Krankheit nicht verhindert und am Ende die Gesundheitsausgaben in die Höhe treibt. Aktuelle Studien zur Behandlung von Depressionen zeigen, dass auch hier Früherkennung statt Stigmatisierung wichtig für die Therapie wäre. Doch es gibt in Deutschland zu wenige Psychotherapeuten mit Kassenzulassung. Wie unspezifische Rückenschmerzen besser behandelt werden können, macht die Schweiz vor: Physiotherapeuten und Orthopäden aus verschiedenen Praxen kooperieren – zum Wohl ihrer Patienten. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 28.05.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 01.06.2023 3sat 80. Cybercrime: Wie können wir uns schützen?
Folge 80Obwohl Experten seit Jahrzehnten versuchen, unsere IT-Systeme zu sichern, verursachen Cyberangriffe mittlerweile dreimal mehr Schäden als Naturkatastrophen. Warum sind wir so verwundbar? Regierungen, Unternehmen, kritische Infrastruktur – nichts ist mehr vor Cyberangriffen sicher. Der Ukrainekrieg hat die Lage noch verschärft. Besonders Deutschland mit seiner starken Wirtschaft ist ein beliebtes Ziel von Hackern, Kriminellen, aber auch Staaten. Die Forschenden suchen nach unseren wunden Punkten. Sie werden überall fündig: Bei Kommunen gibt es grob fahrlässige Schwachstellen, die sperrangelweit offenstehen. Eine von ihnen muss 2021 sogar den Katastrophenfall wegen eines erfolgreichen Angriffs ausrufen.Der Deutsche Bundestag selbst wird zur Zielscheibe von professionellen Hackergruppen, finanziert aus Russland. Selbst in der Hardware suchen die Forschenden mittlerweile nach geheimen Hintertüren. Sind unsere Geräte schon von Staaten manipuliert worden, noch bevor sie bei uns landen? Ist das schon ein Cyberkrieg – und wenn ja, wie können wir uns schützen? Warum ist es so schwer, ein IT-System wirklich cybersicher zu machen? Und wie werden neue Technologien wie Quantencomputer und KI den ewigen Wettlauf zwischen Hackern und Verteidigern verändern? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 15.06.2023 3sat 81. Geschwister: Liebe, Hass, Rivalität – Eine Beziehung fürs Leben
Folge 81 (45 Min.)Beziehungen zwischen Geschwistern sind vielschichtig und prägen Familien – und das ganze Leben. Die Wissenschaft sammelt neue Erkenntnisse darüber, wie weit dieser Einfluss gehen kann. Ob Vorbild-, Spiegel,- oder Distanzierungsfunktion – mit Geschwistern trainieren wir emotionale, moralische und soziale Fähigkeiten. Im ständigen familiären Kontakt mit ihnen formt sich die Persönlichkeit. Welche Einflüsse spielen dabei die größte Rolle? Der Schweizer Psychologe und Geschwisterforscher Jürg Frick erlebt als Therapeut, wie vielfältig die Rollen sein können, die Brüder und Schwestern im Leben einnehmen können.Was darauf einen großen Einfluss hat: das Geschlecht, der Altersabstand, aber auch die Erziehung. In der frühen Geschwisterforschung der 1920er-Jahre hat der österreichische Psychologe Alfred Adler zunächst noch die Geschwisterkonstellationen untersucht. Die Annahme war: Erstgeborene sind verantwortungsbewusster, sogenannte Sandwichkinder – die mittleren Geschwister – kooperativer und die Nesthäkchen risikofreudiger. Doch stimmt das? Die Persönlichkeitsforscherin Julia Rohrer von der Universität Leipzig hat dazu in mehreren Untersuchungen erstmals große internationale Datensätze von Langzeitstudien ausgewertet. Ihre Forschungsergebnisse zeigen: Die Position in der Geschwisterkonstellation hat weniger Einfluss auf die Persönlichkeit als bislang gedacht. Ein Punkt sticht jedoch heraus: Studien zeigen, dass Frauen, die mit jüngeren Brüdern aufwuchsen, im Beruf weniger verdienen als solche mit jüngeren Schwestern. Woran das genau liegt, soll in weiteren Untersuchungen erforscht werden. Medizinische Forschung macht es heutzutage möglich, dass Geschwister sogar schon als Lebensretter zur Welt kommen. So wie Jamie Whitaker aus England – er wurde künstlich gezeugt, um mit seinem Erbmaterial seinem schwer kranken Bruder Charlie helfen zu können. Beide sind heute erwachsen und gesund. Doch welche Folgen hat dieser Eingriff – der in Deutschland nicht erlaubt ist – für ihre Geschwisterbeziehung? Immer mehr Bedeutung gewinnen auch Studien mit eineiigen Zwillingen. Es besteht die Hoffnung, drängende medizinische Fragen unserer Zeit beantworten zu können: Wodurch werden etwa Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Long COVID beeinflusst? Sind genetische Faktoren entscheidend – oder eher äußere Einflüsse? (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mo. 19.06.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 22.06.2023 3sat 82. Evolution der Blütenwelt – wie Blumen die Erde erobern
Folge 82 (43 Min.)Blumen haben selbst lebensfeindliche Standorte unseres Planeten erobert. Heute machen sie 90 Prozent aller Landpflanzenarten aus. Wie konnte sich diese erstaunliche Vielfalt entwickeln? Trotz zarter Erscheinung sind Blumen Überlebenskünstler – echte „Flower-Power“. Forschende entschlüsseln ihre Geheimnisse in der Wüste Namibias, auf Alpengipfeln und Inseln im Südpazifik. Darwins Ururenkelin, die Botanikerin Sarah Darwin, teilt die Faszination. In Neukaledonien und Namibia suchen heute die Molekularbiologin Valérie Burtet-Sarramégna und der Genetiker François Parcy nach prähistorischen Pflanzen.Sie hoffen, dass die Entschlüsselung ihres genetischen Codes das Geheimnis des Ursprungs der Blütenpflanzen lüften wird. Im Botanischen Garten in Zürich und im Mont-Blanc-Massiv versuchen die Biologen Florian Schiestl und Sébastien Lavergne, die schwindelerregende Formen- und Farbenvielfalt der Blumenwelt zu verstehen. Ihre Forschungen zeigen die Rolle der Bestäuber und der geografischen Isolation bei der erstaunlich schnellen Diversifizierung der alpinen Blütenpflanzen. Schon für Charles Darwin selbst, den Begründer der Evolutionstheorie, war die Frage, wie Blütenpflanzen entstanden sind, ein „abominable mystery“, ein unfassbares Rätsel. So beschreibt er es 1879 in einem Brief. Darwin hat die Frage nach dem Ursprung und der Evolution der Blütenwelt ein Leben lang gefesselt. Heute untersucht Evolutionsbiologin Edwige Moyroud die Blüte des Hibiskus und zeigt, dass Blütenpflanzen die Beugung von Lichtwellen manipulieren können, um bestäubende Insekten anzulocken. Und in Israel forscht die Expertin für Phytoakustik Lilach Hadany mit modernster Technologie, um eine ungeahnte Superkraft der Blumen zu entdecken: ihre Fähigkeit, Geräusche zu erkennen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 31.08.2023 3sat 83. Die vielen Gesichter der Gewalt: Wege aus der Aggression
Folge 83 (44 Min.)Angriffe auf Einsatzkräfte, Schlägereien auf Schulhöfen: Die Spirale der Gewalt startet immer früher. Was passiert im Gehirn, wenn Menschen ihren Aggressionen freien Lauf lassen? Obwohl wir vermeintlich in einer Kultur leben, die Gewalt ablehnt und versucht, Konflikte konstruktiv und friedlich zu lösen, ist Gewalt ein Teil unseres Zusammenlebens und unseres Alltags. Schlummert die Tendenz zur körperlichen Auseinandersetzung in jedem von uns? Die Wissenschaft forscht an unterschiedlichen Ursachen der Gewalt: Die anthropologische Seite schließt vom Verhalten der Menschenaffen auf uns Menschen.Die Evolutionsbiologie ergründet, warum wir „Steinzeitverhalten“ immer noch instinktiv in uns tragen – wo doch unsere Kultur so viel weiterentwickelt ist. Trotzdem müssen zum Beispiel jedes Jahr etwa 900 Fußballspiele im Amateurbereich wegen Übergriffen abgebrochen werden. Neurobiologinnen und -biologen forschen an Hormonen, die aggressives Verhalten auslösen oder dämpfen können und welche Regionen im Gehirn bei der Ausübung von Gewalt aktiviert werden. Liegt dort der Schlüssel, um uns das „Gewaltpotenzial“ zu nehmen? „Das Talent, also die Bereitschaft zur Gewalt, ist in uns allen angelegt“, sagt Neurobiologin Dr. Karin Rüttgers. Soziologen und Soziologinnen erforschen die gesellschaftlichen Ursachen für Gewalt wie mangelnde Integration oder Chancengleichheit. Welche Rolle spielt die institutionelle Gewalt in unserer Gesellschaft? Die 3sat-Wissenschaftsdokumentation „Die vielen Gesichter der Gewalt“ begleitet das Projekt „Kurve kriegen“ – ein in Deutschland einzigartiges Projekt von Sozialarbeit und Polizei, das bereits mehr als 1000 Kinder und Jugendliche erfolgreich absolviert haben. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 10.09.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 14.09.2023 3sat 84. Inflation: Das gierige Biest
Folge 84 (45 Min.)Inflation: In Deutschland ein Trauma seit der Hyperinflation von 1923. Heute treiben Milliardenschulden aus Coronapandemie, Ukrainekrieg und Klimakrise die Preise erneut in die Höhe. Dabei gehört Inflation schon immer zur Wirtschaft – genauso wie ihre sozialen Folgen. Wenn die Preise für den alltäglichen Bedarf wie Energie, Mieten und Lebensmittel steigen, haben Verbraucher zum Monatsende weniger Geld auf dem Konto. Um die Mehrausgaben zu kompensieren, müssten die Löhne steigen. Landesweit streiken Beschäftigte darum schon seit Monaten für mehr Geld. Doch höhere Gehälter bedeuten für die Unternehmen auch höhere Kosten, die sie wieder auf die Warenpreise abwälzen.Das Ergebnis: Alles wird noch teurer. Die Lohn-Preis-Spirale kommt in Gang. „Im Unterschied zur Hyperinflation der 1920er-Jahre haben wir heute nicht nur einen Preisschock, sondern gleich mehrere. Energie ist teurer geworden, aber auch viele Rohstoffe und Lebensmittel. Die Situation heute ist viel komplizierter als damals“, meint etwa die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabella Weber. Und noch etwas könnte die Inflation antreiben: Konzerne, die Preise künstlich in die Höhe treiben und so Rekordgewinne erzielen – eine „Gierflation“ also. Doch bei jeder Inflation gibt es auch Gewinner. Wer ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, macht in der Regel Schulden. Und wer Schulden hat, dem kann steigende Inflation helfen. Die größten Schuldner dieser Welt sind Staaten. Was tun sie, um die Geldentwertung in den Griff zu bekommen? Die Dokumentation „Inflation – Ein gieriges Biest“ beschäftigt sich neben der aktuellen Situation an der Preisfront auch mit historischen Inflationen etwa in den 1970er-Jahren, spürt Profiteuren der Preissteigerungen nach und fragt, ob Immobilien oder gar Kryptowährungen sichere Bollwerke gegen die Inflation oder reine Spekulationsblasen sind. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 24.09.2023 3sat-Mediathek Deutsche TV-Premiere Do. 28.09.2023 3sat 85. Smarte Insekten – Wie winzige Gehirne Geniales leisten
Folge 85 (45 Min.)Der Kern eines Bienenstockes sind die Brutwaben. Die Königin legt täglich bis zu 2000 Eier.Bild: phoenix/ZDF/Oliver KratzOb Wespen, Bienen, Hummeln oder Ohrwürmer: Ihre Gehirne sind winzig, doch sie sind hochintelligent. Sie können Gesichter erkennen, perfekt navigieren und schwierige Denkaufgaben lösen. Neueste Forschung zeigt: Wir haben Insekten lange unterschätzt. Hummeln etwa bestehen Verhaltenstests, die auch intelligente Krähen schaffen. Sie nutzen Werkzeuge, um an Zuckerwasser in einer Kunstblüte zu kommen. – Reise in den Mikrokosmos der intelligenten Insekten. Auch die Verhaltensbiologin Elizabeth Tibbetts wundert sich immer wieder, wie viel ihre Papierwespen lernen und verstehen. „Sie sind zwar keine Universalgenies wie Künstler, aber in ihren Bereichen sind sie brillant“, sagt die Forscherin der Universität von Michigan.Die Tiere können Gesichter abspeichern, Kämpfe von Gegnerinnen analysieren und strategisch denken. Denksportaufgaben, die selbst Kleinkinder nicht lösen können, bewältigen sie. Hummeln, die mit ihnen verwandten Bienen und Papierwespen sind nur drei von fast einer Million Insektenarten weltweit. Aber bei diesen Spezies ist sich die Wissenschaft einig: Das Bild von roboterhaften Wesen ohne Intelligenz, die nur zum Fressen, zum gefressen werden oder zum Zeugen von Nachwuchs existieren, ist veraltet. Unter, über und neben uns leben winzige Tiere, die lernfähig sind und smart agieren, die Bilder, Formen, Farben und Erfahrungen in ihrem Gehirn abspeichern können. Lange Zeit war die Ansicht verbreitet, intelligentes Verhalten bei Insekten sei auch deswegen überflüssig, weil die meisten im Schnitt nur wenige Wochen leben. Ohrwurmbabys mit einer Lebenserwartung von circa einem Jahr lernen offenbar von ihren Müttern die richtige Brutpflege. Was noch überraschender ist: Insekten eines Geleges können sogar unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale ausprägen. Bei Meerrettichblattkäfern etwa sind manche mutiger als ihre Artgenossen. Und „Papierwespen sind so zickig wie die Protagonisten der Streaming-Serie ‚Game of Thrones‘“, hat Evolutionsbiologin Elizabeth Tibbetts beobachtet. Die Tiere würden Intrigen schmieden, Kolleginnen verraten, und der Kampf um die Rolle der Königin würde bis aufs Blut ausgetragen. Dass die Welt der Insekten vielschichtiger ist als angenommen, hat offenbar einen Grund: Eine Spezies, deren Individuen divers sind, kann sich besser an Umweltveränderungen anpassen – und das ist ein evolutionärer Vorteil für das Überleben der Art. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere So. 08.10.2023 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 12.10.2023 3sat 86. Hoffnung Kernfusion? Der Traum von unendlich viel sauberer Energie
Folge 86 (45 Min.)Eine Technologie, heißer als die Sonne! Kann Kernfusion unendlich viel saubere Energie erzeugen? Im Unterschied zur Kernspaltung sind die Umwelt- und Sicherheitseigenschaften günstig. So erzeugen die Sonne und andere Sterne Energie: In einem riesigen Plasmaball brennt ein Fusionsfeuer, in dem Wasserstoffatomkerne zu Helium verschmelzen. Das setzt sehr viel Energie frei. Die Fusionsforschung versucht, diese Prozesse auf der Erde nachzubilden. Dieses Bestreben wird von dem Megaprojekt ITER angeführt, einer internationalen Zusammenarbeit im Wert von 20 Milliarden Dollar.Rund fünftausend Menschen aus Wissenschaft und Technik in aller Welt arbeiten am ITER, um ein gigantisches Puzzle zusammenzusetzen, das aus mehr als einer Million Komponenten besteht. Die Forschung dauert schon Jahrzehnte an, aber es ist unglaublich schwierig, Kernfusion in einem Umfang zu betreiben, so dass am Ende mehr Energie gewonnen als zum Einleiten der Fusion benötigt wird. In der Sonne erzwingen Hitze und Druck das Verschmelzen von Atomkernen. Auf der Erde gibt es dazu zwei Verfahren: Magnet- und Laserfusion. Zusammen mit einem deutschen Großprojekt, W-7X, gibt es eine neue Welle von Start-ups, die darum wetteifern, als erste saubere, unerschöpfliche Energie herzustellen. Der Film erklärt, wie die Kernfusion funktioniert und welche Rolle sie in der europäischen Energielandschaft spielen könnte, welche Herausforderungen damit verbunden sind, worin der Unterschied zwischen Kernspaltung und Kernfusion besteht und ob dies die Lösung für den Energiehunger von uns Menschen ist. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 02.11.2023 3sat 87. Elementarteilchen – Wie sie unsere Welt durchdringen
Folge 87 (45 Min.)Alle Materie besteht aus Elementarteilchen. Das sind die kleinsten, unteilbaren Teilchen in Atomen. Manche können Materie sogar durchdringen. Das nutzen wir in vielen Alltagsanwendungen. Elementarteilchen sind unsichtbar, doch ihre Fähigkeiten sind allgegenwärtig in unserem Leben. Ohne Elementarteilchen gäbe es zum Beispiel keine Röntgengeräte, keine Computertomographen, kein Internet, keinen elektrischen Strom. Kennen wir schon alle Elementarteilchen? Weil manche Elementarteilchen Materie durchdringen, ohne sie dabei zu zerstören, sind sie für wissenschaftliche aber auch medizinische Anwendungen ein Segen.Sie entschlüsseln die Proteinstruktur von Viren oder zeigen uns Hohlräume in den ägyptischen Pyramiden. Wenn es am Forschungszentrum Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) gelingt, Lichtteilchen durch Materie zu schicken, könnte dies der Beweis für ein neues bislang unbekanntes Elementarteilchen sein. Warum dies wichtig ist? Wir wissen noch immer nicht, woraus circa 85 Prozent der Materie im Universum besteht. Wir nennen sie Dunkle Materie. Wenn wir verstehen, woraus sie besteht, wissen wir nicht nur, was die Welt im Innersten sondern auch das Universum im Äußersten zusammenhält. Prof. Christian Schwanenberger und andere führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen zum DESY in Hamburg sowie zur Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf in die Tunnel, Labore und zu den Feldforschungen. Nebenbei erzählt „WissenHoch2“ die Geschichte der Teilchenphysik und von prägenden Köpfen wie Wilhelm Conrad Röntgen oder Peter Higgs. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 09.11.2023 3sat 88. Heilen mit Hypnose: Was passiert in Kopf und Körper?
Folge 88 (45 Min.)Ist Hypnose wirksame Therapie oder pure Show? Die Wissenschaftsjournalistinnen Jasmina Neudecker und Mai Thi Nguyen-Kim starten ein Selbstexperiment: Wird Hypnose ihre Probleme lösen? Hypnose fokussiert die Aufmerksamkeit und setzt Prozesse frei, die im Wachzustand kaum möglich sind. Unter Hypnose vergessen Menschen ihren Namen und wie man richtig zählt – aber sie geben auch das Rauchen auf, überwinden Ängste und können ohne Narkose operiert werden. Die beiden Wissenschaftsjournalistinnen treffen die Neuropsychologin Barbara Schmidt. Sie erforscht am Uniklinikum Jena, wie Hypnose funktioniert und wie sie sinnvoll in der Medizin und in der Angsttherapie eingesetzt werden kann.Jasmina und Mai Thi machen einen Selbstversuch: Barbara Schmidt testet ihre Suggestibilität und versetzt sie anschließend in Hypnose. Inwieweit lassen sich die beiden Moderatorinnen darauf ein, und wie leicht sind sie hypnotisierbar? Kann Mai Thi mithilfe der Behandlung ihre Spinnenphobie überwinden und Jasmina auf Süßes verzichten? Parallel begleitet der Film Barbara Schmidt für ihre neue Studie ins niedersächsische Walsrode, wo sie Menschen, die künstlich beatmet werden müssen, mit Hypnose hilft, sich angstfrei von dem Beatmungsgerät zu lösen. Was Hypnose im Körper verändert und welche physiologischen Effekte dieser Bewusstseinszustand haben kann, erforscht Björn Rasch, Professor für kognitive Biopsychologie, im schweizerischen Fribourg. Im Schlaflabor untersucht er, ob Hypnose die Schlafphase verbessern kann – und findet heraus, dass Hypnose sogar den Hormonspiegel verändern kann. In der klassischen Medizin herrscht oft noch Skepsis gegenüber der Hypnose. Doch einige Ärztinnen und Ärzte haben bereits erkannt, dass sich mit ihrer Hilfe Therapien unterstützen lassen. Schließlich sind die ersten Belege über hypnoseähnliche Trancezustände Tausende von Jahren alt, und Hypnose galt lange als anerkannte Disziplin in der Medizin, um Schmerzen zu lindern. Dieses Wissen ging jedoch verloren, und Hypnose geriet mehr und mehr in den Ruf, purer Hokuspokus zu sein. Einer der Gründe ist die Showhypnose – große Bühnenshows, auf denen Menschen in Sekundenschnelle in Hypnose fallen. Show-Hypnotiseur Christoph „Christo“ Hintermüller gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Showhypnose und verrät einige Tricks der Bühne. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 23.11.2023 3sat 89. Vom Sammeln, Speichern und Bewahren: Ist das Weltwissen, oder kann das weg?
Folge 89 (45 Min.)Was wollen wir aufbewahren – und wie? Je besser die Speichermöglichkeiten werden, desto schwieriger ist diese Frage zu beantworten. Was brauchen künftige Generationen, was ist Ballast? Speichern, archivieren, sammeln – wir Menschen erhalten gern alles, was wir erlangt oder geschaffen haben: Sauerteige, Bücher oder Blut. Wie können wir die Flut von Wissen, Daten und Dingen für nachfolgende Generationen bewahren? Was ist wirklich wichtig, was kann weg? Wir wollen Objekte aufbewahren, Erinnerungen und sogar Mikroorganismen. Karl de Smedt ist der einzige Sauerteigbibliothekar der Welt. Im belgischen St.Vith hütet er 144 Sauerteige aus aller Welt, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. So bewahrt er die einzigartigen wilden Hefen und Mikroorganismen jedes Sauerteigs. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig und Frankfurt bewahrt Exemplare von allen Büchern, Schallplatten, Medien auf, die seit 1913 in oder über Deutschland veröffentlicht werden. 34 Millionen physische Medien stehen in den Regalen. Digitalisierung kann zwar das Platzproblem lösen, hat aber auch ihre Tücken. Die Daten müssen ständig umkopiert werden, Festplatten können unbrauchbar werden. Ein besonders vielversprechendes Speichermedium entwickelt Prof. Robert Grass von der ETH Zürich: den DNA-Speicher. Er ist extrem leistungsfähig, über 1000 Jahre haltbar und immer auslesbar. Daten werden in den Code der DNA umgewandelt und als künstliche DNA gespeichert. Die BioBank Dresden lagert Tumorproben, Blut, Urin und Liquor für die Forschung ein. In der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main werden Beweismittel von Straftaten aufbewahrt. So können Verbrechen mit modernen Techniken erneut analysiert und nach Jahrzehnten aufgeklärt werden. Doch immer wieder stellt sich die Frage: Wollen wir etwas aufbewahren – oder ist das unnötiger Ballast? (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 14.12.2023 3sat 90. Solo-Sex – Von Menschen und Tieren, die masturbieren
Folge 90 (45 Min.)Sexuelle Selbstbefriedigung ist kein Privileg der Menschheit. Schimpansen-Weibchen masturbieren mit Mangokernen. Papageien stimulieren sich an Kuscheltieren. Ist das evolutionär sinnvoll? Masturbation gilt heute als Teil einer gesunden psychosexuellen Entwicklung. Doch die Wenigsten sprechen offen darüber. Falschinformationen und Unwissen sind immer noch verbreitet. Dabei kann Solo-Sex zu einer erfüllteren Sexualität verhelfen – allein oder zu zweit. Für viele Erwachsene ist Selbstbefriedigung mehr als eine Ersatzhandlung während des Single-Daseins oder in Zeiten von Beziehungskrisen.Praktische Tipps für die besten Handgriffe und Sextoy-Empfehlungen gehören zu den gern diskutierten Themen in Magazinen oder auf Social Media. Doch die wenigsten Menschen tauschen sich im echten Leben mit Partnerinnen oder Freunden offen darüber aus, und selbst viele medizinische Fachleute im Bereich Urologie und Gynäkologie umschiffen dieses Thema gern. Die in den USA entstandene NoFap-Bewegung verspricht: Männer, die gar nicht oder weniger masturbieren, entwickeln „Superkräfte“ wie ein größeres Selbstwertgefühl, emotionale Stabilität und einen höheren Testosteronspiegel. Frauen wiederum fürchten, die Klitoris könnte durch die starken Vibrationen bestimmter Sexspielzeuge abstumpfen, so dass ein Orgasmus beim partnerschaftlichen Sex unmöglich wird. Stimmt das? Darüber klären im Film ein Urologe, eine Sexualpädagogin und eine Therapeutin für sexologische Körperarbeit auf. Die gute Nachricht: Leidenschaftlicher Sex ist lernbar – mit anderen und mit sich selbst. Wissenschaftlich ist bereits erwiesen, dass Selbstbefriedigung Stress und Schmerzen verringert, Herz und Immunsystem schützt und sich positiv auf das Körpergefühl und die Sexualität auswirkt. Doch unterscheiden sich die körperlichen Reaktionen bei uns Menschen, je nachdem, ob ein Orgasmus durch Masturbation oder Sex mit einer anderen Person ausgelöst wird? Diese Frage erforscht der Sexualmediziner Professor Johannes Fuß mit Unterstützung von experimentierfreudigen Testpersonen im Labor. Und am University College London sucht die Evolutionsbiologin Matilda Brindle Antworten auf die Frage, warum Solo-Sex, ein Verhalten, das nicht der Fortpflanzung dient, seit circa 40 Millionen Jahren über viele Spezies hinweg praktiziert wird. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Di. 09.01.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 11.01.2024 3sat 91. Superkraft Motivation – Willensstark zum Ziel
Folge 91 (45 Min.)Gute Vorsätze fürs Abnehmen, die Ausbildung oder den Sport: Ob wir durchhalten oder nicht entscheiden unsere inneren Antriebskräfte. Lässt sich Motivation trainieren – wie ein Muskel? Was passiert im Gehirn, wenn wir Gewohnheiten loswerden wollen? Manche von uns haben mehr Selbstdisziplin als andere, sind zielstrebiger und gehen mit Rückschlägen besser um. Die Superkraft „Motivation“ lässt sich durch mentale Strategien erfolgreich steigern. wir essen, schlafen und haben Sex aus biologischen Motiven. Doch darüber hinaus streben wir nach Anerkennung, nach Macht, Erfolg und Liebe.Jedes Individuum hat einen anderen Motivationskompass. Die Professorin Marie Hennecke von der Ruhr-Universität Bochum erforscht, warum Menschen etwas mit welcher Intensität tun. Und der Verhaltensökonom Dr. Maximilian Hiller von der Universität Vechta erklärt, welche Anreize am besten funktionieren, wenn eine ganze Gesellschaft ihr Verhalten ändern soll. Professor Thomas Goschke von der TU Dresden weiß, welcher neurologische Kampf sich zwischen dem Überwachungs- und Kontrollsystem im Gehirn abspielt, wenn wir wieder einmal nachgeben und Fast Food kaufen, obwohl wir uns gesünder ernähren wollten. In seiner jüngsten Studie hat der Kognitionspsychologe die Laborergebnisse im Alltag getestet. Kann er anhand der Gehirnaktivitäten voraussagen, inwieweit wir in der Lage sind, uns selbstkontrolliert zu verhalten? Wie lässt sich Neurofeedback als neue Trainingsmethode nutzen, fokussierter an einer Sache dranzubleiben? Die Extremsportlerin Deniz Kayadelen – fünffache Weltmeisterin im Eisschwimmen – ist in ihrer Karriere oft an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen. (Text: 3sat) Deutsche Streaming-Premiere Mo. 01.01.2024 ZDFmediathek Deutsche TV-Premiere Do. 25.01.2024 3sat 92. Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City
Folge 92 (45 Min.)Sie klettern, zwängen sich durch Spalten, durchbeißen Bleirohre und erobern ihr Umfeld immer wieder aufs Neue. Eine wissenschaftliche Entdeckungsreise in die Welt der Ratten. Seit Jahrtausenden gehasst und gejagt, sind Wanderratten eines der am meisten verbreiteten Lebewesen auf unserem Planeten – unsichtbar, aber allgegenwärtig. Doch kaum bekannt ist, mit welch erstaunlichen Fähigkeiten sie zu Überlebenskünstlern der Evolution wurden. In der „Rat City“ New York geht der städtische Nagetierforscher Bobby Corrigan auf eine Tour durch begehrte Rattenimmobilien. Die Ratten dort haben gelernt, in Abwasserkanälen und Wolkenkratzern zu leben.Auf den unterirdischen Autobahnen der U-Bahn-Linien haben Ratten in jedem Bezirk der Stadt ihre „Pfoten im Spiel“ und tauchen auf Friedhöfen, in Baumgruben und mitunter in der einen oder anderen Toilette auf. Ratten springen bis zu eineinhalb Meter hoch. Sie können bis zu 15 Meter tief fallen, ohne sich zu verletzen, und schwimmen problemlos durch kommunale Abwassersysteme und moderne Rohrleitungen. Mit ihren kräftigen Kiefern und scharfen Schneidezähnen bearbeiten sie härteste Materialien. Trotz ihrer hohen Anpassungsfähigkeit hat sich aber auch herausgestellt, dass der Abenteuerlust der Ratte Grenzen gesetzt sind. Kaylee Byers, Biologin für Wildtiergesundheit, ist an vorderster Front in Vancouvers städtischem Rattenreich tätig. Sie hat eine beachtenswerte Entdeckung gemacht: Die Rattenpopulation von Vancouver ist kein Gebilde wie ein Staat, sondern über die gesamte Stadt verteilt in verschiedenen Clans organisiert. Die Mitglieder dieser Clans entfernen sich selten mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause – ein Verhalten, das nicht zuletzt dazu beitragen kann, die Übertragung von Krankheiten zu verhindern. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen auch, dass Verhaltensforschung mit Ratten für den Menschen von großem Nutzen sein kann. Kelly Lambert, Neurowissenschaftlerin an der Universität Richmond, trainiert Ratten, Miniaturautos zu fahren. Sie und ihr Team haben entdeckt: Das Fahren dient den Ratten nicht nur zum Stressabbau, sondern verbessert auch die Fähigkeit ihres Gehirns, sich zu verändern und anzupassen. Diese Ergebnisse könnten zu einem besseren Verständnis zahlreicher neurogenerativer Störungen und Krankheiten wie ADHS und Alzheimer führen. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 01.02.2024 3sat 93. Die Wissenschaft vom guten Hören
Folge 93 (45 Min.)15 Millionen Menschen in Deutschland sind schwerhörig. Nur ein kleiner Teil trägt ein Hörgerät. Doch gutes Hören sehr wichtig für Orientierung, Kommunikation und Gefahrenerkennung. Wer jung ist, schützt sein Gehör oft nicht gut genug: Weltweit sind mehr als eine Milliarde junger Menschen von Hörverlust bedroht. Zu spät greifen Menschen mit Hörschäden zu Hilfsgeräten. Dabei kann Schwerhörigkeit zu Isolation führen und Demenz begünstigen. Unser Ohr ist permanent Geräuschen ausgesetzt: Straßenlärm, startende Flugzeuge, überlaute Musik.Bei Konzerten oder Partys erreicht die Lautstärke nicht selten die Schmerzgrenze von 120 Dezibel. Das kann zu lärmbedingten Schäden am Gehör führen. Derartige Schäden sind nicht heilbar. Anders bei Altersschwerhörigkeit – hier können Hörgeräte helfen. Ab Mitte 40 zeigen sich häufig bereits erste Anzeichen: Betroffene hören hohe Frequenzen nicht mehr und können einem Gespräch in lauter Umgebung nur mühsam folgen. In der Regel ziehen sich Betroffene dann zurück. Sie vermeiden Treffen mit vielen Menschen, da sie nur wenig verstehen und nicht immer wieder nachfragen wollen. Hörgeräte filtern Nebengeräusche wie Verkehr oder Wind heraus, unterdrücken den Hall und verstärken die Sprache – individuell, je nach Hörumgebung. Die Technik dafür kann inzwischen in winzigen Gehäusen untergebracht werden. Doch noch gibt es einen Nachteil all dieser Hörsysteme: Der Lautsprecher befindet sich im Gehörgang. Das führt zu Klangverlusten. Manchmal auch zu Entzündungen im Ohr. Bei der „Hörkontaktlinse“ hingegen sitzt der Lautsprecher direkt auf dem Trommelfell und stimuliert es unmittelbar. Der Klang soll intensiver und klarer werden, verspricht das Start-up-Unternehmen Vibrosonic. Eine Lösung auch für Menschen, die mit den winzigen Hörgeräten altersbedingt nicht gut umgehen können? Die 3sat-Dokumentation „Die Wissenschaft vom guten Hören“ stellt junge Menschen vor, die ihr Gehör durch zu laute Musik verloren haben, schaut sich Alltagssituationen an, die extrem das Gehör belasten – wie die Arbeit in einer Großküche – und stellt neue Lösungswege der Hörgeräte-Industrie vor, um das Hören zu verbessern. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 22.02.2024 3sat 94. Glücksfall Sonne – Leben aus Licht und Energie
Folge 94 (45 Min.)Unsere Sonne bestimmt alle Prozesse des Lebens auf der Erde. Sie ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Doch so lebensspendend Sonnenstrahlen sind, das Zentralgestirn kann gefährlich sein. Auf der Sonnenoberfläche hat eine Temperatur von rund 6000 Grad Celsius. Es grenzt an ein Wunder, dass die Erde mit 150 Millionen Kilometern im perfekten Abstand um diesen Feuerball kreist, sodass Leben überhaupt erst möglich ist. Wir weder verbrennen noch erfrieren. Die Sonne ist der Stern, der unserem Planeten am nächsten ist.Ihre gewaltige Kraft ist das Ergebnis einer fortwährenden Kernfusion in ihrem Innern. Auch sonst ist es eher ungemütlich in ihrer Nähe: Sonnenwinde schleudern elektrisch geladene Teilchen in den Weltraum. Manchmal kommt es zu regelrechten Sonnenstürmen. Dann lösen sich gewaltige Mengen elektrischer Teilchen ab und können nicht nur für Astronauten und Satelliten, sondern auch beispielsweise für Kraftwerke und Flughäfen auf der Erde bedrohlich sein. „Deshalb ist es wichtig, dass man die Sonne wirklich sehr gut und konstant die ganze Zeit im Blick hält. Vom Boden, aber auch vom Weltraum aus“, warnt Sami Solanki, Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen. Die Raumsonde „Solar Orbiter“ zum Beispiel untersucht die Sonne vom Weltraum aus. Dabei nähert sie sich stark an den heißen Stern an und beobachtet erstmals auch die Sonnenpole. GREGOR ist das derzeit größte terrestrische Sonnenteleskop Europas. Eine deutsche Forschungsgemeinschaft nutzt das Teleskop auf Teneriffa, vor allem, um Sonnenflecken und ihre Magnetfelder zu erforschen. „Alle Sterne funktionieren so ähnlich wie die Sonne, und Gesetze, die wir über andere Sterne aufstellen, müssen wir immer wieder an der Sonne testen. Deswegen spielt die Sonne in der Astrophysik eine sehr zentrale Rolle“, so Rolf Schlichenmaier vom Leibniz-Institut für Sonnenphysik. Mit am wichtigsten für uns auf der Erde ist die Sonne als Energielieferant. Ihre Strahlung sorgt für die richtige Temperatur, damit Wasser in flüssiger Form vorliegt – eine Grundvoraussetzung für Leben. Pflanzen nutzen Sonnenlicht zur Photosynthese und damit zur lebensnotwendigen Sauerstoffproduktion. Sonnenblumen richten ihr Wachstum sogar exakt nach dem Lauf der Sonne aus. Algen steuern ihre Schwimmrichtung nach der Beleuchtungsstärke. „Phototaxis“ wird dieser Vorgang genannt, der an der Universität in Bielefeld erforscht wird. Die Zukunftsvision: Diese Form der Lichtsteuerung zu nutzen, um zwischen Zellen zu kommunizieren. So könnten beispielsweise Medikamente entstehen, deren Wirkstoffe mittels Lichts aktiviert oder deaktiviert werden. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 29.02.2024 3sat 95. Streit ums Fahrrad – Wem gehört die Straße?
Folge 95 (45 Min.)2024 ist das europäische Jahr des Fahrrads. Es ist wichtiger Teil der Verkehrswende. Doch oft fehlt der Raum für eine sichere Verkehrsteilnahme, egal ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder im Auto. In Deutschland gibt es fast 83 Millionen Fahrräder, fast jedes zweite neu verkaufte Rad hat einen Motor. Damit steigt auch die Zahl der Verkehrsunfälle stark an, um mehr als 60 Prozent bei E-Bikes. Beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur hinkt Deutschland hinterher. Das Fahrrad gilt vielen nicht mehr nur als umweltfreundlicher Alltagshelfer, sondern auch als heiß diskutiertes Statussymbol. Soziologe Ansgar Hudde von der Universität Köln hat erforscht, dass Menschen, je gebildeter und urbaner sie sind, auch desto häufiger radeln.Dies verstärke noch die bestehenden sozialen und gesundheitlichen Unterschiede. Unfallforscher Siegfried Brockmann verweist auf die hohen Unfallzahlen mit E-Bikes sowie auf bislang fehlende Infrastrukturen. Wie schaffen wir eine bessere Mobilität, ohne uns gegenseitig auszuspielen? Professorin Angela Francke von der Universität Kassel erläutert vielversprechende neue Verkehrskonzepte in Deutschland und Europa. Wie fährt es sich als Radfahrer in der Stadt, wie auf dem Land ohne eigenen Radweg? Das soll ein Experiment in Berlin und im brandenburgischen Kremmen-Linum untersuchen. Was können wir von anderen europäischen Städten lernen? Sevilla ist binnen weniger Jahre zum „Hidden Champion“ des Radverkehrs mutiert. In Amsterdam erläutert Städteplanerin Dr. Meredith Glaser, inwiefern Fahrradfahren in den Niederlanden schon immer auch eine politische und soziale Komponente hat. Utrecht gilt mit dem meistbefahrenen Radweg Europas und dem größten Parkhaus der Welt als leuchtendes Vorbild. Gleichzeitig fühlen sich auch dort immer mehr Menschen unsicher, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Sie pochen lautstark auch auf ihre Rechte für mehr Lebensqualität und Sicherheit im Straßenverkehr. (Text: 3sat) Deutsche TV-Premiere Do. 14.03.2024 3sat 96. Inspired by Nature: Geniale Technologien – Bewegen – Greifen – Haften
Folge 96 (45 Min.)Blitzschnell, bärenstark und megaeffizient. Die Natur verfügt über außergewöhnliche Kräfte, die wir gerade lernen nachzuahmen. Beeindruckende Beispiele zeigen: Die Zukunft ist biomimetisch. Die Natur bietet ein geniales Benutzerhandbuch für alle, die lösungsorientiert denken. Pflanzen und Tiere verfügen über verborgene Superkräfte. Drei Filme zeigen, wie wir Menschen diese besonderen Fähigkeiten beobachten und in geniale Technologien überführen. Im Lauf ihrer Entwicklung hat die Natur besondere Klebefähigkeiten entwickelt, aber auch Super-Gleitfähigkeiten. Mit einem Powerkleber baut ein Wurm an der kalifornischen Küste Schutzröhren aus Sand, die der Meeresströmung standhalten. Ein Replikat dieses Superkleisters wird bereits bei Herzoperationen erfolgreich eingesetzt. (Text: 3sat)Deutsche TV-Premiere Do. 11.04.2024 3sat
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Wissen hoch 2 und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.