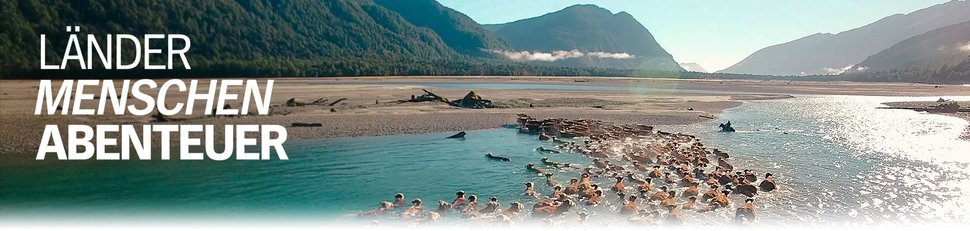1783 Folgen erfasst, Seite 68
Die Weißen kennen den Tod nicht – Begräbnisfeier bei den Senufo
Deutsche TV-Premiere So. 26.05.1991 Das Erste von Paul SchlechtWeißer Falke, weißer Wolf
Auf Ellesmere Island, im nördlichsten Kanada, ist im Juni Frühling, im Juli Sommer und im August Herbst. Den Rest des Jahres herrscht eisiger Winter. In der kurzen, warmen Zeitspanne von drei Monaten explodiert das Leben. Die Entwicklungszyklen der Lebewesen sind seit Jahrmillionen optimal aufeinander abgestimmt. Jede noch so kleine Schwankung kann sie ins Wanken bringen. (Text: SWR)Der weite Weg des blauen Steins – Lapislazuli aus Afghanistan
Die Welt des Pierre Marcolini
Pierre Marcolini ist zurzeit der Star unter Belgiens Chocolatiers. Brüssel ist die Hauptstadt der Pralinen und er ist ihr König. Doch vor allem ist er besessen. Marcolini kombiniert Schwarze Schokolade mal mit Earl Grey oder Roibos-Tee, mit Thymian oder Lakritz, aber auch mit exotischen Gewürzen, mit Blumendüften oder so mediterranen Zutaten wie Basilikum und Olivenöl. Seine Kreationen sind ausgefallen, aufwändig und teuer, er präsentiert sie edel und perfekt wie ein Juwelier. Die Menschen pilgern geradezu in seine Geschäfte. Marcolini ist dabei ein weltweiter Star zu werden, er hat Geschäfte in den besten Lagen von Tokio, New York, Moskau, Paris oder London. Doch der 40-jährige Marcolini, dessen Großeltern italienische Einwanderer sind, ist nicht nur ein einfacher Chocolatier.Er degustiert die verschiedenen Schokoladensorten der Welt wie andere Leute Wein. Seine Welt sind sortenreine Schokoladen und er würde niemals eine neue Kreation nur um ihrer Kreativität erfinden. Im Mittelpunkt steht immer die Schokolade. Marcolini gehört daher zu den ganz wenigen Chocolatiers der Welt, die ihre Schokolade noch wirklich selbst herstellen, statt sie bei Großhändlern zu beziehen. Nun will er auch noch die Bohnen direkt bei den Plantagenbesitzern beziehen, um sich unabhängig von den Händlern zu machen und die bestmögliche Qualität zu erzielen. Dazu reist er in Länder wie Madagaskar und zahlt den Produzenten auch das Doppelte des Marktpreises. (Text: rbb) Weltmeister auf vier Pfoten
Wales, ein grüner Landzipfel weit im Westen Großbritanniens. Elf Millionen Schafe gibt es hier und die weltbesten Hütehunde: die Border Collies. Schaffarmer Nigel Watkins trainiert seine Hunde für die Hütehunde-Weltmeisterschaft. Er ist amtierender Vizeweltmeister und ein Naturtalent im Führen von Hütehunden. Die diesjährige WM findet direkt vor seiner Haustür in Wales statt. Und nicht nur deshalb möchte er diesmal gewinnen. 360°- GEO Reportage. begleitet den Waliser vom Frühjahr bis zum Herbst durch den Alltag zwischen Lämmergeburt, Hundeauktion, Welpenkauf bis hin zum Wettkampf vor dem Herrensitz Newton House. (Text: WDR)Weltpark Antarktis – Kontinent der Superlative
Deutsche TV-Premiere Mo. 01.05.1989 S3 von Franz LaziWeltuntergang – Weltanfang – Das Erdbebenland Kalifornien – Ursachen – Hintergründe (1)
Deutsche TV-Premiere Mo. 23.10.1989 S3 von Jürgen LodemannWeltuntergang – Weltanfang – Das Erdbebenland Kalifornien – Ursachen – Hintergründe (2)
Deutsche TV-Premiere Mo. 30.10.1989 S3 von Jürgen LodemannWenn Buddha auf Reisen geht – Am Inle-See in Burma
Myanmar, besser bekannt unter dem Namen Burma, ist ein Land, in dem die Zeit Blei an den Füßen zu haben scheint, so gemächlich zieht der so genannte Fortschritt ein. Myanmar ist noch voll von unverdorbenen Traditionen, religiösen Riten und farbenfrohen Bräuchen, vor allem wohl deshalb lockt es Filmemacher aus aller Welt in dieses fernöstliche Land – so auch Edy Klein, der das erste Mal burmesischen Boden 1962 in Rangun betrat. Seither besuchte er Myanmar schon zehnmal. Dabei lernte er es immer besser kennen. Es taten sich vorher nicht zugängliche Regionen auf. Eine der Überraschungen, die der Autor nun erlebte, ist ein besonders schönes Fest des Intha-Volkes im Inle-See.Dieses Fest, das fast drei Wochen lang gefeiert wird, beginnt und endet in der Phaung Daw U-Pagode im Dorf Ywama, in der fünf Buddhafiguren stehen. Sie wurden im Lauf der Jahrhunderte derart mit Goldplättchen überzogen, dass sie nur noch unförmige Gebilde sind. Gläubige Buddhisten haben so viel Gold an ihnen abgerieben, dass von ihrer ursprünglichen Gestalt nichts mehr zu sehen ist. Einmal im Jahr werden sie auf eine Prunkbarke verladen und über den See von Dorf zu Dorf, von Pagode zu Pagode gezogen, so dass die wichtigsten Tempel sie wenigstens einmal über Nacht beherbergen können. Benannt ist das Hintha-Schiff nach dem mythischen Vogel, der Gesundheit, Wohlstand und Erfolg garantieren soll; ihm ist die kostbare Fracht anvertraut. Bewegt wird es von sechzehn Langbooten, in denen je 80 bis 100 Einbeinruderer stehen, die das Paddel mit einem Bein umschlingen und kraftvoll die Wellen teilen. So fährt die lange Kolonne während 18 Tagen von Tempel zu Tempel, bis Buddha, der „Erleuchtete“, wieder an seinem angestammten Platz angelangt ist. (Text: hr-fernsehen) Deutsche TV-Premiere Mi. 24.01.2001 Südwest Fernsehen von Edy KleinWenn das Orakel spricht …. – Botschaften aus der Zukunft?
Deutsche TV-Premiere Mi. 28.06.2000 Südwest Fernsehen von Doris KubischWenn die Götter tanzen – Im Tulu-Reich Südindiens
Deutsche TV-Premiere Mi. 17.06.1998 S3 von Petra Spamer-RietherWenn Weiden zu Wüsten werden (1): Die Sahara im Nord-Sudan
Wolfram Schiebener und sein Team begleiten eine Expedition in den nahezu unerforschten Nordwesten des Sudans. Die beteiligten Wissenschaftler müssen 3000 km überwinden, sich durch tückische Dünenfelder kämpfen und einen Zusammenstoß mit Bewaffneten überstehen. Sie stoßen aber auch auf überraschende archäologische Funde und gewinnen erstaunliche Erkenntnisse über die ökologischen Veränderungen dieses Teils der Sahara in den vergangenen Jahrtausenden. (Text: rbb)Wenn Weiden zu Wüsten werden (2): Das Kaokoveld in Namibia
„Wenn Weiden zu Wüsten werden“ – und Wissenschaftler zu Abenteurern, dann spüren Archäologen, Geologen, Ethnologen, Botaniker und Geografen der Frage nach, welche Einflüsse die dramatischen Veränderungen in den großen Wüstengebieten Afrikas verursachen und wie man damit umgehen kann. Diese Art der Forschung in der Sahara im Nordosten und in der Namib im Südwesten – bringt die Beteiligten physisch und psychisch in Extremsituationen, die die Zuschauer hautnah miterleben können. Mit seinem Dreiteiler dokumentiert Wolfram Schiebener ein wissenschaftliches Großprojekt. (Text: WDR)Wenn Weiden zu Wüsten werden (3): Von der Sahara in die Namib
„Wenn Weiden zu Wüsten werden“ – und Wissenschaftler zu Abenteurern, dann spüren Archäologen, Geologen, Ethnologen, Botaniker und Geografen der Frage nach, welche Einflüsse die dramatischen Veränderungen in den großen Wüstengebieten Afrikas verursachen und wie man damit umgehen kann. Diese Art der Forschung in der Sahara im Nordosten und in der Namib im Südwesten – bringt die Beteiligten physisch und psychisch in Extremsituationen, die die Zuschauer hautnah miterleben können. (Text: WDR)Wer die Fremde erfand, muss blind gewesen sein – Zuhause im anatolischen Dorf
Deutsche TV-Premiere Sa. 30.10.1982 S3 von Anna SoehringWestaustralien – Überleben im Outback
45 Min.Der Astrobiologe Martin J. Van Kranendonk erforscht den Ursprung des Lebens auf der Erde. In einem Krater der Dresser-Formation findet er den ältesten Beweis, dreieinhalb Milliarden Jahre alt.Bild: NDR/Peter MoersRote Felsen, wildes Outback, es ist eine weite, karge Fläche, über der die Sonne erbarmungslos brennt. Westaustralien ist eine der ältesten Landschaften der Erde mit lebensfeindlichen und entbehrungsreichen Bedingungen. Große Gebiete sind unbesiedelt. Wer hier von einem Ort zum anderen will, sollte gut vorbereitet sein. Es gibt zwar Straßen, aber die wenigsten sind befestigt und als solche erkennbar. In der Trockenzeit entladen sich tropische Gewitter, die zu verheerenden Bränden führen. Vor allem die großen Wälder im Südosten Westaustraliens brennen wie Zunder. Tayla Asplund und ihre Kolleginnen und Kollegen sind im Einsatz, um das Schlimmste zu verhindern.Sie arbeiten für die Feuerwehr der Naturschutzbehörde Parks and Wildlife. Das heiße, staubige Herz Westaustraliens ist die Pilbara. Mittendrin liegt der Karijini Nationalpark mit seinen Schluchten. Hierher zieht es ein internationales Team von Geologen. Ihre Expedition soll ihnen Antworten auf den Ursprung allen Lebens auf dem Planeten Erde geben. Yarrie Station heißt die Rinderfarm von Annabelle Coppin. Einmal im Jahr gibt es eine Art Inventur, das sogenannte mustering. Dafür müssen 5000 Rinder auf einer Fläche so groß wie Schleswig- Holstein zusammengetrieben, gezählt und gewogen werden. Ein Knochenjob, bei dem Annabelle am liebsten mit Frauen zusammenarbeitet. Sie dirigiert im Helikopter aus der Luft, ihre Mitarbeiterinnen treiben die Rinder am Boden mit Pferden zusammen. In einer Schlucht am Südrand der Kimberleys leben viele Süßwasserkrokodile. Sie haben keine natürlichen Feinde. Der Mensch hat das geändert. Er wollte eine Käferplage mit den giftigen Agakröten bekämpfen. Das hat nicht funktioniert, und nun breiten die giftigen Kröten sich ungebremst aus. Für die Süßwasserkrokodile ein tödlicher Leckerbissen. Jetzt gibt es ein Trainingsprogramm für die Raubtiere. Sie sollen lernen, sich auf andere Beute zu konzentrieren. Die Aborigines kommen nur zu besonderen Anlässen zusammen. In Australien heißen diese Zusammenkünfte der Ureinwohner Corroboree, sie sind eine Mischung aus Tanz, Gedenken an die Ahnen und einem Festmahl. In den Kimberleys nennen die Familienclans dies auch Junba. Hier wird den Jüngeren beigebracht, wie man die Corroborees richtig singt. Das dürfen nur die Stammesältesten. Niemand hat die Lieder aufgeschrieben. Deshalb müssen sie ständig wiederholt werden, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Die Aborigines glauben, dass die Corroborees das ganze Land am Leben halten. (Text: NDR) Westray – Vor Schottlands Küste – Der harte Alltag auf einer Orkney-Insel
Westray gehört zu den Orkney-Inseln nördlich von Schottland. An den rauen Felsen des kleinen Eilands brechen sich die Wellen von Nordsee und Atlantik. Schon die Wikinger errichteten hier einen wichtigen Stützpunkt. Lange Zeit war der kleine Hafen ein wichtiger Ausgangspunkt für die Fischerei. Im Nordatlantik wurden Kabeljau und Schellfisch gefangen. Aber die großen Schleppnetzfischer aus Osteuropa und Spanien haben alles leer gefischt und so die einst blühende Fischindustrie auf der Insel zerstört. Heute leben die 600 Einwohner hauptsächlich von Landwirtschaft und Tourismus. Angelockt werden die Besucher von den über hunderttausend Vögeln, die an den kilometerlangen Klippen nisten, und der geheimnisvollen Burg.Aber für die Schönheit der Natur haben die Einheimischen kaum Zeit. Dafür ist ihr Alltag zu hart. Wie der aussieht, schildern ein Fischer, Landwirte und ein Touristenführer, der zum Überleben noch weitere sechs Jobs braucht. Aber auch „Zugewanderte“ wie die Postbotin, die nebenbei die alte Tradition des Strohstuhlflechtens weiterführt, und ein Rentner, der eine alternative Energieversorgung aufbaut, zeigen: Nur ein ausgeprägtes Zusammengehörigkeitsgefühl ermöglicht das Überleben auf Westray. (Text: ARD-alpha) Westsahara
Im Oktober 2007 bricht eine Expedition auf in ein Gebiet der westlichen Sahara, das man wegen seiner ungewöhnlichen Geschichte als „vergessene Wüste“ bezeichnen kann. Es ist eine menschenleere Region voller ungelöster Rätsel und bizarrer Orte, die keiner Fernsehkamera bisher zugänglich war. (Text: WDR)Der Wettlauf des San Juan
Deutsche TV-Premiere Mi. 24.03.1993 S3 von Ingrid Kummels und Manfred SchäferWettlauf mit dem Eis – Mit Arved Fuchs durch die Nordwestpassage (1)
Sie ist ein menschenfressender Mythos: 500 Jahre lang haben Menschen versucht, eine Passage durch die kanadische Arktis zu finden, um den zeitraubenden Seeweg nach Asien zu verkürzen. Hunderte von Seeleuten kamen dabei ums Leben; das tragische Schicksal wagemutiger Expeditionen wie der John Franklins in den Jahren 1845–1848 hat die gesamte damalige Welt bewegt. (Text: BR Fernsehen)Deutsche TV-Premiere So. 04.12.2005 Südwest Fernsehen von Gunther ScholzWettlauf mit dem Eis – Mit Arved Fuchs durch die Nordwestpassage (2)
Der Seeweg durch die kanadische Arktis stellt selbst für Arved Fuchs, den Kapitän der „Dagmar Aaen“ und Bezwinger des Nord- und Südpols, eine Herausforderung dar: Im Jahr zuvor musste er mit seinem Schiff umdrehen, nachdem ihn erst ein Eisbrecher aus dem Eis befreien konnte. (Text: BR Fernsehen)Deutsche TV-Premiere So. 11.12.2005 Südwest Fernsehen von Gunther ScholzDie Whisky-Insel – Islay vor Schottlands Küste
Der Wind und der Atlantik führen ein strenges Regime, das die Gestalt der Insel Islay ebenso prägt wie den Charakter der wetter- und sturmgewohnten Bewohner. Einer von ihnen ist Jim MacEwan. Ihm ist es gelungen, eine der sieben weltberühmten Whisky-Destillerien der südlichsten Insel der Hebriden nach ihrem Bankrott wieder aufzubauen. Islay, die südlichste Insel der Hebriden, ist ein Außenposten Schottlands. Der Wind und der Atlantik führen ein strenges Regime, das die Gestalt der Insel ebenso prägt wie den Charakter der wetter- und sturmgewohnten Bewohner. Der Muschelfischer Dave Farrell ist so einer.Er kann nicht klagen, denn der Golfstrom sorgt für das Gedeihen einer einmaligen Muschelart vor Islay, um die sich Frankreichs Nobelbistros reißen. Doch Dave wird langsam müde. Die Fischerei wird von Tag zu Tag mühsamer, und er hofft, dass sein Sohn Jonathan bald das Ruder übernehmen kann. Jim MacEwan dagegen ist das Kunststück gelungen, eine der sieben weltberühmten Whisky-Destillerien der Insel nach ihrem Bankrott wieder aufzubauen. Damit hat er, wie er sagt, der „Whisky-Insel“ Islay ein Stück ihrer Seele wiedergegeben. Karen Robertson schließlich führt seit ein paar Wochen das Kommando in der Islay-Dudelsack-Truppe. Eine heikle Aufgabe, denn die schottische Dudelsack-Tradition sieht Frauen in der Chefrolle nicht vor. Und speziell die eigenwilligen Trommler wollen ein Wörtchen mitreden. All diese Geschichten spielen sich ab in einer wunderschönen, bei passablem Wetter sehr lieblichen Landschaft: sanft geschwungene Berge, zerklüftete Küsten, lange Strände und wuchernde Wälder auf engem Raum. Und überall trifft man auf die heimlichen Hauptdarsteller von Islay, die Tiere: von Kühen und Schafen über Robben und Delfinen bis zu Rotwild und Abertausend Vögeln. (Text: BR Fernsehen) Die wilde Schönheit der Pyrenäen
45 Min.In dem Hochgebirgszug mit rund 200 Gipfeln über 3.000 Meter hoch, steilen Schluchten, abgeschiedenen Tälern und Bergdörfern leben die Menschen in enger Verbundenheit mit der wilden Natur. Doch so einzigartig die Pyrenäen sind, die meisten Menschen kennen sie nur von der Überquerung auf dem Weg von Frankreich nach Spanien. „Länder – Menschen – Abenteuer“ begibt sich der Länge nach auf die Reise, vom Mittelmeer bis zum Atlantik durch die französischen Pyrenäen. Der Film ist zugleich eine Reise durch das Jahr in diesem besonderen Stück Europa.Der Pic du Midi de Begorre ist eines der Wahrzeichen der Pyrenäen. Der 2.877 Meter hohe Berggipfel liegt im Départemente Hautes-Pyrénées, berühmt für das Observatorium mit dem größten Spiegelteleskop Frankreichs. Mit einem weiteren Teleskop ließ die NASA in den 1960er-Jahren die Mondoberfläche nach geeigneten Landeplätzen für die Apollo-Mission absuchen. Im Winter geht es hier für Julie Constant auf eine Piste, um die sie alle Skifahrer*innen beneiden: Im Tiefschnee fährt sie 1.700 Höhenmeter vom Pic du Midi hinab ins Tal, durch enge Schluchten und mit waghalsigen Sprüngen von hohen Klippen. Das dürfen nur Menschen wie Julie: Sie ist ausgebildete Bergretterin und -führerin in diesem Gebiet und hier aufgewachsen. Ins Herz der Pyrenäen führt der Petit Train Jaune, der kleine gelbe Zug. Ein regulärer Nahverkehrszug, aber wohl auch der ungewöhnlichste der französischen Bahngesellschaft. Einige Wagen sind 100 Jahre alt. Für Régis Bienvenue und die anderen Techniker in der Werkhalle von Villefranche ist die Instandhaltung dieses Oldtimers eine Herausforderung. Im Sommer sind es dann aber hauptsächlich Touristen, die die Fahrt durch die engen Schluchten über schwindelerregende Brücken und durch zahlreiche Tunnel genießen. Gisèle Gouazé ist eine der letzten Schafzüchterinnen. Sie treibt ihre Herde noch jedes Frühjahr auf die Sommerweide im Hochgebirge. Für die traditionelle Transhumance, den Almauftrieb, ist sie mit ihrer Familie und 300 Schafen tagelang zu Fuß unterwegs. Doch seit in den Pyrenäen Braunbären wiederangesiedelt wurden, fallen jedes Jahr Hunderte Schafe den Bären zum Opfer. Ganze Herden geraten in Panik vor den Bären und stürzen die Klippen hinab. Auch Gisèle hat in einer der vorherigen Sommersaisons bereits über 200 Schafe verloren. Daher macht sie sich in diesem Jahr voller Sorgen auf den Weg hinauf auf die Sommerweide. Das Vallée d’Ossau ist die Heimat der Gänsegeier. Mit einer Flügelspannweite von 2,70 Metern gehören sie zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Didier Peyresqué seilt sich an den Steilwänden zu den Nestern ab. Riskant, doch notwendig, um die Jungvögel beringen zu können und damit zu schützen. Die Gänsegeier galten lange als vom Aussterben bedrohte Art. Inzwischen leben im Vallée d’Ossau, dem Tal der Geier, wieder über 140 Gänsegeierpaare. Die Pyrenäen sind nicht zuletzt eine der großen Herausforderungen der alljährlichen Tour de France, die Bergetappen sind traditionell die anstrengendsten des Radrennens. Marc Lebreton sammelt historische Fahrräder und fährt mit anderen Enthusiasten die legendären Routen auf originalen, 100 Jahre alten Rennrädern nach. Ohne Gangschaltung. (Text: NDR) Die wilde Seele unserer Haustiere
In unseren Hausrindern schlummert immer noch die wilde Seele der ausgestorbenen Ure. Keine Spur von der „dummen Kuh“ oder dem „brutalen Bullen“ – in einem einmaligen Pilotprojekt auf der Schwäbischen Alb dürfen sie wieder eine Sozialstruktur aufbauen wie einst ihre wilden Vorfahren. Bis zu 200 Rinder leben in einer Herde mit einem natürlichen Zahlenverhältnis von Kühen, Stieren und Jungtieren. (Text: SWR)Wilde Wasser, tiefe Wälder – Durch die chinesische Mandschurei
In früheren Jahrhunderten zogen Jäger durch die tiefen Wälder an der Grenze zu Sibirien, im Nordosten Chinas – und an den Ufern des Amur-Flusses lebten Fischer vom reichen Fang. Im Winter trugen sie Pelze, im Frühjahr und Herbst einzigartige Kleidung aus Fischhaut. Das ist heute Geschichte, nur wenige Nachfahren der Fischer können noch von den Traditionen ihrer Großeltern berichten. Tiefe Wälder, gigantische Flüsse und weite Auenlandschaften: „Land des Überflusses“ wurde der äußerste Nordosten Chinas früher genannt.Heute ist Nordostchina dank seiner Bodenschätze und der fruchtbaren Landwirtschaft eine der wohlhabendsten Provinzen des Landes. Nur wenige Nachfahren der Fischer können noch von den Traditionen ihrer Großeltern berichten, ihre tungusischen Sprachen sind vom Aussterben bedroht. Quirlige Hauptstadt der Region ist Harbin – berühmt für sein winterliches Eisfestival. Aber im Sommer genauso interessant: Russen gründeten Harbin Ende des 19. Jahrhunderts als Stützpunkt der Trans-Mandschurischen Eisenbahn. Schnell wuchs Harbin zu einer internationalen Metropole heran, die „Klein-Moskau“ oder „Klein-Paris“ genannt wurde. In der großartigen und weiten Landschaft machen immer mehr Chinesen Urlaub. Man trifft sie ganz ungewohnt beim Rafting auf den wilden Flüssen oder in Gruppen, die durch die bizarre Vulkanlandschaft wandern. Typisch chinesisch sind die Heilbäder von Wudalianchi. Die schlafenden Vulkane formten eine Krater- und Seenlandschaft mit einzigartigen Quellen, die heilende Wirkung haben sollen. Hunderte Kranke baden deshalb im eisenhaltigen Mineralwasser. Die Provinz ist so wohlhabend, dass man sich dort dem Schutz bedrohter Tierarten widmen kann. Die Auenlandschaften Nordostchinas sind wichtiger Brutplatz für seltene Vögel. Der Mandschuren-Kranich hat hier sein Sommerrevier. Und im Grenzgebiet zu Russland leben noch einige wenige Exemplare des Amurtigers. Naturschützer kämpfen um die letzten Refugien dieser vom Aussterben bedrohten Arten, versuchen, die Balance zwischen Mensch und Natur zu bewahren. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail