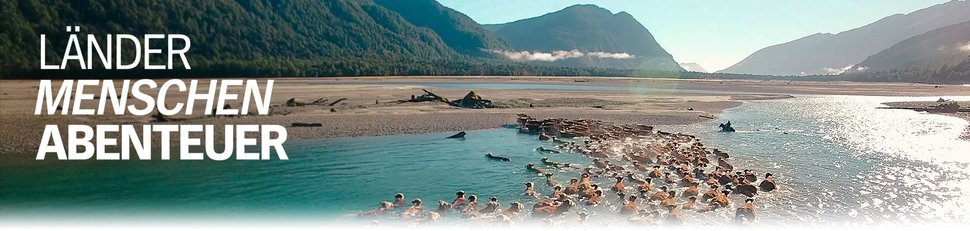1783 Folgen erfasst, Seite 23
Geheimnisvolles Venezuela – Expedition durch das Guayana-Hochland
Die Tepuis, die Tafelberge Venezuelas, erheben sich wie mächtige Kathedralen aus dem feucht-heißen Dschungel. Das Filmteam reist über reißende Flüsse, auf staubigen Pisten und in engen Flugzeugen durch den spektakulären Süden Venezuelas. 42 Tage lang sind sie unterwegs. Dabei begegnen sie ungewöhnlichen Menschen und müssen so manches Abenteuer bestehen. Die Tepuis, die Tafelberge Venezuelas, erheben sich wie mächtige Kathedralen aus dem Dschungel. Ein Fernsehteam ist zu den spektakulären Tafelbergen im Hochland von Guayana unterwegs. Nur auf der ersten Etappe gibt es noch so etwas wie Straßen. Die Gran Sabana ist eine Savannenlandschaft im Osten des Landes, es ist das Land der Pemón-Indianer.Dort trifft das Team das Aussteiger-Paar Alfredo und Wilma, das behauptet, dass ganz in der Nähe rosa Ufos gelandet sind. Ditza betreibt eines der wenigen Restaurants in der endlosen, menschenleeren Landschaft. Sie kocht jeden Tag, aber ob überhaupt Gäste zu ihr finden, weiß sie nie. Ein erster Höhepunkt der Reise ist der Salto Angel, der höchste Wasserfall der Erde. Dort stürzt das Wasser fast 1.000 Meter in die Tiefe. Im nahen Chimanta-Massiv dringen die Expeditionsteilnehmer tief in das Höhlensystem eines Tafelberges vor. Ein Biologe, der das Team begleitet, entdeckt dabei eine neue Spinnenart, eine kleine Sensation. Auf der Suche nach den Sanema-Indianern geht es fünf Tage lang über den wilden Río Caura mit seinen zahlreichen Stromschnellen. In einem Dorf angekommen, können die Männer eine Geisterheilung beobachten. Nach einem kleinen Abstecher nach Kolumbien, wo das überall im Grenzgebiet von Glücksrittern gefundene Gold eingeschmolzen wird, geht es mit einem größeren Flussschiff, der „Iguana“, über den Orinoco. Ziel ist ein Besuch bei den Inepa-Indianern. Nach vielem Hin und Her bekommt das Team dann auch die Erlaubnis, den schönsten aller Tepuis in Venezuela zu besuchen: den Autana, eine steingewordene Kathedrale mitten im Dschungel. (Text: BR Fernsehen) Geheimnisvolle Tigerhaie – Spurensuche im Ozean
Er zählt zu den größten und schönsten Raubfischen überhaupt: der Tigerhai. Pfeilschnell, unberechenbar (Text: SWR)von Sigurd TescheDie geheimnisvolle Welt der Fischotter
Fischotter sind geschickte Jäger, wenn sie unter Wasser den Bachforellen nachstellen. Zeitlupenaufnahmen zeigen, wie raffiniert sie dabei sind. Es ist schwierig, ihnen in ihre geheimnisvolle Welt zu folgen. Denn nährstoffreiches Wasser ist oft trübe. Eindrucksvoll sind Aufnahmen aus der Soca. In diesem Alpenfluss in Slowenien ist das Wasser glasklar. Die Fischotter müssen gegen die reißende Strömung ankämpfen. Es ist erstaunlich, welche Kraft sie dabei entwickeln. Die Tiere leben in zwei Welten. Wenn ein Männchen um ein Weibchen werben will, geht es an Land.Mehrere Tage folgt es der auserwählten Partnerin. Sie gibt sich zunächst spröde. Doch nach ein paar Tagen wandelt sich ihr abweisendes Verhalten. Das Happy End zwischen den beiden findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Sie verschwinden im Wasser – dorthin, wo es keine Zuschauer gibt. Zwei Monate später werden in einer Höhle am Fluss zwei Junge geboren. Das Weibchen kümmert sich allein um die Kleinen. Es ist eine anstrengende Zeit für die Fischottermutter. Denn die Jungen wachsen nur sehr langsam, und sie muss ihnen so viel zeigen – die Jagd im Wasser, das Leben an Land. Vor mehr als 100 Jahren kam der in Europa und Asien lebende Fischotter noch an vielen Binnengewässern und Küsten vor. Doch Umweltgifte und die zunehmende Zerstörung seines Lebensraumes ließen seinen Bestand zurückgehen. An vielen Stellen wurde er sogar ausgerottet. Doch inzwischen sind die negativen Schlagzeilen positiven Berichten gewichen. Dort, wo Naturschutzmaßnahmen greifen und die Wasserqualität und die Landschaft wieder naturnaher geworden sind, nimmt die Zahl der Fischotter zu. (Text: WDR) Der Geist Europas – Auf Schottlands Whisky-Routen
Whisky ist mehr als gebranntes Gerstenmalz, er ist der Stolz der Schotten. Eugen Kasparek ist ein Meister des Geschmacks. Er verkauft erlesenen Whisky und veranstaltet Tastings in Berlin. Der Filmautor begleitet Eugen auf seiner Reise in die Welt des schottischen Nationalgetränks. Wie die meisten Spirituosen wurde schottischer Whisky zunächst als Medizin verwendet. Heute ist er das hochprozentige Genussmittel mit dem besten Ruf weltweit und beschert den Schotten einen Exportumsatz von jährlich sechs Milliarden Euro. Eugen Kasparek verkauft erlesenen Whisky und veranstaltet Tastings in Berlin. Einmal im Jahr reist er nach Schottland, um die Menschen hinter der Spirituose zu treffen.Der Filmautor begleitet Eugen auf seiner Reise: Sie führt über die Whisky-Inseln Islay und Skye, durch die schottischen Highlands und nach Glasgow, wo der reinste Whisky höchste Preise erzielt. Die Hebriden-Insel Islay ist die Whisky-Insel schlechthin. Eugen besucht zwei der acht Destillerien und sieht, wie der Whisky gemacht wird. Er ist dabei, als Torf aus dem Moor gestochen wird. Das pflanzliche Brennmaterial gibt dem Insel-Whisky die rauchige Note. In einem Industriegebiet von Glasgow ist Eugen mit David Stirk verabredet, der mit einzelnen Fässern bekannter Destillerien handelt. Single-Cask-Whisky, Abfüllungen aus einem einzelnen Brennvorgang, sind weltweit begehrt. Ein Fass kostet 10.000 Euro aufwärts, und die Preise verdoppeln sich von Jahr zu Jahr. „Noch nie bestand ein so reiches Angebot an Whisky“, sagt der unabhängige Abfüller David, „und noch nie war die Nachfrage so groß.“ Aber ein Ende des Booms ist in Sicht. Gute Holzfässer verschwinden vom Markt. Noch zwanzig Jahre vielleicht, dann könnte das flüssige Gold wieder sein, was es einmal war: Uisge beatha, das Lebenswasser der schottischen Provinz. (Text: BR Fernsehen) Der Geist Europas: Das Wässerchen der Polen
- Alternativtitel: Der Geist Europas: Wodka in Polen
Seit tausend Jahren brennt man überall in Europa geistige Getränke: Ob Wodka, Whisky, Obstbrand oder Absinth, Europas Essenzen und Destillate sind ein hochprozentiges Kulturerbe. In seinem Ursprungsland Polen trinkt man Wodka am liebsten aromatisiert, Barkeeper Andrzej macht sich auf die Suche nach Wodka-Rezepten. Wodka ist weltweit die beliebteste Spirituose. In seinem Ursprungsland Polen trinkt man ihn am liebsten aromatisiert. Jede Region hat ihre Tradition, dem „Wässerchen“ Geschmack zu geben. Andrzej Rachwalski ist Barkeeper und Bartrainer aus Krakau.Er sucht überall in Polen nach alten Wodka-Rezepten und neuen Herstellern. Um Danzig wird Bernsteinwodka als Volksmedizin verwendet. Andrzej trifft an der Ostseeküste einen Bernsteinfischer, der den Wodka ansetzt. In den Masuren, dem Land der tausend Seen, brennt eine Familie „Storchenwodka“. Seit alters her vergräbt man ein Fass davon, wenn ein Kind geboren ist. Aus den Schäferhütten der Tatra stammt der „Tatratee“. Dieser Tee mit Selbstgebranntem und Bergkräutern ist in der nahen Slowakei als Apres-Ski-Getränk in Mode. Im Urwald von Bialowieza, an der Grenze zur Ukraine, sucht Andrzej Bisongras. Der Legende nach ist das geheimnisvolle Gras mit dem Waldmeister-Geschmack nur dort zu finden, wo die wilden Bisons ihr Revier markieren. Polen wächst und verändert sich rasant, besonders die Großstädte. In Warschau entwirft Modest Amaro, der erste Sternekoch Polens, ultramoderne Gerichte mit frischen polnischen Zutaten. Und natürlich mit Wodka. In der kreativen Bar „Dog or Bitch“ stellt Andrzej den Bernsteinwodka auf die Probe. Schmeckt nach Kiefernharz, finden die Barkeeper und mixen einen „Amber Martini“. (Text: BR Fernsehen) Der Geist Europas – Der Duft von Wermut und Anis
Seit tausend Jahren brennt man überall in Europa geistige Getränke, Spirituosen, volkstümlich Schnaps genannt. Ob Wodka, Whisky, Obstbrand oder Absinth, Europas Essenzen und Destillate sind ein hochprozentiges Kulturerbe. In ihnen spiegeln sich Landschaft, Geschichte und Lebensart einer Region. In den Bergen des Schweizer Jura beginnt für Antoine Générau eine Reise, die ihn bis nach Südfrankreich führen wird. Eine Reise in die Welt eines mystischen, einst verbotenen Destillats: des Absinth. Er betreibt einen Handel für Absinth und hält stets Ausschau nach neuen Sorten. Keine Spirituose birgt so viele Geheimnisse und Geschichten wie der Absinth.Absinth ist ein mit Absinthkraut aromatisierter starker Alkohol, der mit Wasser verdünnt getrunken wird. Einst traf sich halb Frankreich, auch Frauen, zur „grünen Stunde“, um der „grünen Fee“ zu huldigen. Der Genuss von Absinth war libertär und geheimnisvoll, 1915 wurde er verboten. An seine Stelle trat der Pastis, der heute aus Südfrankreich nicht mehr wegzudenken ist. Aber der Absinth hat noch andere Geschwister: In den Bergen der Chartreuse brennen seit 500 Jahren Schweigemönche der Großen Kartause ihren grünen Likör. Nur zwei Mönche kennen das Rezept. In den Hochalpen wachsen die Kräuter für den Génépi, und an der Mittelmeerküste werden Weine mit Kräutern und Gewürzen zu einem trockenen Wermut veredelt. Antoine Générau, 30, ist Absinth-Händler. Er sucht nach neuen Sorten – heute ist Absinth wieder erlaubt – und nach Original-Absinth aus der Zeit vor dem Verbot, nach sogenannten „alten Flaschen“, die Tausende Euro kosten können. Die Dokumentation begleitet ihn auf einer Einkaufstour vom Schweizer Juragebirge quer durch Frankreich bis ans Mittelmeer. Das Kamerateam begegnet Brennern und Kennern und taucht ein in Geschichte, Kultur und Landschaften eines geheimnisumwitterten Getränks. (Text: ARD-alpha) Der Geist Europas – Obstbrände aus den Bergen
Obstbrand ist ein Produkt der bäuerlichen Landwirtschaft zur Selbstversorgung, ein Relikt aus einer Zeit, als Vieh-, Obst- und Ackerwirtschaft noch kombiniert waren. Die Oberliga der exquisiten Drinks war dem Bauernschnaps lange Zeit versperrt. Doch seit wenigen Jahren holt er auf und findet immer häufiger Verwendung in den Mixgetränken hipper Metropolenbars. Helmut Adam ist Herausgeber von „Mixology“, einer Berliner Zeitschrift für Barkultur, die Trends setzt unter Europas Barkeepern und Cocktailfans. Ausgerechnet die Essenzen der Streuobstwiesen des Alpenvorlandes haben es dem Journalisten angetan.„Das Regionale ist das neue Coole“, meint er und bricht zu einer Recherchereise in den Süden auf. Am Zugersee in der Zentralschweiz wachsen die wohl besten Brennkirschen der Welt. Anfang Juni findet der Chriesisturm, deutsch: der Kirschensturm, statt, ein Wettrennen mit über acht Meter langen Leitern durch die Zuger Altstadt. Helmut Adam will sich das Ereignis anschauen und die lokalen Brenner besuchen. Die weitere Reise führt ihn nach Graubünden ins abgelegene Val Müstair, wo Luciano und Gisi Beretta die höchst gelegene Brennerei der Welt betreiben. Helmut Adam hat gehört, dass die Berettas Heilpflanzen wie die Schafgarbe oder „Betschlas“, die Samen der Zirbelkiefer, destillieren. Wie das wohl schmeckt? Über 1.000 Meter hoch liegt in den österreichischen Alpen das Dorf Stanz – 600 Einwohner, davon 80 Brenner. Auf den Stanzer Terrassen ist das Obst starker Sonne und Kälte ausgesetzt, das bekommt vor allem dem Spenling, einer seltenen Pflaumenart. Helmut Adam hat Glück. Er kommt nach Stanz, als die Brenner ihren Stammtisch abhalten. Längst destillieren sie auf hohem technischem Niveau. Wer hat den besten Spenling im Brennerdorf? Marktkenner wie Helmut Adam sagen dem Obstbrand eine Weltkarriere voraus. Er findet: „Whisky und Wodka kann man überall in der Welt herstellen. Obstbrand ist made in GSA, in Germany-Switzerland-Austria, den haben wir exklusiv.“ Hinzu kommt, dass Obstschnaps bis heute eine Domäne kleiner bis mittelgroßer Brennereien ist. Die Konzerne, die den Markt bei Gin, Rum, Wodka beherrschen, spielen beim Obstbrand keine Rolle. Oder wie die Bauern sagen: Beim Obstler steht hinter jedem Brand ein Brenner. (Text: SWR) Der Geist Europas – Wodka in Polen
Wodka ist weltweit die beliebteste Spirituose. In seinem Ursprungsland Polen trinkt man ihn am liebsten aromatisiert. Jede Region hat ihre Tradition, dem „Wässerchen“ Geschmack zu geben. Andrzej Rachwalski ist Barkeeper und Bartrainer aus Krakau. Er sucht überall in Polen nach alten Wodka-Rezepten und neuen Herstellern. Der Film begleitet Andrzej auf der Reise. Um Danzig wird Bernsteinwodka als Volksmedizin verwendet. Aber echter Bernstein ist nicht leicht zu finden. Andrzej trifft an der Ostseeküste einen Bernsteinfischer, der den Wodka ansetzt.In den Masuren, dem Land der Tausend Seen, brennt eine Familie „Storchenwodka“. Seit alters her vergräbt man ein Fass davon, wenn ein Kind geboren ist. Andrzej besucht die Brennerei, als das Wodka-Ritual zelebriert wird. Gute Story für die Bar. Aus den Schäferhütten der Tatra stammt der „Tatratee“. Dieser Tee mit Selbstgebranntem und Bergkräutern ist in der nahen Slowakei als Après-Ski-Getränk in Mode. Andrzej will das ursprüngliche Rezept herausbekommen. Im Urwald von Bialowieza, an der Grenze zur Ukraine, sucht er Bisongras. Der Legende nach ist das geheimnisvolle Gras mit dem Waldmeister-Geschmack nur dort zu finden, wo die wilden Bisons ihr Revier markieren. Polen wächst und verändert sich rasant, besonders die Großstädte. In Warschau entwirft Modest Amaro, der erste Sternekoch Polens, ultra-moderne Gerichte mit frischen polnischen Zutaten. Und natürlich mit Wodka. In der kreativen Bar „Dog or Bitch“ stellt Andrzej den Bernsteinwodka auf die Probe. Schmeckt nach Kiefernharz, finden die Barkeeper und mixen einen „Amber Martini“. Einen modernen Drink mit Tradition. Passend zum heutigen Polen. (Text: SWR) Gemeinschaft macht stark – Die Sami in Lappland
Langzeitdokumentation über die Samen in Lappland. Zwei Jahre lang beobachtet der Filmemacher Petteri Saario das Leben der Samen, die Ureinwohner Lapplands, das sich nördlich des Polarkreises über eine großen Teil der Staatsgebiete von Schweden, Norwegen und Finnland erstreckt. Im äußersten Norden Finnisch-Lapplands, auf dem 69. Breitengrad, wohnt der nächste Nachbar schon mal 50 Kilometer weit entfernt. Der 82-jährigen Sami Kirstti Laiti machen solche Nebensächlichkeiten nichts aus. Die verwitwete Rentierzüchterin bewohnt und bewirtschaftet ihren Hof allein.Natürlich gibt es dort elektrischen Strom und Telefon, aber alles Lebensnotwendige, vom traditionellen Fellstiefel bis hin zum Kochgeschirr, vermag sie noch selbst anzufertigen, aus Rentierhäuten, Horn oder Holz. Auch ihr Sohn Niila Laiti übt den traditionellen Beruf des Rentierzüchters aus. Hölzerne Rentierschlitten und verqualmte Nomadenzelte gehören für den 38-Jährigen jedoch endgültig der Vergangenheit an. Skidoos haben die Schlitten ersetzt, komfortable Holzhäuser die Zelte, die mit tropischen Orchideen und modernen Möbeln eingerichtet sind. Auch wenn Niilas Frau Annukka keine Fellschuhe nähen kann und mag, so versucht auch sie, die kulturelle Identität der Sami zu bewahren. Die Komponistin und Sängerin pflegt den klassischen Gesang ihres Volkes, den Joik, manche ihrer Kollegen lassen die Tundra dagegen mit Saami-Punk-Rock erbeben. Der finnische Dokumentarfilmer Petteri Saario hat die Familie Laiti fast drei Jahre lang begleitet. Er gibt einen intimen Einblick in das Leben moderner Sami, Menschen, über die die wenigsten ihrer Landsleute mehr wissen, als dass man sie nicht „Lappen“ schimpfen darf. (Text: BR Fernsehen) Georgiens wilde Schönheit – Durch die Bergwelten des Kaukasus
45 Min.So klein Georgien sein mag, gerade einmal so groß wie Bayern, ist das Land ein Kosmos unterschiedlichster Welten. Geografisch und kulturell zwischen Europa und Asien, mit Schwarzmeerküste und majestätischen Bergpanoramen, ein Teil Europas, angrenzend an Aserbaidschan. Besonders wild und ursprünglich ist es in Pschaw-Chewsuretien. Nicht einmal 3000 Menschen leben in dieser einsamen Bergregion. In den schwer zugänglichen Tälern mischen sich Traditionen aus christlicher und heidnischer Zeit. Die Dörfer liegen inmitten der eindrucksvollen Natur des georgischen Hochgebirges mit seinen zum Teil über 5000 Meter hohen Gipfeln.Das Dorf Schatili, entstanden im Mittelalter, ist nur vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Es steht für die einzigartige Architektur- und Baukunst dieser Region. Schatili ist in den Berghang hineingebaut und scheint aus den Felsen heraus zu wachsen. Das Dorf ist eine einzige Festung: 60 Wehrtürme haben das Land nach Nordosten hin gesichert. Seit Jahrtausenden spielen Pferde eine große Rolle im Leben der Einheimischen. Die Herden leben frei in den Nationalparks. Sie kommen Ende Oktober aus den Bergen des Kaukasus, um in den milderen Gebieten im Südosten zu überwintern. Bei traditionellen Rennen werden die Pferde ohne Sattel geritten. Die Bewohner des dünn besiedelten Chewsuretiens halten an ihren meist vorchristlichen Bräuchen fest. Dazu zählt das Atengenoba-Fest, das Fest der Gemeinschaft. Die Natur und die Traditionen in Pschaw-Chewsuretien im Kaukasus sind weitgehend ursprünglich geblieben, weil die übrige Zivilisation von ihnen kaum Notiz genommen hat. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.09.2023 NDR Georgiens wilde Schönheit – Von der Schwarzmeer-Küste in die Berge
45 Min.Georgien hat unzählige Naturparadiese, eines davon liegt im Westen des kleinen Landes: der Nationalpark Kolcheti. Das Kolchis-Gebiet ist die Wiege der georgischen Identität mit einer einzigartigen Landschaft. Uralte Regenwälder und Feuchtgebiete machen die Region an der Schwarzmeerküste so besonders. Früher gab es hier, im sogenannten „Amazonas Georgiens“, viel Abholzung. Doch mit der jungen Generation wächst ein neues Bewusstsein. Die Umweltschützerinnen Alexandra und Eleni pflanzen selbst gezogene Eichensetzlinge im Wald. Tief im Gebirge entspringt der Fluss Techuri.Mischa Mindiaschwili will ihn zum ersten Mal befahren. Er ist Georgiens Kajak-Pionier, Wildwasser ist seine Leidenschaft. In der Nokalakevi-Schlucht wärmt er sich bei den heißen Schwefelquellen auf. Doch dann wird ihm eine reißende Stromschnelle zum Verhängnis. Chöre und traditionelle Volkslieder sind ein wichtiger Teil der georgischen Kultur. Auch für Giwi Abesadse spielte Gesang schon immer eine große Rolle. Bei den Proben mit Freunden für ein Kirchenkonzert zeigt sich, dass auch Trinksprüche nicht fehlen dürfen. Angestoßen wird auf die Familie, Freunde, Verstorbene. Und natürlich auf die Musik. Giwi ist mit seiner Heimatstadt Poti stark verwurzelt. Hier besucht er seinen alten Gesangslehrer, der mit 80 Jahren immer noch Kinder unterrichtet. Am Nordrand des Kleinen Kaukasus liegt der Nationalpark Bordschomi-Charagauli. Grüne Schluchten und 2000 Meter hohe Berge prägen hier die Landschaft. Im Wald sind die Zapfenpflücker Zurab und sein Enkel Nicolas auf der Suche nach grünen Kiefernzapfen. Daraus machen sie Sirup, um ihren Unterhalt zu verdienen. Doch dieses Jahr ist die Ernte schlecht, das Wetter spielt verrückt. Nach einer zweijährigen Zwangspause startet der legendäre Kukushka-Zug im Kurort Bordschomi. Ein großer Tag für Lokführer und Passagiere. Die Fahrt führt durch dichte Wälder und über Blumenwiesen. Aber auch durch verlassene Ortschaften und das postsowjetische Erbe Georgiens. Der Kukushka ist nicht mehr rentabel und soll eingestellt werden. Die 16-jährige Irina lebt im Bergdorf Tabatskuri. Die Winter sind lang und hart, gerade erst schmilzt der letzte Schnee. Die rund 200 Familien hier leben isoliert, ohne Perspektiven. Nach ihrem Schulabschluss wird Irina ihr Dorf verlassen müssen. Auf der Suche nach einer besseren Zukunft. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 14.09.2023 NDR Georgien – Von Null auf 5000
In den kleinen Kapellen steht die swanetische Ikonenmalerei unter besonderem Schutz. Swanetien ist einer der Superlative in einem Land, das kleiner ist als Bayern, aber die Vielfalt eines ganzen Kontinentes bietet: Georgien, eingebettet zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer, zwischen großem und kleinen Kaukasus. Europa im Blick, Russland im Nacken, zwischen Tradition und Aufbruch. In der Hafenstadt Batumi träumen sie davon, das Las Vegas des Ostens zu werden, während in Kachetien der Wein noch immer in riesigen Tongefäßen, den Kvevris, gekeltert wird.Überall beweisen Georgier ihre Gastfreundschaft, Kochkunst und Trinkfestigkeit. In Tschiatura mit seinen Bergwerken vertrauen die Menschen auf die alte Sowjettechnik, Seilbahnen sind noch immer das Hauptverkehrsmittel. Im Vashlowani Nationalpark mit seinen bizarren Felsformationen wirbt Ranger Vashlo um zukünftige Touristen. „Vor ein paar Jahren haben wir hier sogar einen der vom Aussterben bedrohten kaukasischen Leoparden gesehen“, schwärmt er. (Text: rbb) Der Gepardenmensch – Eine unglaubliche Begegnung von Mensch und Tier
„Ich bin ein Gepard“, sagt Matto Barfuss von sich. Der Film erzählt in beeindruckenden Bildern von einer faszinierenden Beziehung zwischen Gepard und Mensch. Die Filmautorin Ilona Rothin begleitetet den „Gepardenmann“ zwei Wochen lang auf seiner Reise zurück zu den schnellsten Jägern der Welt. Matto Barfuss, ein Deutscher, war zunächst als Künstler und Fotograf bekannt geworden, bevor er sich mit einer Gepardenfamilie in Tansania anfreundete. Dort, am Rande der Serengeti, lebte er als ein „Familienmitglied“ unter den wilden Raubkatzen.Als die Gepardenmutter eine Gazelle riss, zerfleischte die Familie das erbeutete Tier. Doch Matto wagte es in dieser Situation, den erregten Geparden näher zu kommen und sie zu streicheln. Das Vertrauen zwischen Mensch und Tier wuchs. Die Gepardenmutter überließ bisweilen sogar die Wache dem eigenartigen „Männchen“. Während die Gepardin nach Beute Ausschau hielt, spielte Matto Barfuss mit ihren Jungen. Der Film dokumentiert dieses außergewöhnliche Familienleben vor der beeindruckenden Kulisse der afrikanischen Steppe. (Text: hr-fernsehen) Deutsche TV-Premiere Mi. 05.04.2000 Südwest Fernsehen von Ilona RothinGequältes Paradies – Das Naturreservat Bosawas in Nicaragua
Deutsche TV-Premiere So. 05.12.2004 Südwest Fernsehen von Carmen ButtaDer Gipfel des Lamas – Puna, Peru – Auf 4.200 Meter
Es hatte wochenlang geregnet, die kleinen Gebirgsbäche in den Anden wurden zu reißenden Sturzfluten. Der Reporter Peter Weinert und sein Team überlegten lange, ob sie es wirklich wagen sollten, die gefährliche Gebirgsstrecke nach Puna, einem kleinen Andendorf auf 4.200 Meter Höhe, mit dem schwer beladenen Auto fahren sollten. Luco, der peruanische Führer, wechselt ein paar schnelle Worte mit dem Fahrer. Der tritt gegen den vorderen Reifen, spuckt aus und lächelt dann breit: „No problema“. Sie fahren. Das schwere Filmgepäck, darunter ein Stromgenerator, werden verpackt. Dann ächzt der Wagen los, über schmale Holzbrücken die Gebirgspässe hoch. Die Luft wird dünner. Nach zwei Tagen Fahrt sind sie am Ziel, die Hochlandindios haben sie schon erwartet.Weinert und sein Team packen mit an, als im strömenden Regen kleine Hütten für sie errichtet werden. Drei Familien leben hier, sozusagen zwischen Himmel und Erde; sie teilen sich alles, das Vieh, die Nahrungsmittel. Es ist kalt hier oben, besonders nachts, die Familien mümmeln sich in ihre Felle. Weinert und seine Kollegen freunden sich mit den Indios an, mit Handzeichen und anderen Verrenkungen versuchen sie sich verständlich zu machen. Die Indios hier oben reden nämlich fast nie. Es gilt als unhöflich, „geschwätzig“ zu sein. Nach 14 Tagen reist das Reporterteam wieder ab. Es hat die Familien auf Schritt und Tritt in den hohen Anden begleitet und beobachtet. (Text: hr-fernsehen) Giraffen auf Achse – Sanfte Riesen als Friedensbotschafter
45 Min.In freier Wildbahn leben heute weniger Giraffen als afrikanische Elefanten. Die Rothschild Giraffe ist besonders selten.Bild: NDR/MedienKontor/Therese EngelsGroße Herden von Rothschild-Giraffen durchstreiften früher den Grabenbruch am Baringosee in Kenia. Dürren, Wilderei und ein blutiger ethnischer Konflikt haben die Bestände hier fast ausgerottet. Dann starteten die Stammesältesten der rivalisierenden Volksgruppen ein Wiederansiedlungsprojekt im Ruko-Schutzgebiet. Dafür werden Giraffen in anderen Regionen Kenias eingefangen und an den Baringosee umgesiedelt. Die Reise der Tiere führt auf Lkw über 140 Kilometer unbefestigte Straßen und unter tiefhängenden Stromleitungen hindurch. Eine ungewöhnliche logistische Herausforderung.Schon das Einfangen und Betäuben einer Giraffe ist ein riskantes Manöver, denn ihr besonderes Kreislaufsystem macht sie anfällig für tödliche Narkosezwischenfälle. Das Team vom Kenya Wildlife Service, der staatlichen Wildschutzbehörde, hat deshalb nur zehn Minuten Zeit für Untersuchungen und nötige Behandlungen. Die Umsiedlung dient einem höheren Ziel: die Population der Rothschild-Giraffen zu vergrößern und den genetischen Austausch zwischen isolierten Gruppen zu ermöglichen. In Ruko am Baringosee werden die seltenen Tiere unter den Schutz der einheimischen Bevölkerung gestellt. Sie sollen nicht nur die Zahl der Tiere wieder anwachsen lassen, sondern auch neue Jobs schaffen, Touristen anziehen und den prekären Frieden zwischen den um die spärlichen Ressourcen konkurrierenden Volksgruppen der Pokot und Ilchamus stärken. Früher waren die beiden Ethnien erbitterte Gegner. Sie kämpften um Wasser in dem trockenen Gebiet, stahlen Vieh, töteten einander. Heute herrscht ein fragiler Frieden. Die Giraffen sollen helfen, ihn zu bewahren. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 23.10.2025 NDR Giudecca
Das Glück der Freiheit – Unterwegs in Litauen
Der Film aus der Reihe „Länder Menschen – Abenteuer“ begibt sich auf eine Reise durch Litauen und stellt Menschen vor, die zwischen Tradition und Moderne an ihrer Zukunft arbeiten. Das ist auch nach mehr als 25 Jahren der Unabhängigkeit nicht immer einfach. So wird der Alltag häufig zu einem Abenteuer. Wer zum ersten Mal nach Litauen kommt, ist beeindruckt von der einzigartigen Landschaft. Die Dünen auf der Kurischen Nehrung wirken wie Skulpturen, die der Wind geschaffen hat. Je weiter man nach Osten reist, desto hügeliger wird die Landschaft. Der blaue Himmel und die grünen Felder, die bis zum Horizont reichen, machen die Reise durch Litauen im baltischen Sommer zu einem einzigartigen Erlebnis.1991 wurde das Land unabhängig. Seitdem verläuft eine Grenze quer über die Kurische Nehrung. Auf der einen Seite liegt die unabhängige Region Kaliningrad, der westliche Außenposten Russlands, auf der anderen Seite Litauen. Die Nehrung ist ein schmaler Küstenstreifen mit wunderschönen Sandstränden und einem Nationalpark, in dem die einzigartige Fauna und Flora gedeihen kann. Schon der Schriftsteller Thomas Mann suchte hier Entspannung. Ausra Feser leitet den Nationalpark und schaut ganz genau hin, ob sich die vielen Urlauber auf den vorgesehenen Wegen aufhalten oder doch wieder auf eigene Faust unterwegs sind. Die Dünen sind ständig in Bewegung und machen es den Pflanzen schwer, im sandigen Boden Wurzeln zu schlagen. Unvorsichtige Touristen stören da nur. Naturschützerin Ausra Feser findet es gut, dass eine EU-Grenze mitten durch die Nehrung geht. Denn direkt daran liegt das Sperrgebiet. Dort darf sich niemand ohne offizielle Genehmigung aufhalten. Mit den litauischen Grenzsoldaten geht sie häufig an der Grenze auf Streife. Hier können Pflanzen besonders gut wachsen. Das Filmteam begleitet Ausra Feser bei ihrem Einsatz für die Natur auf der Kurischen Nehrung. Auch Gointautas Pyragas ist regelmäßig an der Grenze zu Kaliningrad unterwegs, auf einem kleinen See, der nur zur Hälfte auf litauischem Territorium liegt. Der Bastler liebt Unterseeboote und hat sich sein eigenes gelbes U-Boot gebaut, mit dem er den See durchquert. Viel Zeit verbringt der leidenschaftliche Bastler in seiner Werkstatt, wenn wieder mal ein Teil am U-Boot fehlt oder eine Reparatur nötig ist. Das Filmteam geht mit Gointautas auf Tauchfahrt. Bleibt zu hoffen, dass sein U-Boot fehlerfrei funktioniert! Weiter nördlich hat sich Andrius Sironas einer ganz besonderen Pflanze verschrieben. Der Landwirt ist leidenschaftlicher Hanf-Bauer! Er will die alte Nutzpflanze wieder populär machen, auch wenn viele vor allem den Drogenrausch mit Hanf verbinden. Andrius baut Hanf an, der für Öle, Salben und Salate genutzt werden kann. Freunde und Hanf-Liebhaber aus ganz Europa besuchen den Hanf-Bauern. Weiter im Osten Litauens beginnt im Frühsommer eine ganz besondere Theatertournee: In der Kreisstadt Panevezys packt Regisseur Antanas Markuckis den Pferdewagen zusammen, der gleichzeitig die Bühne seines Puppentheaters ist. Er leitet das kleine Puppentheater, eines der letzten im Land. Im Sommer verlässt er mit seinen Puppenspielern die heimische Bühne und fährt fährt über Land. Für die Kinder in den einsamen Dörfern spielen sie in diesem Jahr ihre Version von „Rotkäppchen und der Wolf“. Und weil in den Dörfern kaum etwas passiert, kommen Groß und Klein gerne und lassen sich von den Puppenspielern und ihrer mobilen Bühne für eine Stunde in ein Märchen entführen. (Text: NDR) Göreme – Zuhause in den Höhlen
Deutsche TV-Premiere Mi. 09.09.1992 S3 von Andus Emge und Shahid SheikhGötter, Glauben, Geishas – Eine Reise durch Japan
Die „Reise durch Japan“ führt von Tokio, wo Filmautor Joachim Schröder hinter die Kulissen eines traditionellen Kabuki-Theaters schaut, mit dem Zug über Kyoto nach Nagoya zu einem traditionellen japanischen Bauernhof, von dort zur sagenumwobenen „Götterinsel“ Miyajima vor der Kulisse Hiroshimas. Schröder lernt „normale“ Japaner in ihrem alltäglichen Leben kennen wie auch in Japan bekannte Persönlichkeiten, die ganz persönlich das traditionelle Japan vermitteln. Geschildert werden nicht nur kulturelle Highlights und Feste, sondern auch das ganz alltägliche Leben, etwa Fischer bei der Arbeit und die Zubereitung japanischer Gerichte. (Text: hr-fernsehen)Das Gold des Himalaja – Nomadenleben in Ladakh
Ein Porträt der Changpa-Nomaden im äußersten Norden Indiens, in der unwirtlichen Hochebene Changtang, die höchste von Menschen bewohnte Gegend der Welt. Die Changpa-Nomaden leben im äußersten Norden Indiens, in Ladakh, an der Grenze zu Tibet. Mit Yaks, Schafen und Ziegen wandern sie über Hochebenen, die so einsam sind, dass sie von den anderen Ladakhis „irgendwo da draußen“ genannt werden. Changtang lautet der Name dieser Landschaft, in der die Luft dünn und der Wind eisig ist, und die die höchste von Menschen bewohnte Gegend der Welt ist. Im kurzen Gebirgssommer war Filmautor Thomas Wartmann drei Wochen mit den Changpa unterwegs – in einer Höhe von über 4.000 Metern, nur hier wächst den Ziegen im Fell ein wärmendes Unterkleid.Sobald der Sommer kommt, werden diese feinsten Haare heraus gekämmt, gesäubert und an Großhändler verkauft. In der Hauptstadt Leh wird das wertvolle Ziegenhaar dann zu Paschmina-Wolle gesponnen und in die ganze Welt exportiert. Auch wenn die Bergnomaden das Endprodukt – die teuren Kaschmirpullover und Schals – nie zu Gesicht bekommen, ist Paschmina für sie das „Gold“ des Changtang. „Es ist das, was uns satt macht, das Einzige, was uns ernährt“, sagt der alte Nomade Tarchen. Tarchens Sohn Norbu ist kein Freund der Tradition. Der 19-Jährige hat in der Hauptstadt Leh die Schule besucht, sie jedoch ohne Abschluss verlassen, weil er von einem Job als Taxi- oder LKW-Fahrer träumt. (Text: BR Fernsehen) Goldenes Goa – Klein-Portugal an Indiens Küste
Deutsche TV-Premiere Sa. 04.10.1986 S3 von Rainer SchirraGoldrausch im Himalaja
Eine Bergbauernfamilie der Region Dolpo im Norden Nepals bricht im Mai in entlegene Höhen auf, um einen kostbaren Pilz zu suchen , den Yarsagumbu. Schon zwei der winzigen Pilze bringen so viel ein wie ein Tag Arbeit im Straßenbau. Ein Filmteam hat die Familie begleitet. In bis zu 5.000 Metern Höhe wächst eines der wertvollsten Heilmittel der traditionellen tibetischen und chinesischen Medizin: der Yarsagumbu. Ein Wundermittel, das schon von den Ming-Kaisern geschätzt wurde, und das heute am Umschlagplatz Hongkong für 40.000 Euro pro Kilo gehandelt wird.Wörtlich übersetzt bedeutet Yarsagumbu „Sommergras-Winterwurm“. Der etwa zwölf Zentimeter lange, dünn-knorrige Raupenpilz ist eine faszinierende Verbindung von Pflanze und Tier. Sie kommt zustande, wenn die in der kalten Jahreszeit eingegrabene Yarsagumbu-Raupe von einem Parasitenpilz, dem Cordyceps, befallen wird. Dieser wächst in ihr heran und ernährt sich möglichst lange von ihr, ohne ihre lebenswichtigen Organe zu beschädigen. Erst im Frühjahr sprengt er den Raupenkörper und wächst aus dem Kopf heraus an die Erdoberfläche. Pro Jahr werden im Himalaja bis zu 200 Tonnen des Raupenpilzes gesammelt. Er soll die Abwehrkräfte stärken und als Aphrodisiakum wirken. Inzwischen ist der Hype um das „Himalaja-Viagra“ auch in Amerika und Europa angekommen. Filmautor Eric Valli begleitet eine Familie der Region Dolpo im Norden Nepals, als sie im Mai aufbricht, um den kostbaren Pilz in entlegenen Höhen zu suchen. Wie viele verlässt sich der Bergbauer Suga Lal vor allem auf seine Kinder, denn mit ihren scharfen Augen entdecken sie den unscheinbaren Pilz viel leichter als die Erwachsenen. Vor allem der achtjährige Sohn Raj erweist sich als talentiert und erfolgreich. Obwohl der Vater die erste Ausbeute in einem der Bergcamps beim Würfelspiel gleich wieder verliert, erntet die Familie am Ende doch eine ansehnliche Menge, die sie einem Zwischenhändler übergibt. Dieser reist nach Hongkong, wo Großhändler sitzen, die die Ernte der Bergbauern quasi zu Goldpreisen weiterverkaufen. (Text: BR Fernsehen) Die Goldsucher von El Dorado
Golfstrom – Der große Fluss am Meer: Von den Azoren an den Polarkreis
Im zweiten Teil der Dokumentation geht die Reise von den vulkanischen Azoren über die Bretagne in Frankreich in den Nordwesten Irlands. Vom schottischen Orkney-Archipel folgt der Filmautor Rolf Lambert dem Golfstrom über Island bis auf die Lofoten in Norwegen. Und er begleitet ein Forschungsschiff bis vor die Küste Grönlands. Der Golfstrom ist die mächtigste Strömung der Welt. Er transportiert fast hundertmal so viel Wasser wie alle Flüsse der Welt zusammen. Als Teil eines globalen Kreislaufs von Meeresströmungen bringt er Wärme vom Golf von Mexiko bis in den äußersten Norden Europas. Tiefseefische, die mit dem Golfstrom reisen, werden mit Sendern ausgestattet und Ingenieure entwickeln eine neue Generation von Hightech-Bojen, die Meeresströmungen bis in eine Tiefe von 4.000 Metern erforschen sollen.Rolf Lambert zeigt in seiner Dokumentation experimentierfreudige Gärtner in Irland, hartgesottene Dorschfischer in Norwegen und Archäologen im Norden Schottlands, die nachweisen, dass der Golfstrom die Siedlungsgeschichte Europas schon in der Jungsteinzeit beeinflusst hat. Mitten auf dem Nordatlantik, wo der Golfstrom in riesigen Wasserfällen in die Tiefe sinkt, untersuchen Wissenschaftler den Einfluss des Klimawandels auf die Strömung. Durch das Abschmelzen des Grönlandeises schwächt sie sich ab. (Text: BR Fernsehen)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail