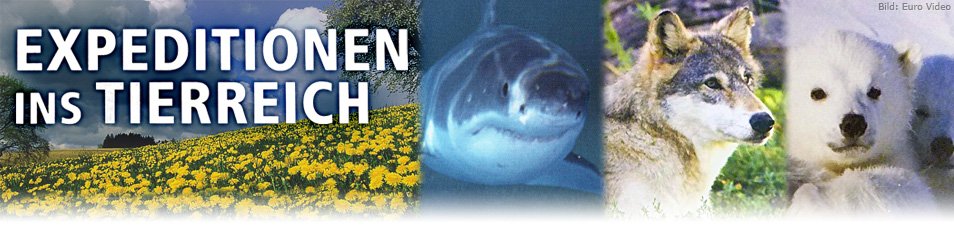unvollständige Folgenliste (alphabetisch) (Seite 9)
Polarwölfe (2) Familienbande
45 Min.Im äußersten Norden Kanadas liegt eine der unwirtlichsten Regionen der Erde: Ellesmere Island. Knapp 800 Kilometer vom Nordpol entfernt, ist die Insel die Heimat von Polarwölfen. Der Film folgt dem Eureka-Rudel und zeigt seinen Kampf ums Überleben und seinen enormen Einsatz bei der Aufzucht der Welpen. Snow White und Alpha, die Eltern des Rudels, sind schon seit Jahren ein eingespieltes Team. Im kurzen arktischen Sommer versuchen sie, eine neue Generation Welpen großzuziehen. Keine leichte Aufgabe. Gefahren lauern überall, vor allem fremde Wolfsrudel stellen eine tödliche Bedrohung dar.Snow White hat zum Glück den Schutz ihres Rudels. Und sie bekommt Unterstützung, als ein einzelnes Weibchen zur Familie stößt: Blackspot. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nicht nur um Snow Whites Nachwuchs kümmert, sondern ihn sogar säugt. Ein Verhalten, das noch nie gefilmt werden konnte und selbst für Wissenschaftler erstaunlich ist. Die Zusammenarbeit der beiden Weibchen verschafft den Welpen einen Vorteil und erhöht ihre Chancen, die ersten Wochen zu überleben. Auch wenn der Sommer auf Ellesmere Island als Zeit des Überflusses erscheint, gibt es in der Arktis keine Jahreszeiten, in denen das Überleben einfach ist. Nahrung ist für die Wölfe nicht leicht zu finden und sie müssen weit laufen, um ausreichend Beute zu machen. Blackspot und Snow White sind durch die Welpen an die Höhle gebunden. Und während die Leitwölfin vom Rudel versorgt wird, geht die Amme meist leer aus. Eine tragische Situation, die Snow White dazu zwingt, mit ihren Jungen weiterzuziehen. Eine Reise voller Gefahren. Werden sie und ihre Welpen überleben? (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 28.11.2018 NDR Polarwölfe (3) Das Abenteuer
45 Min.Im äußersten Norden Kanadas liegt eine der unwirtlichsten Regionen der Erde. Nur wenige Tiere haben geschafft, hier ganzjährig überleben zu können: Ellesmere Island. Knapp 1.000 Kilometer vom Nordpol entfernt und mehr als halb so groß wie Deutschland ist die Insel die Heimat von Polarwölfen. Tierfilmer Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg sowie der kanadische Zeitrafferspezialist Alain Lusignan begeben sich auf mehrere Reisen, um die seltenen Tiere zu filmen und deren Familienleben zu zeigen, wie es noch nie zuvor gelungen ist. Es wurde eine Reise, die auch ihr Leben verändern sollte.Das Abenteuer beginnt im Winter. Die wenigen Crews, die bisher überhaupt auf Ellesmere Island gedreht haben, kamen meist im Sommer. Aus gutem Grund: Temperaturen von minus 40 Grad Celsius sind eher die Regel als die Ausnahme, eine extreme Herausforderung für das Team und die Technik. Akkus halten unter solchen Bedingungen nur einen Bruchteil der normalen Zeit, Kabel brechen und Objektive müssen geheizt werden, damit sie nicht festfrieren. Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg sind nur durch ihre dicke Kleidung geschützt. Aber nach fünf Stunden Warten auf die Wölfe, reicht auch das nicht. Als sich nach fast einer Woche die ersten Tiere an einem Kadaver zeigen, sind selbst die Erfrierungen an der Nase schnell vergessen. Zur Belohnung ihrer Geduld kommen ihnen die Polarwölfe näher, als sie es sich je erträumt hätten. Der Winterdreh war für alle extrem hart, aber es hat sich gelohnt. Doch die größten Herausforderungen erwarten das Team erst noch. Es ist Ende Mai, als Oliver, Ivo und Alain wieder nach Ellesmere Island kommen. Diesmal müssen sie nicht nur Wölfe finden, sondern die Höhle des Rudels, in der es seine Welpen großzieht. Anfänglich bleibt die Suche erfolglos und die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. Wenn sie es nicht schaffen sollten, könnte das ganze Projekt platzen. Doch dann hilft ihnen der Zufall: Als sie mit dem Helikopter über eine Polarfuchshöhle fliegen, die bisher noch nie von Wölfen genutzt wurde, entdecken sie ein einzelnes Weibchen. Die Tierfilmer haben ihren Hauptdrehort gefunden. Endlich kann es losgehen. Nun muss „nur“ noch die gesamte Ausrüstung inklusive mehrerer Quads zur Höhle geflogen werden. Das Team hat alles dabei, was man für zwei Monate Leben in der Wildnis benötigt. Nicht vor Anfang August wird es zurückkehren. Was ihnen allen bevorsteht, ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Naturdokumentation hautnah miterleben. Zwischen überschwänglicher Freude und tiefer Trauer ist alles dabei. Am Ende wird die Ausdauer der Crew belohnt. Die Reise ans Ende der Welt wird zum größten Abenteuer ihres Lebens.“ (Text: hr-fernsehen) Deutsche TV-Premiere Mi. 05.12.2018 NDR Polens Osten – Zwischen Wisenten, Wölfen und Elchen
45 Min.Der Osten Polens ist eine der letzten richtig wilden Regionen Europas mit Tieren, die anderswo längst verschwunden sind. Im Urwald von Białowieża, an der Grenze von Polen und Belarus, leben rund 1500 Wisente, riesige und ausdauernde Wildrinder. Die Niederungen in Biebrza bilden den größten Nationalpark Polens und sind für Biber, Fischotter und zahllose Wasservögel von größtem Wert. Doch selbst hier ist die Natur in Gefahr! Autobahnen und intensive Landwirtschaft machen auch vor der Natur im Osten Polens nicht halt. Doch noch zeigt die Natur hier einen Artenreichtum, der in Europa seinesgleichen sucht.Bis 1952 stand es schlecht um die Wisente. In freier Wildbahn waren sie ausgestorben, nur wenige Exemplare überlebten in Gefangenschaft. Dank eines internationalen Zuchtprogramms ist es gelungen, Wisente im Urwald von Białowieża anzusiedeln. Dabei spielen sie für den Artenschutz eine bedeutende Rolle: Als sogenannte Lebensraumgestalter halten sie Wälder offen und sorgen für Strukturreichtum in der Landschaft. Dank ihres dichten Fells sind Wisente Kältespezialisten. Selbst Temperaturen weit unter minus 20 Grad Celsius sind für sie kein Problem. Die Biebrza Niederungen sind ein Paradies für Biber und Fischotter. Über 100 Kilometer schlängelt sich das Flusstal durch die Landschaft. Hier finden die größten Nagetiere Europas und die agilen Wassermarder noch ausreichend Lebensraum und Nahrung. Die beiden ungleichen Nachbarn haben eine Gemeinsamkeit: mit ihrem dichten Pelz, der selbst eisige Kälte abhält, sind Biber und Fischotter hervorragend an ihren Lebensraum angepasst. Etwa 2500 Wölfe leben noch in Polen, rund vier- bis fünfmal so viele wie in Deutschland. Die Menschen haben sich mit den Rudeln arrangiert, selbst wenn sie im Winter näher an die Dörfer herankommen. Gefährlich sind die Wölfe allerdings für viele Wildtiere, selbst für Elche, die größte aller Hirscharten. Wie viel Raum den Tieren zugestanden wird und wie ihre Zukunft aussieht, liegt ganz allein in der Hand des Menschen. Im Osten Polens hätten Wisente, Wölfe, Elche und all die anderen Wildtiere eine gute Chance, zu überleben. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 25.01.2023 NDR Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean
45 Min.Dieser Naturfilm entführt auf eine fantastische Reise durch ein abenteuerliches Portugal, sein Festland, sein Meer und seine Inseln. Erde, Wasser, Luft und Feuer, Portugals Natur- und Tierwelt versucht im ständigen Gezerre seiner Elemente zu leben und zu überleben. Die Dokumentation folgt Tieren in den unterschiedlichsten Habitaten auf ihrem ungewissen Weg dem Horizont entgegen. Fast so, als seien die Eroberer, Seeleute und Entdecker längst vergangener Tage ihre Vorbilder. Die Geschichten sind fantastisch und draufgängerisch. Sie erzählen von Wildpferden in den schroffen Bergen Nordportugals, die schon die Konquistadoren nach Amerika begleitet haben, genauso wie von Seepferdchen, die an der Küste der Algarve so häufig anzutreffen sind wie sonst nirgendwo auf der Welt.Die Tierwelt Portugals offenbart sich in grenzenloser Vielfalt. Hier ruft das Meer und dort das Land. Die Dokumentation über Portugal, ein Land am äußersten Rand Europas, ist atemberaubend. In der Wildnis zwischen Land und Ozean treffen sich Anfang und Ende, Leben und Tod und alles, was dazwischen liegt. (Text: NDR) Raubkatzen: Heimliche Jäger
45 Min.Raubkatzen: Tödliche Eleganz
45 Min.Raubtiere vor der Haustür – Harzluchse und Heidewölfe
Wie fühlt es sich für den Menschen an, wenn der Luchs hinterm Gartenzaun ein Reh tötet? Was macht ein Schäfer, wenn Wölfe seine Schafe reißen? Kann man in der heutigen Zeit noch mit Raubtieren leben? Einerseits wollen alle Natur und Wildnis erhalten, aber wie wild darf es, vor allem vor der eigenen Haustür, zugehen? Was ist, wenn Wolf und Luchs in den Wäldern jagen, in denen der Mensch spazieren geht, Pilze sammelt oder joggt? Die Umweltwissenschaftlerin Ulrike Müller und der Fernsehjournalist Tim Berendonk begeben sich auf eine Spurensuche, um das herauszufinden, die sie vom Harz bis nach Hessen und von der Lausitz bis nach Westpolen führen wird.Wolf, Luchs und Bär sind vor fast 200 Jahren in Mitteleuropa durch den Menschen ausgerottet worden. Nun kehren diese Raubtiere selbstständig zurück oder werden, wie der Luchs, ausgewildert, weil in der EU Natur- und Artenschutz beschlossen wurde. Sie dringen neuerdings immer weiter vor in die Kulturlandschaft, meist fern der Großstädte. Deren Bewohner*innen befürworten durchweg die Ansiedlung dieser Raubtiere. Im ländlichen Bereich ist die Lage anders. Die Raubtiere finden ihren neuen Lebensraum vor allem in der Landschaft und in den Wäldern rund um die kleineren Städte und Dörfer. Und dort sind sie nicht immer so willkommen, wie es Natur- und Artenschützer gern sähen. Das ist spätestens dann der Fall, wenn tote Schafe auf der Weide liegen, der Hund gebissen oder der beste Bock im Jagdrevier gerissen wird. Der letzte Luchs im Harz wurde am 17. März 1818 erlegt. Die Ausrottung war damit abgeschlossen. Viele Harzbewohner*innen waren skeptisch, als Anfang 2000 Luchse aus deutschen Wildgehegen im Nationalpark Harz ausgewildert wurden. Ein so großes Raubtier in einem von Tourismus geprägten Mittelgebirge mit vielen Ortschaften? Auch Wissenschaftler übten Kritik: Sollten sich die Gehege-Tiere in der Natur behaupten können, wäre der Harz viel zu klein und isoliert, um einer lebensfähigen Luchspopulation Raum zu geben. Das ist über zehn Jahre her. Und tatsächlich ist das Revier im Harz schon lange zu klein für die nachwachsenden Luchse. Auf der Suche nach neuen Lebensräumen wandern sie zum Beispiel nach Hessen. Ulrike Müller folgt den Spuren der großen Katze, die zur Gallionsfigur des Tourismus im Harz wurde. Die Wölfe kamen von allein, seit der Jahrtausendwende erobern sie Deutschland zurück. Was in Sachsen begann, erlebt seine Ausbreitung in alle Richtungen. Schon über 20 Wolfspaare bringen Jahr für Jahr Junge zur Welt. Und die wandern durchs Land, um sich andernorts einen Partner und ihr eigenes Revier zu suchen. Diese Entwicklung begann an der polnischen Grenze. Jetzt treiben sich einzelne wandernde Wölfe schon vor Bremen, in den Niederlanden und in Schleswig-Holstein und Dänemark herum. 2012 bekam das erste Wolfspaar in der niedersächsischen Heide Nachwuchs. Es ist das am westlichsten jagende Wolfsrudel zwischen Hamburg und Hannover, keine zehn Kilometer von der A7 entfernt. Der NDR Journalist Tim Berendonk wurde auf das Thema aufmerksam, das ihn nicht mehr loslässt. In 2013 haben sich zwei weitere Wolfsfamilien in Niedersachsen angesiedelt. Das Land rund um Wolfsburg und Wolfenbüttel wird allmählich wieder, was es einmal war: Wolfsland. Der Journalist recherchierte für diesen Film in Brandenburg, Sachsen und Westpolen, denn dort haben die Menschen schon länger Erfahrung mit dem Wolf vor der Haustür. (Text: NDR) Das Reich der Löwen – Feindesland
Der Ruaha Nationalpark in Tansania ist größer als der berühmte Serengeti-Nationalpark und gilt als eines der am besten gehüteten Naturgeheimnisse im Osten Afrikas. Dank riesiger Büffelherden leben hier mehr Löwenrudel als irgendwo sonst in Afrika. Tierfilmer Owen Prümm hat sechs Jahre lang drei Löwenrudel mit der Kamera verfolgt. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Saga vom Kampf ums Überleben, von dramatischen Jagden auf Giraffen, Büffel und Gazellen, von Allianzen und Feindschaften im Königreich der Löwen. (Text: NDR)Deutsche TV-Premiere Mi. 22.08.2018 NDR Das Reich der Löwen – Jagdfieber
45 Min.Der Ruaha Nationalpark in Tansania ist größer als der berühmte Serengeti Nationalpark und gilt als eines der am besten gehüteten Naturgeheimnisse im Osten Afrikas. Dank riesiger Büffelherden leben hier mehr Löwenrudel als in den anderen Teilen Afrikas. Tierfilmer Owen Prümm hat sechs Jahre lang drei Löwenrudel verfolgt und beobachtet. Das Ergebnis ist eine erstaunliche Saga vom Kampf ums Überleben, von dramatischen Jagden auf Giraffen, Büffel und Gazellen, von Allianzen und Feindschaften im Königreich der Löwen. (Text: NDR)Deutsche TV-Premiere Mi. 29.08.2018 NDR Rendezvous mit einem Riesenkraken – Die Geschichte von Ellie
45 Min.Mit acht Armen, neun Hirnen und manchmal zehn Meter Spannweite sind Pazifische Riesenkraken die größten Oktopusse der Welt. Florian Graner zeigt das geheimnisvolle Leben dieser Verwandten von Schnecken und Muscheln. Dabei baut er ein enges Verhältnis mit den wildlebenden Tintenfischen auf. Parallel dazu verfolgt er die Entwicklung des jungen Weibchens in einem Aquarium. Ellie löst dort zunehmend komplexere Aufgaben. Riesenkraken sind bizarre Wesen mit rasantem Lebenslauf: Innerhalb von nur vier Jahren werden sie bis zu zehn Meter groß; die „Aliens“ haben Köpfchen, sind neugierig und suchen den Kontakt mit anderen Spezies. (Text: NDR)Deutsche TV-Premiere Mi. 29.09.2021 NDR Der Rhein (1): Von der Nordsee zur Loreley
Bis heute verbindet man mit dem Rhein Ritterburgen, Weinberge, Geselligkeit und malerische Orte. Dabei ist er weit mehr als nur ein romantischer Fluss. Eine Reise von der Mündung bis zur Quelle führt durch Landschaften, in denen sogar echte Wildnis zu finden ist. In den Landschaften sind so viele Tiere und Pflanzen zu Hause wie an keinem anderen Fluss Europas. Obwohl der Rhein seit Jahrtausenden dicht besiedelt ist und ununterbrochen als Wasserstraße genutzt wird, existieren noch die typischen Lebensräume an seinen Ufern: sonnendurchflutete Auwälder und tosende Wasserfälle, saftige Auwiesen und schattige Schluchten, sonnenverbrannte Steilhänge und kühle Altwasser.Diese Vielfalt ist der Grund dafür, dass die Uferbereiche des Rheins so vielen Lebewesen Lebensraum bieten kann, trotz Flussbegradigung, Chemieunfällen, Wasserverschmutzung und Fischsterben in den vergangenen Jahrzehnten. Die zweiteilige Dokumentation begleitet den Rhein stromaufwärts von der Mündung ins niederländische Wattenmeer durch sechs Länder hinauf zu den Rheinquellen in den Schweizer Alpen und zeigt die Tiere, die am oder im Rhein leben. Darunter sind alteingesessene Arten wie der Hecht, Heimkehrer wie der Biber und Neuankömmlinge wie der Halsbandsittich. Im Mündungsdelta tummeln sich Seehunde, und im Oberlauf blicken Steinböcke auf seine Fluten hinab. Smaragdeidechsen, Uhus, Wildschweine und Weinhähnchen gehören dazu wie auch Wasseramsel, Siebenschläfer, Mausohrfledermaus und Hunderttausende Wasservögel, die in der kalten Jahreszeit am Rhein rasten und hier überwintern. Im ersten Teil geht die Flussreise von der Nordsee zur Loreley bei Flusskilometer 555. Die weltberühmten Burgen am Mittelrhein dürfen natürlich nicht fehlen, zumal sie so manch wilden Bewohner beherbergen. Der Film liefert in spektakulären Bildern ein Porträt eines faszinierenden Naturraumes und bietet Einblicke in die Natur von einem der berühmtesten Flüsse der Welt. (Text: NDR) Der Rhein (2): Von den Burgen in die Berge
Bis heute verbindet man mit dem Rhein Ritterburgen, Weinberge, Geselligkeit und malerische Orte. Dabei ist er weit mehr als nur ein romantischer Fluss. Eine Reise von der Mündung bis zur Quelle führt durch Landschaften, in denen sogar echte Wildnis zu finden ist. In den Landschaften sind so viele Tiere und Pflanzen zu Hause wie an keinem anderen Fluss Europas. Im zweiten Teil „Der Rhein“ beginnt die Flussreise am Loreley-Felsen, führt an sonnigen Hängen samt ihrer mediterranen Tierwelt vorbei und zeigt die üppigen Auwälder am Oberrhein.Über den Rheinfall von Schaffhausen, den Bodensee und das Rheindelta bei Fußach geht es weiter bis in die Alpen zur Quelle des Flusses. Dieser Film liefert in spektakulären Bildern ein Porträt einer faszinierenden Flusslandschaft und bietet Einblicke in die Natur von einem der berühmtesten Flüsse der Welt. Obwohl der Rhein seit Jahrtausenden dicht besiedelt ist und ununterbrochen als Wasserstraße genutzt wird, existieren noch die typischen Lebensräume an seinen Ufern: sonnendurchflutete Auwälder und tosende Wasserfälle, saftige Auwiesen und schattige Schluchten, sonnenverbrannte Steilhänge und kühle Altwasser. Diese Vielfalt ist der Grund dafür, dass die Uferbereiche des Rheins so vielen Lebewesen Lebensraum bieten kann, trotz Flussbegradigung, Chemieunfällen, Wasserverschmutzung und Fischsterben in den vergangenen Jahrzehnten. Die zweiteilige Dokumentation begleitet den Rhein stromaufwärts von der Mündung ins niederländische Wattenmeer durch sechs Länder hinauf zu den Rheinquellen in den Schweizer Alpen und zeigt die Tiere, die am oder im Rhein leben. Darunter sind alteingesessene wie der Hecht, Heimkehrer wie der Biber und Neuankömmlinge wie der Halsbandsittich. Im Mündungsdelta tummeln sich Seehunde, und im Oberlauf blicken Steinböcke auf seine Fluten hinab. Smaragdeidechsen, Uhus, Wildschweine und Weinhähnchen gehören dazu wie auch Wasseramsel, Siebenschläfer, Mausohrfledermaus und Hunderttausende Wasservögel, die in der kalten Jahreszeit am Rhein rasten und hier überwintern. (Text: NDR) Riesenschwärme – Die Masse machts
Wenn Heuschrecken oder Eintagsfliegen, Stare oder Fledermäuse in Millionen auftreten, bilden sie oft einen Superorganismus von unglaublicher Kraft. Für diesen Film machen es Spezialkameras erstmals möglich, Teil eines solchen Schwarms zu werden. Er zeigt Beispiele aus der ganzen Welt und erklärt, warum sich Tiere zu riesigen Gruppen zusammenschließen und welche Vorteile sie dadurch haben. Aber auch welche Gefahren von ihrem massenhaften Auftreten ausgehen. (Text: Phoenix)Romantisches Mecklenburg – Tausend Seen und ein Meer
Zwischen Elbe und Darß liegt ein weites Land mit Rapsfeldern und dunklen Wäldern, mit tausend Seen und einem Meer: Mecklenburg. Tiere und Pflanzen finden hier ausreichend Raum und Nahrung. (Text: NDR)Die Rückkehr der Biber
45 Min.Zu Hause: Nicht immer wohnen Biberfamilien in einer freistehenden Biberburg aus Ästen. Oft Graben sie auch Höhlen ins Ufer, in denen sie ihre Jungen aufziehen.Bild: NDR/Doclights GmbH/Klaus Weißmann & Wilma KockDie Rückkehr der Biber ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Naturschutzes in Deutschland. Lange Zeit gejagt und nahezu ausgerottet, leben heute wieder mehr als 35.000 Biber in der Bundesrepublik – Tendenz steigend. Doch wie kam es dazu? Ende der 1920er Jahre waren in Deutschland nur noch 200 Biber an der Mittleren Elbe bei Dessau heimisch. Streng geschützt überlebten die bis zu 35 Kilo schweren Elbebiber in dieser Gegend. Zu der Zeit waren die großen Nager nahezu in ganz Europa verschwunden. Lediglich in Norwegen, Frankreich und Russland gab es weitere kleine Populationen mit wenigen Hundert Tieren.Die Jagd nach ihrem wertvollem Pelz und dem schmackhaften Fleisch hatte die Bestände früh dezimiert. Auch das sogenannte „Bibergeil“, ein moschusähnliches Duftsekret, das in der Medizin als Schmerzmittel Verwendung fand, wurde den Tieren Mitte des 19. Jahrhunderts zum Verhängnis. Fast unbemerkt kehrten die Biber zurück. Die Tiere besiedelten zunächst die naturnahen Auwälder entlang der Flüsse. Als die besten Reviere entlang der großen Ströme besetzt waren, drängten die abwandernden Jungbiber in kleinere Flüsse, in die Hochlagen des Schwarzwaldes und sogar in die von Menschen entwässerte Kulturlandschaft. Doch wo der Biber auftaucht, sorgt er vielerorts für Ärger: Die Tiere stauen Gräben oder plündern Weizenfelder. Ihre neu angelegten Gewässer fluten oftmals Wiesen oder Keller. Konflikte mit Menschen sind programmiert. Mittlerweile ist Deutschlands größter Nager in vielen Gebieten wieder heimisch. Mehr als zwei Jahre ist Klaus Weißmann den scheuen Bibern auf der Spur und dokumentiert ihre Ausbreitung in Deutschland. Welche Wege nutzen sie? Welchen Gefahren sind sie ausgesetzt? Schritt für Schritt erzählt der Film die spannende und teils kuriose Erfolgsgeschichte der sympathischen Nager. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 12.01.2022 NDR Die Rückkehr der Raubtiere – Wolf, Luchs und Bär auf dem Vormarsch
Kann man in Deutschland wieder mit großen Raubtieren leben? In Natur und Wildnis ist das möglich. Aber wie fühlt es sich an, wenn Wolf, Luchs und Bär im Wald vor der Haustür Beute jagen, in dem man selber spazieren geht, Pilze sammelt oder joggt? 2012 hat das erste wieder heimische Wolfspaar in Niedersachsen Junge bekommen. Das am westlichsten zwischen Hamburg und Hannover lebende Wolfrudel jagt keine zehn Kilometer von der A7 entfernt in der Heide. Der NDR Journalist Tim Berendonk ist auf das Thema der rückkehrenden Raubtiere aufmerksam geworden, und es lässt ihn nicht mehr los.Zusammen mit der Umweltwissenschaftlerin Ulrike Müller recherchiert er hier im Norden und in den Ländern, in denen diese Tiere nie ganz ausgerottet wurden. Die beiden reisen durch Finnland. Sie wollen erfahren, wie dort Landbevölkerung, Rentierzüchter und Jäger mit Wölfen, Luchsen und Bären klarkommen. Und auch, wie die großen Raubtiere zunehmend zum touristischen Magneten werden. In Deutschland ist die Situation ganz anders: Vor 150 bis 200 Jahren rotteten die Menschen Wolf, Luchs und Bär in Deutschland und Mitteleuropa aus. Nachdem der Schutz der Tiere in der EU gesetzlich verankert wurde, kehren sie zurück. Sie dringen, vor allem im ländlichen Raum, immer weiter vor. Wolf, Luchs oder Bär sind aber nicht immer gern gesehen. Spätestens wenn tote Schafe, gerissen von den Raubtieren, auf der Weide liegen, ist die Willkommensfreude bei den Menschen getrübt. Doch die wilden Tiere töten, um zu leben! Sie verteidigen, ebenso wie der Mensch, ihr Territorium und ihre Familie. Und sie sind nach menschlichen Maßstäben ziemlich schlau, schneller und stärker. Auch ihre Sinnesorgane wie Nase, Augen und Ohren sind denen des Menschen überlegen. Diese Überlegenheit empfinden viele Menschen als Gefahr. Selbst wenn die Fleischfresser Rehe und Hirsche jagen, werden sie von einer Vielzahl der weit über 300.000 Hobbyjäger im Lande als Konkurrenz oder Räuber verstanden, weil diese das Wild als „ihr Eigentum“ betrachten. Der Film mit faszinierenden Naturaufnahmen, gepaart mit einer spannenden Reportage, macht die Rückkehr der Raubtiere zu einem packenden Erlebnis. Er gibt Antworten auf die Frage: Wie lebt es sich mit Wölfen, Luchsen und vielleicht auch bald wieder Bären? (Text: NDR) Russland – Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane
Russland ist einer der eindrucksvollsten Naturräume der Erde mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Dieser Kinofilm mit ungewöhnlichen Aufnahmen und Siegfried Rauch († 2018) als Sprecher führt auf eine Reise durch unerschlossene und geheimnisvolle Gebiete in dem riesigen Reich: vom Kaukasus über den Ural zum Baikalsee bis ins fernöstliche Ussurien und auf die Halbinsel Kamtschatka. Viele Tierarten gibt es nur noch hier. Sie leben im Kreislauf von Entstehung und Zerstörung, Reichtum und Kargheit der Landschaft. Mehr als drei Jahre lang waren zehn Kamerateams unter Leitung des Tierfilmers Henry M. Mix unterwegs, haben 100.000 Reisekilometer bei Temperaturen zwischen minus 50 und plus 40 Grad zurückgelegt und über 600 Stunden Bildmaterial aus Flora und Fauna für diesen Film mit nach Deutschland gebracht.Dank modernster Ausrüstung und endloser Geduld der Fernsehteams sind beeindruckende Aufnahmen gelungen, die zum Teil noch nie zuvor von einer Kamera eingefangen wurden. Es sind die ersten und vielleicht letzten Bilder von faszinierenden Arten, wie zum Beispiel dem Amurtiger. Der Film zeigt die Schönheit der Natur, die sich in Hunderttausenden von Jahren entwickelt hat. Gleichzeitig enthält er die Mahnung, diese auch für künftige Generationen zu erhalten. In dem größten Land der Erde gibt es gewaltige Naturschauspiele zu sehen. Unendliche Weiten eröffnen eine Welt aus Schnee und Eis, in der jedes Leben erstirbt. Andere unbekannte Regionen erstrahlen farbenprächtig im Sommer. Trotz dieser Extreme verbirgt sich dort Lebensraum für eine faszinierende Artenvielfalt: äsende Elche im Ural, kämpfende Riesenseeadler in Kamtschatka, Eisbären auf der Jagd in der Arktis oder muntere Robben im Baikalsee. Die Musik für diese Produktion des NDR Naturfilms stammt von Kolja Erdmann, eingespielt vom Sinfonieorchester Minsk. (Text: NDR) Der Sambesi (2): Der donnernde Fluss
Die spektakulären Victoriafälle locken alljährlich unzählige Besucher an. Der Sambesi, der Fluss, der sie speist, ist jedoch über weite Strecken nahezu unbekannt. Noch nie zuvor ist der mächtige Strom so umfassend porträtiert worden wie in dieser zweiteiligen Naturfilmdokumentation. Der Film des vielfach ausgezeichneten Naturfilmers Michael Schlamberger folgt dem mächtigen Strom Sambesi über 2.600 Kilometer. Der Ursprung des Sambesi liegt fast unscheinbar versteckt im Dickicht bewaldeter Hügel im Nordwesten Sambias. Auf seinem Weg Richtung Osten durchfließt er sechs afrikanische Staaten und verwandelt unzählige Male seine Form: vom schmalen Rinnsal in ein gigantisches Überschwemmungsgebiet, vom mächtigsten Wasserfall der Welt in eines der üppigsten Feuchtgebiete der Erde.Schließlich vereinigt sich sein Wasser an der Küste von Mosambik mit dem Indischen Ozean. Mehr als 100 Meter stürzt der Sambesi über die Victoriafälle an der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe in die Tiefe. Hier erreicht das „Temperament“ des Flusses seinen Höhepunkt. Im April eines jeden Jahres schießen 550 Millionen Kubikmeter Wasser in der Minute über den Felsabriss. Doch Mitte des letzten Jahrhunderts kamen neue Mächte ins Spiel. 1959 wurde die Kariba-Talsperre unterhalb der Victoriafälle fertiggestellt. Durch den Rückstau ist eine riesige Seenlandschaft entstanden. Der Kariba-Stausee ist mit einer Länge von 220 Kilometern der zweitgrößte künstliche See der Welt. Vor dem Bau der Kariba-Talsperre wurden die Ebenen unterhalb des großen Damms, die Mana Pools, Jahr für Jahr vom Hochwasser überschwemmt. Heute werden Zeitpunkt und Umfang der Überflutungen von Menschenhand gesteuert, nur vier Becken des Sambesi führen immer Wasser. Diese Wasserstellen sind ein Treffpunkt für viele Tiere, darunter die seltensten Raubtiere des Schwarzen Kontinents: Afrikanische Wildhunde. Auf seinem letzten Teil der Reise, in Mosambik, nimmt der Sambesi Kurs Richtung Südost. Bevor er auf den Indischen Ozean trifft, verästelt sich der Fluss in ein riesiges Delta aus Mangrovensümpfen mit großen und kleinen Kanälen. Der Bullenhai ist als eines von ganz wenigen Tieren in der Lage, zwischen den Welten aus Salz- und Süßwasser zu pendeln. Vor dem Bau des Kariba-Damms wanderten einige Exemplare von ihnen bis zu 1.000 Kilometer den Fluss Sambesi hinauf. (Text: NDR) Der Sambesi – Quellen des Lebens
Die spektakulären Victoriafälle locken alljährlich unzählige Besucher an. Der Sambesi, der Fluss, der sie speist, ist jedoch über weite Strecken nahezu unbekannt. Noch nie zuvor ist der mächtige Strom so umfassend porträtiert worden wie in dieser Naturfilmdokumentation. Der Film des vielfach ausgezeichneten Naturfilmers Michael Schlamberger folgt dem mächtigen Strom Sambesi über 2.600 Kilometer. Der Ursprung des Sambesi liegt fast unscheinbar versteckt im Dickicht bewaldeter Hügel im Nordwesten Sambias. Auf seinem Weg Richtung Osten durchfließt er sechs afrikanische Staaten und verwandelt unzählige Male seine Form: vom schmalen Rinnsal in ein gigantisches Überschwemmungsgebiet, vom mächtigsten Wasserfall der Welt in eines der üppigsten Feuchtgebiete der Erde.Schließlich vereinigt sich sein Wasser an der Küste von Mosambik mit dem Indischen Ozean. Auf seiner Reise pumpt der Sambesi durch sein Wasser unablässig Lebenskraft in die südliche Hälfte des afrikanischen Kontinents, er bestimmt das Schicksal von Millionen Existenzen. Wenn im November am Flussoberlauf heftige Regenfälle niedergehen, schwillt der Strom gewaltig an. Dann machen sich aus 200 Kilometer Entfernung riesige Gnu-Herden auf, um in die Schwemmgebiete an den Ufern des Sambesi zu ziehen. Wenn sie dort ihren Nachwuchs zur Welt bringen, beginnt für die ansässigen Hyänen-Clans eine Zeit des Überflusses. Während der Regenzeit nimmt der Sambesi eine völlig neue Gestalt an. Die Erde kann kein Wasser mehr aufnehmen, doch vom Oberlauf kommen unablässig zusätzliche Wassermassen hinzu. An manchen Stellen erreicht der Fluss jetzt eine Breite von mehr als 25 Kilometer. Das Wasser ergreift auch von den Dörfern der Lozi Besitz, aber die Menschen haben gelernt, mit dem Steigen und Fallen des Sambesi zu leben. Wenn es an der Zeit ist, die Dörfer zu verlassen, feiern sie das Kuomboka-Fest, das jährlich stattfindende Verabschiedungsritual für das Königspaar und sein Volk. Etwas weiter flussabwärts vereinigt sich der Sambesi mit dem Fluss Chobe, der in der ausgedörrten Landschaft die einzige ständige Wasserquelle ist. Bis zu 120.000 Elefanten kommen hier zusammen, mehr als irgendwo sonst auf der Welt. Weiter Richtung Osten verlässt der Sambesi das flache, offene Land und erreicht eine Landschaft, die vor Jahrmillionen von Vulkanausbrüchen zernarbt wurde. Die Felsspalten und Basaltrisse in seinem Bett verändern den Charakter des Sambesi, und der mächtige Fluss verwandelt sich in ein aufgewühltes Wildwasser, das sich über die Victoriafälle mehr als 100 Meter in die Tiefe stürzt. Hier endet die erste Folge des Zweiteilers „Der Sambesi“. (Text: NDR) Schleswig Holsteins schönste Förde – Die Schlei
45 Min.Zwischen Schleswig und Ostsee liegt Deutschlands längste Förde: die Schlei. Diese Region ist im Fernsehen schon lange etabliert, sie dient als Kulisse für so manche Serie. Hunderttausende Besucher zieht die Ostseeförde jährlich an. Was kaum einer weiß: Die dünn besiedelte, von Landwirtschaft und Wasser geprägte Region im Norden Schleswig-Holsteins ist ein Rückzugsgebiet für viele Wildtiere. Die Schlei zieht sich über 40 Kilometer von Schleswig bis zur Ostsee. Sie ist kein Fluss, wie man meinen könnte, sondern eine Förde, ausgeschwemmt vom Schmelzwasser gewaltiger eiszeitlicher Gletscher. Mehr als ein Jahr haben Tierfilmer Thomas Behrend und sein Team an der Schlei verbracht und die Region und ihre tierischen Bewohner porträtiert.In Schleimünde, wo die Schlei endet und die Ostsee beginnt, erwarten die Fischer während der kalten Wintermonate einen besonderen Fang: Heringsschwärme, die zu Abertausenden in ihre Laichgebiete ziehen. Doch die Fischer bekommen Konkurrenz. Auch Schweinswale haben es auf die Heringe abgesehen. Wenn im Frühling die Natur zu neuem Leben erwacht, beginnt für viele Vögel die Brutzeit. Hoch in den Bäumen wachen Seeadler über ihre Eier. Das Paar ist nur eines von vier Seeadlerpaaren, die an der Schlei brüten. Auch unter Wasser sind viele Lebewesen mit der Brutpflege beschäftigt. Während eines Tauchgangs entdeckt der Filmer das Gelege eines Seehasen. Bei dem ungewöhnlichen Fisch ist das Männchen allein für die Brutpflege verantwortlich. Selbstbewusst und unermüdlich verteidigt es seinen Nachwuchs gegen Feinde. Im Herbst schließlich beginnt die Brunftzeit des Damwilds. Ungewöhnlich viele der kleinen Hirsche leben in der Schlei-Region, Rudel von über 100 Tieren sind keine Seltenheit. Das Kamerateam ist hautnah dabei, als die Männchen ihre mächtigen Geweihe aufeinander prallen lassen. Mitte November setzt der erste Schnee ein, und ein Jahr an der Schlei geht vorüber. Kaum eine norddeutsche Kulturlandschaft bietet so viele Reize. Die Schlei wartet nur darauf, dass man sie immer wieder aufs Neue entdeckt. Um die Schönheit der Landschaft und das einzigartige Tierverhalten zu zeigen, nutzt Thomas Behrend den neuesten Stand der Kameratechnologie: neben Unterwasseraufnahmen in HD, kommen Zeitraffer- und Zeitlupenkameras zum Einsatz. Etwas ganz Besonderes sind die ungewöhnlichen Aufnahmen, die einen Blick aus der Vogelperspektive erlauben, gefilmt mit einem eigens entwickelten Mini-Helikopter mit Kameraaufhängung. (Text: NDR) Schottland – Herbe Schönheit am Atlantik
45 Min.Geheimnisvolle Burgen an einsamen Seen, im Schottenrock gekleidete Männer mit Dudelsack, Whisky und das Ungeheuer von Loch Ness, das sind die Klischees, die mit Schottland verbunden werden. Nur wenig bekannt ist: Großbritanniens nördlichste Region hat eine faszinierende Natur und Tierwelt zu bieten. Spektakuläre Flugaufnahmen zeigen die Highlands und einige der mehr als 500 Inseln. Hochstabilisierte Kameras und erfahrene Piloten, die schon für die „Harry Potter“-Produktionen im Einsatz waren, feiern die ganze Schönheit der schottischen Landschaft.Doch nicht nur die Weite der Highlands und die schroffen Küsten ziehen viele Menschen in ihren Bann, auch die reiche Flora und Fauna begeistert jedes Jahr zahllose Urlauber und Naturfreunde. Schottland besitzt einige der größten Seevogelkolonien Europas. Vom Fischreichtum profitieren auch Otter und Fischadler, die erst seit einigen Jahren wieder in den Lochs und Kyles, den Seen und Förden, auf die Jagd gehen. Die Adler waren in Schottland bereits ausgerottet und erleben jetzt Dank engagierter Vogelschützer ein Comeback. Das Wahrzeichen der Highlands sind sicher die majestätischen Rothirsche, die vielerorts frei über die Bergkämme ziehen. Im Herbst findet ihre lautstarke Brunft statt. Andere Geräusche dominieren den Frühling. Es sind die Balzrufe der Birkhuhnhähne. Extreme Zeitlupenaufnahmen mit über 2.000 Bildern pro Sekunde zeigen die atemberaubenden Kämpfe in voller Pracht. Ein kurzes Flügelschlagen wird so zu einer ästhetischen Choreografie. Genau wie die Tiere prägen die Menschen den Nordwesten Großbritanniens. Alistair Sutherland lebt schon fast sein ganzes Leben im Hochland. Auf seiner kleinen Farm hält er Schafe und die mächtigen Schottischen Hochlandrinder. Mit ihrem zotteligen Fell und den gewaltigen Hörnern wirken sie so schroff wie die Landschaft. Doch Alistair kommt mit diesen urtümlichen Tieren wunderbar zurecht, kennt sogar ihre verschmuste Seite. Ein ganz anderes Leben führt der Fischer Callum MacInnon auf der Isle of Skye, die zu den schönsten Inseln der Hebriden zählt. Für ihn ist ein Leben ohne das Meer unvorstellbar. Mehrmals pro Woche fährt er hinaus und setzt seine Hummerkörbe aus. Ein lukratives Geschäft, auch wenn der Fang über die Jahre immer geringer wurde. Trotzdem hofft er, dass noch seine Enkel mit dem kleinen roten Kutter in den oftmals tosenden Nordatlantik in See stechen. Über ein Jahr haben die Naturfilmer Hans-Peter Kuttler und Ernst Sasse die schottischen Highlands mit ihren zahlreichen Inseln bereist und zeichnen ein gefühlvolles Porträt der urwüchsige Landschaft und ihre eigensinnigen Bewohner. (Text: NDR) Schweden – Ruf der Wildnis
45 Min.Die große Leidenschaft des ungarischen Naturfilmers Zoltán Török ist die Natur Schwedens. Vor gut 25 Jahren begann er, die Tierwelt vom Norden bis zum Süden des Landes mit seiner Kamera einzufangen. Später durchwanderte er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern das Land und ist so hautnah Augenzeuge der gewaltigen Veränderungen geworden. Neben den zoologischen Superstars, Elch, Seeadler und Braunbär, zeigt Török auch die vielen kleinen Tiere, die mit den wärmer werdenden Temperaturen klarkommen müssen: Deutlich weniger sind Lemminge geworden, was die Polarfüchse fast verschwinden ließ.Ein spezielles Schutzprogramm hat die Zahlen inzwischen wieder stabilisiert. Rotfüchse dringen dafür aus dem Süden immer weiter Richtung Norden vor. Noch gibt es in Schweden 250 Gletscher. Alle sind in den letzten Jahren erheblich geschrumpft. Weit im Norden taut der Permafrostboden auf. Und seit den 1950er-Jahren sind mehr als drei Viertel der ursprünglichen Wälder abgeholzt worden. Andererseits steigt die Zahl der Seeadler. Die mächtigen Greife profitieren von den wachsenden Kegelrobben- und Kormorankolonien. Auch der Elch ist einer der Überlebenskünstler des Landes. Die großen Hirsche können erstaunlich flexibel im Wald, in den Bergen und auf kleinen Inseln Nahrung finden. Zoltán Töröks persönliches Naturporträt über Schweden ist eine Bestandsaufnahme des hohen Nordens Europas. Die Region verändert sich so schnell wie keine andere des Kontinents. Noch ist die Zukunft ungewiss, aber der Klimawandel birgt hier Chancen wie Risiken zugleich. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Mi. 19.02.2025 NDR The secret Crown – Geheimprojekt Korallenriff: Wunder der Karibik
45 Min.2013, in den karibischen Gewässern vor Guatemala: Ein Fischer fährt wie so oft mit seinem Boot aufs Meer hinaus. Als weit von der Küste entfernt der Motor ausfällt, staunt der Fischer nicht schlecht: Das Meer ist an dieser Stelle unerwartet seicht. Er hat eine spektakuläre Entdeckung gemacht: ein bis dahin unbekanntes Korallenriff, das Cayman Crown. Im Gegensatz zu vielen anderen Riffen der Karibik ist es unberührt, völlig intakt und voller Fische. Erstaunlich, dass ein gigantisches Riff, 150-mal so groß wie Helgoland, so lange verborgen bleiben konnte. Die Naturdokumentation begleitet ein Team von Meeresforschern.Die Wissenschaftler erkunden das bislang unbekannte Riff und finden heraus, weshalb die faszinierende Unterwasserlandschaft am Rand eines Tiefseegrabens so besonders ist. Ihr Ziel ist es, das einzigartige Riff unter Schutz zu stellen. Über Jahre halten sie die unglaubliche Entdeckung geheim und arbeiten nur mit lokalen Fischern zusammen, um das Riff vor kommerziellen Plünderern zu schützen. Der Film erzählt einen wahren Wissenschaftskrimi, in dem Zuversicht für die Zukunft steckt. Er berichtet davon, wie das Cayman Crown-Riff der Erwärmung der Ozeane besser trotzt als viele andere Riffe und wie Forschung dazu beiträgt, das Gebiet unter Schutz zu stellen. Doch es gibt auch Tiefschläge, denn auf Dauer kann die Entdeckung nicht geheim gehalten werden. Und die Plünderung durch kommerzielle Fischer beginnt. Ein Schock für die Forscher. Zugleich zeigt der Film, dass der bunte Kosmos unter Wasser keine stille Welt ist und Fische nicht stumm sind, ganz im Gegenteil. Vielleicht liegt ja genau in der Kommunikation der Fische untereinander die Chance, leer gefischte Riffe wieder neu zu besiedeln. Das Forscherteam startet ein ungewöhnliches Experiment, die großen Fischschwärme in das Riff Cayman Crown zurückzuholen. (Text: NDR) Seeadler – der Vogel Phönix
45 Min.Der Lebensraum der Seeadler erstreckt sich bis weit in den Norden des europäischen Kontinents. Mit bis zu sieben Kilogramm Gewicht, Flügeln mit einer Spannweite bis zu zweieinhalb Metern, zwei muskulösen Fängen mit nadelspitzen Krallen: Der Seeadler ist perfekt für die Jagd ausgestattet und gilt deshalb als Sinnbild für Macht und Stärke. Hoch im Norden Europas finden die majestätischen Greifvögel alles, was sie zum Leben brauchen: Wälder, Seen und Sümpfe im Wechsel, kaum Landwirtschaft und wenig Menschen. Aber auch in Deutschland sind mittlerweile wieder mehr als 700 Seeadlerreviere besetzt, eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes.Dieser Naturfilm präsentiert die verschiedenen Lebensräume, in denen der Seeadler in Europa heimisch ist. Er zeigt spektakuläre Bilder, etwa von den norwegischen Lofoten, wo die Adler mit den Orcas und Buckelwalen ziehen und von deren Jagderfolg profitieren. Oder aus den Mooren Finnlands, wo die Seeadler die Nähe zu Wolf und Bär suchen, denn auch hier profitiert der Seeadler von dem Jagdglück anderer. In Deutschland leben die meisten Seeadler im gewässerreichen Nordosten der Republik. Der Film begleitet die Adler, die zu Fuß auf einer von Hunderten Kormoranen besiedelten Insel unterwegs sind, um dort die „Babynahrung“ der Kormoranküken abzustauben. Und wieder einmal profitiert der Adler vom Erfolg der Mitgeschöpfe in seinem Lebensraum. Dank engagierter Naturschützer, Förster und Jäger, haben in den heimischen Wäldern noch nie so viele Seeadler gebrütet wie heute. Und die Zeiten, in denen Adler als Schädlinge betrachtet wurden, sind endgültig vorbei. Andere Bedrohungen für den Seeadler wie die bleihaltige Jagdmunition sind überschaubar. Nur eines fehlt dem Seeadler: eine Wildnis, in der sich auch die großen Tiere entfalten können, in der Herden von Huftieren und Räuber wie Wolf und Bär wieder heimisch sind. Dann kann der Seeadler diese Großtiere begleiten und darauf warten, dass etwas für ihn abfällt und ist nicht mehr so sehr auf den Schutz durch den Menschen angewiesen. Die Rückkehr des Seeadlers ist ein Vorzeigeprojekt des Artenschutzes. Nun sollte man in seinem Reich etwas mehr Wildnis wagen. (Text: NDR) Seenparadies Mecklenburg: Unter Fischadlern und Wisenten
45 Min.Seeadler ziehen an den Ufern der großen und kleinen Seen ihren Nachwuchs auf.Bild: HR/NDR/NDR NaturfilmZwischen Hamburg und Berlin liegt das größte zusammenhängende Seengebiet Deutschlands: die Mecklenburgische Seenplatte. Mehr als 1000 große und kleine Seen sind durch Flüsse und Kanäle miteinander verbunden. Im Zentrum dieses Wasserparadieses liegt die Müritz. Neben der urwüchsigen Natur mit vielen seltenen Tierarten wie Fischadler und Eisvögel spielt in diesem Film eine Gauklerfamilie eine entscheidende Rolle. Per Floß reist sie durch Mecklenburgs Wasserwelten und spielt auf ihrem Weg die alten Märchen. Ihre Bühne ist die Natur, wo sich ebenfalls kleine und große Dramen der Tierwelt abspielen.Scharen von Kranichen, die über Mecklenburg ziehen, verheißen den nahen Frühling. Jetzt ziehen auch die Schausteller los. Sie beginnen ihre Reise vor der Kulisse des Schweriner Märchenschlosses und folgen der alten Handelsstraße über die Stör nach Osten. Hinter Plau begegnen ihnen Tiere einer längst vergessenen Zeit: Wisente. Unbeirrt ziehen sie durchs seichte Wasser des Damerower Werders. Nur wenige Kilometer weiter öffnen sich die romantischen Waldseen und ein kleines Meer liegt vor dem Floß. Es nimmt Kurs auf den Müritz-Nationalpark, ein Paradies der Adler. Tierfilmer Christoph Hauschild hält mit einer Zeitlupenkamera die spektakulären Jagdflüge der Fischadler fest. Zwischen Müritz und Rheinsberg liegen in märchenhafte Wälder eingebettet die saubersten Seen Norddeutschlands. Die „Perle“ unter ihnen ist der sagenumwobene Stechlin. In ihm gehen Taucher dem Geheimnis vom Roten Hahn nach und entdecken eine wunderbare Unterwasserwelt. Die Gaukler indes stellen im Herbst ein letztes Mal ihre Bühne auf und spielen das Märchen vom „Froschkönig“ vor der Kulisse des Rheinsberger Schlosses, bevor sie an die Müritz zurückkehren. (Text: NDR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Expeditionen ins Tierreich und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail