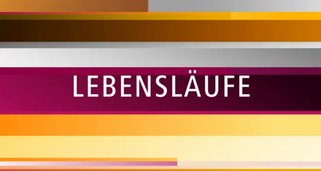unvollständige Liste – 2014
Polizeirufkommissare Jaecki Schwarz und Wolfgang Winkler – Verbrecherjagd auf Mitteldeutsch
Folge 140 (30 Min.)Die Krimireihe „Polizeiruf 110“ ist eines der wenigen Formate, das den Sprung aus dem DDR-Fernsehen in die ARD und dort auf einen Sonntagabendplatz geschafft hat. Inzwischen gingen schon über 300 Folgen der Reihe über den Sender. Für den MDR ermittelten seit Jahren die Hallenser Kriminalhauptkommissare Schmücke und Schneider alias Wolfgang Winkler und Jaecki Schwarz. Das ostdeutsche Erfolgsduo hat inzwischen mehr als 40 Fälle gelöst. Grund genug, den beiden Starschauspielern über die Schulter zu blicken. Der Film erzählt von Herkunft und von beruflichen und privaten Höhepunkten der beiden Akteure. Dabei setzt er einen Schwerpunkt auf die „Polizeiruf 110“-Arbeit, von der sich die Kommissare inzwischen in den Ruhestand verabschiedet haben. (Text: mdr)Deutsche TV-Premiere Do. 23.01.2014 MDR Carl Philipp Emanuel Bach – Ein musikalischer Rebell
Folge 141 (30 Min.)Ist heute von Bach die Rede, denkt man unwillkürlich an Johann Sebastian. Vor 250 Jahren war das anders. Wenn Mozart sagte: „Er ist der Vater, wir die Buben. Wer von uns was Rechtes kann, hat von ihm gelernt“, dann war nicht von Johann Sebastian die Rede, sondern von seinem zweitältesten Sohn Carl Philipp Emanuel, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Geboren wurde er 1714 in Weimar. Bei seiner Taufe stand auch Georg Philipp Telemann Pate. Seine Kindheit verbrachte er in Köthen und in Leipzig.Dort wurde er Thomasschüler, erhielt vom Vater eine profunde musikalische Ausbildung und schrieb sich 1731 als Jura-Student an der Leipziger Universität ein. Neben seinem Studium betätigte er sich als Kammermusiker und schrieb erste Klavier- und Vokalwerke. Wenig später wechselte er an die Universität von Frankfurt/Oder. Von dort berief ihn der Kronprinz und spätere preußische König Friedrich II. an seinen Hof. Dreißig Jahre war Carl Philipp Emanuel Konzertcembalist in Berlin und Potsdam. In der Berliner Hofkapelle, die eines der bedeutendsten Orchester in Europa war, wirkten Kollegen von europäischem Rang wie Quantz, Benda und Hasse. Hier reifte seine Kompositionskunst zur Vollendung. 1744 heiratete er Johanna Maria Dannemann, die Tochter eines Weinhändlers, und gründete eine Familie. Inzwischen hatte sich der Ruhm des „Berliner Bachs“ weit über Deutschland hinaus verbreitet, eine Anerkennung, die man ihm am preußischen Hof versagte. Schließlich bewarb er sich erfolgreich als Nachfolger Telemanns auf die Stelle des Musikdirektors und Kantors in Hamburg, die er bis zu seinem Lebensende 1788 innehatte. Carl Philipp Emanuel Bach galt als einer der brillantesten Klaviervirtuosen seiner Zeit, als stilprägender Komponist und scharfsinniger Theoretiker – kurzum als Meister von europäischem Rang. Er revolutionierte die Musiksprache der Zeit, forderte ein Höchstmaß an Gefühl und Empfindung in der Musik, um den „Zuhörer in Leidenschaft zu versetzen“. So wurde er zum Vorbild der Wiener Klassiker Haydn, Mozart und Beethoven. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 06.03.2014 MDR Reinhard Lacky Lakomy – Heute bin ich allein
Folge 142 (30 Min.)Der Komponist, Pianist, Sänger und Liedermacher Reinhard Lakomy bleibt vielen als der bärbeißige Typ mit weißer Mähne, Nickelbrille und der unverkennbar rauen Stimme in Erinnerung. Lacky, wie ihn Freunde und unzählige Fans nannten, wurde in Magdeburg in den kargen Nachkriegsjahren geboren. Sein Eigensinn und seine hohe musikalische Begabung ließen ihn zu einem der populärsten und eigenwilligsten Stars der deutschen Musikszene werden. Erfolgstitel wie „Heute bin ich allein“, „Mir doch egal“ oder „Autofahren“ sind ebenso einmalig und urtypisch für Lakomy, wie seine Kindermusicals und Geschichtenlieder im „Traumzauberbaum“.Der Film erzählt von seinen vielschichtigen Erfolgen auf musikalischem Gebiet, seiner gesellschaftlichen, politischen wie künstlerischen Unangepasstheit. Lebensgefährten und treue Freunde, wie seine Texterin und Ehefrau Monika Erhard Lakomy, sein enger Freund Gregor Gysi, sein musikalischer Ziehvater Klaus Lenz und musikalische Wegbegleiter wie Angelika Mann, die „Lütte“, und viele andere kommen im Film zu Wort. Reinhard Lakomy ist am 23. März 2013 verstorben. Das MDR FERNSEHEN würdigt den Künstler anlässlich seines ersten Todestages mit einem Porträt in der Sendereihe „Lebensläufe“. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 20.03.2014 MDR Der Schriftsteller Christoph Hein – Von allem Anfang an
Folge 143 (30 Min.)Hein – Schriftsteller, Essayist und Dramatiker – wird in den achtziger Jahren fast über Nacht bekannt. Seine Erzählung „Der fremde Freund“ macht in Ost wie West Furore: In der Bundesrepublik erscheint sie unter dem Titel „Drachenblut“. Der Autor erzählt emotionslos sezierend die Geschichte einer DDR-Ärztin. Zu Hause im spießigen Ambiente eines Plattenbaus, ist sie erfolgreich im Beruf, aber bindungsunfähig. Das trifft den Zeitgeist. Das Buch wird in 22 Sprachen übersetzt. Für die einen ist es Sinnbild für das politische Verstummen einer ganzen Generation im Osten, für die anderen trifft das Kultbuch aus der DDR das „No-Future-Gefühl“ im Westen.Auch in den folgenden Jahren erweist sich Hein als Chronist brüchiger Schicksale. So in den Romanen „Horns Ende“ und „Der Tangospieler“, nach der Wende wieder in seinem Buch „Napoleonspiel“. Er selbst bezeichnete sich stets als einen „Chronisten ohne Botschaft“. Christoph Hein, Pfarrersohn und Absolvent der philosophischen Fakultät, macht sich nicht nur als Erzähler, sondern auch als Dramatiker einen Namen. Von seinen Vorwende-Stücken wird vor allem „Die Ritter der Tafelrunde“ bekannt: eine klarsichtige, kaum verhüllte Parabel auf das greise und moralisch verkommene Politbüro der Honecker-Ära. Hein zählt zu den aufmüpfigsten unter jenen Schriftstellern, die in der DDR ausharren. Auf dem letzten Schriftstellerkongress wendet er sich scharf gegen die politische Zensur und düpiert so öffentlich Erich Honecker. Gleichzeitig setzt er bis zuletzt auf Veränderungen. Noch auf der großen Alexanderplatz-Kundgebung im November ’89 fordert er einen reformierten Sozialismus. Später verwirft er diese Hoffnung als illusionär. In Essays, öffentlichen Reden, in Bühnenstücken wie „Randow“, Romanen wie „Landnahme“ oder als Herausgeber der Ost-West-Wochenzeitung „Freitag“ erweist sich Christoph Hein auch im vereinigten Deutschland als klarsichtiger und gleichzeitig toleranter Analytiker. 2005 wird sein Roman „Willenbrock“ von Andreas Dresen verfilmt. Es folgen Romane wie „Frau Paula Trousseau“ und „Weisskerns Nachlass“. In seinem zuletzt erschienen Band „Vor der Zeit“ erzählt er antike Mythen neu. Christoph Hein gehört heute zu den wichtigsten literarischen Stimmen des vereinten Deutschlands. 2012 wird er für seinen Roman „Weiskerns Nachlass“ mit dem Uwe-Johnson-Preis ausgezeichnet. Die Stadt Chemnitz ehrt ihn 2013 mit dem Stefan-Heym-Preis. Seine Autobiografie trägt den Titel „Von allem Anfang an“. „Lebensläufe“ fühlt sich diesem Anspruch verpflichtet. Christoph Hein feiert am 8. April 2014 seinen 70. Geburtstag. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 03.04.2014 MDR Der Schriftsteller Volker Braun – Training des aufrechten Gangs
Folge 144 (30 Min.)Der Schriftsteller und Dichter Volker Braun ist ein illusionsloser Idealist. Er triezte und schärfte mit Vergnügen unsere Wahrnehmung, so geschehen mit der Aufforderung zum „Training des aufrechten Gangs“. Brauns Gedicht aus den Siebzigern wurde 1989 wie eine plötzliche Erlösungsformel aus der kontrollierten Apathie eines ganzen Landes, seines Landes DDR. Die Wende, ein wunderbarer Moment der Volkssouveränität, ehe die Illusionen vom wirklichen Sozialismus als schwer verkäuflich im Wühltisch der Geschichte landeten. Wie zukunftsfähig ist der Mensch? Das bleibt die Frage für Volker Braun. Er kritisierte den Sozialismus, ohne ihn gegen den Kapitalismus umtauschen zu wollen. Für ihn ist die Rechnung der Geschichte offen, ein Ineinander von Fortschritt und Verlust, von Kultur und Verfall, von Schönheit und Zerstörung.Volker Braun hat seinen Frieden mit der Zeit nicht gemacht. 2011 veröffentlichte Braun die Erzählung „Die hellen Haufen“, die Geschichte eines vergeblichen Arbeiteraufstandes nach der Wende, orientiert an den Ereignissen im thüringischen Bischofferode, wo Kalibergarbeiter gegen die Schließung ihres rentablen Werkes revoltierten und im Hungerstreik waren. Im Jahr 2000 bekam Volker Braun den Georg-Büchner-Preis verliehen, den bedeutendsten Literaturpreis Deutschlands. Am 8. Mai wird Volker Braun 75 Jahre alt – ein aufrecht Gehender, dessen Lebensweg das Fernsehporträt nachzeichnet. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 08.05.2014 MDR Graf Brühl und Friedrich II – Feinde fürs Leben
Folge 145 (30 Min.)Kaum jemanden fürchtete und hasste Friedrich der Große so, wie den Grafen Brühl, der es vom einfachen Pagen am Hof Augusts des Starken zum alleinigen Lenker der Staatsgeschäfte und -finanzen in Sachsen gebracht hatte. Der Sachse Heinrich von Brühl legt dem Preußen Friedrich während des „Zeithainer Lustlagers“ eine sächsische Hofdame mit Geschlechtskrankheit ins Bett, bringt das preußische Heer im Siebenjährigen Krieg durch politische Intrigen an den Rand des Untergangs und besitzt mehr wertvolle Tabakdosen als der Alte Fritz. Und er soll sogar das gut dotierte Angebot des Preußenkönigs abgelehnt haben, als Chefminister nach Berlin zu kommen.Unglaublich! Friedrich ist empört. Dann schlägt der Preußenkönig zurück: Er platziert einen Spion im Vorzimmer des sächsischen Premierministers, zerstört die Besitzungen und Schlösser Brühls und ruiniert schließlich durch gezielte Propaganda den Ruf des allzu wendigen, schlitzohrigen und prunksüchtigen Premiermisters, nennt ihn einen „Intriganten, Verräter und Verschwender“. Heinrich Graf von Brühl (1700–1763) und Friedrich den Großen (1712–1786) verband eine tiefe Feindschaft fürs ganze Leben und sogar darüber hinaus, denn dem Alten Fritz gelang es, den Ruf Brühls für etwa 250 Jahre zu ruinieren. So gerieten dessen Verdienste als Schöpfer der Dresdner Kunstsammlungen und als großzügiger Auftraggeber sächsischer Barockbauten für lange Zeit in Vergessenheit. Der Film zeigt die Facetten dieser Erzfeindschaft als Spiegel der wechselvollen Beziehungen zwischen Sachsen und Brandenburg-Preußen, von der ersten Begegnung zwischen dem preußischen Kronprinzen Friedrich und dem jungen Brühl am Dresdner Hof bis zum Showdown im Siebenjährigen Krieg (1756–1763), der mit Brühls Flucht nach Polen endete. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 05.06.2014 MDR Richard Strauss – Ein musikalischer Grenzgänger
Folge 146 (30 Min.)Er polarisiert bis heute, politisch und musikalisch. Er war ein konservativer Geist, komponierte aber zeitweise hochmodern. Vor 150 Jahren in München geboren, aufgewachsen in einer großbürgerlichen und musikliebenden Familie, versuchte sich Richard Strauss schon früh als Komponist. Die ersten Werke sind der klassischen, an Beethoven und Brahms geschulten Form verpflichtet. Als er jedoch mit 21 Jahren seine erste Kapellmeisterstelle im thüringischen Meinigen antrat, entdeckte er die Musik Wagners und Liszts.Es war der Gedanke des musikalischen Gesamtkunstwerks, des Verschmelzens von Idee, Sprache und Musik, die den jungen Kapellmeister faszinierte. Nicht zur Auseinandersetzung mit tradierter Form drängte es ihn, sondern zum rauschhaften Experimentieren mit Klangfarben in seinen Orchesterwerken, worin er eine bisher unerreichte Meisterschaft erlangte. Es war daher eine Frage der Zeit, bis sich Strauss der Königsgattung der Musik, der Oper, zuwenden würde. In Dresden begann dann der Siegeszug seiner Musikdramen, neun der fünfzehn Werke wurden an der Hofoper uraufgeführt. Mit „Salome“ und „Elektra“ präsentierte Strauss hochmodernes Musiktheater an der Grenze der Tonalität. 1911 erweckte sein „Rosenkavalier“ in Dresden einen Sturm der Begeisterung. In einer Mischung aus Mummenschanz und Sentimentalität inklusive Walzerseligkeit erweist sich die Musikkomödie bis heute als Dauerbrenner in den Opernhäusern der Welt. 1933 galt er als einer der bedeutendsten deutschen Musiker seiner Generation, ein nationales Aushängeschild. So beriefen die Nationalsozialisten ihn zum Präsidenten der neugeschaffenen Reichsmusikkammer. Und Strauss machte mit, biederte sich den Machthabern an, komponierte und dichtete für sie. Er wurde missbraucht und ließ sich missbrauchen. Richard Strauss komponierte fast immer und überall, ein wahrhaft fleißiger Komponist, der alle musikalischen Gattungen bediente. Sein Credo: „Wer ein richtiger Musiker sein will, der muss auch eine Speisekarte komponieren können.“. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 12.06.2014 MDR Georg II. – Theaterherzog von Meiningen
Folge 147 (30 Min.)Georg II. von Sachsen-Meiningen war einer der bemerkenswertesten Männer im zweiten deutschen Kaiserreich. Er formte sein Thüringer Fürstentum zu einem liberalen Musterstaat. Im „Nebenberuf“ war er begeisterter Theatermann und begründete das moderne Regietheater. Er gilt als einer der herausragenden Regisseure der Bismarckzeit. Gleichzeitig war er Bühnenbildner, Kulturpolitiker und Förderer der Musik. Bekannt auch als „Theaterherzog“, hat er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert das Meininger Theater und die Meininger Hofkapelle zu Weltruhm geführt. Erbprinz Georg II. von Sachsen-Meiningen wurde am 2. April 1826 in Meiningen als Sohn von Bernhard II.Herzog von Sachsen-Meiningen geboren. Heute würde man wohl sagen, er war hochbegabt. Er hatte zeichnerisches Talent, das absolute Gehör, viel Liebe zur Musik und einen großen Intellekt. Zudem wurde er von so bedeutenden Pädagogen wie Friedrich Fröbel und Moritz Seebeck erzogen. Ab 1844 studierte er in Bonn Kunstgeschichte, Geschichte und Recht. Georg war vierzig, als er auf den Thron kam. Neben den Regierungsgeschäften aber blieb er seiner Liebe zu den Künsten, allen voran das Theater, treu. So nimmt es kaum Wunder, dass seine dritte Frau eine Schauspielerin, und diese Ehe ein Affront gegen die höfischen Sitten seiner Zeit war, was Georg II. wohl wenig kümmerte. Er adelte seine große Liebe Helene Franz noch vor der Hochzeit 1873. Als Helene Freifrau von Heldburg führte sie gemeinsam mit Georg II. das Meininger Hoftheater und die Meininger Theatergruppe zu internationalem Ruhm mit Auftritten in Berlin, Wien, Moskau, Petersburg und London. Durch diese Tourneen verbreitete sich die Idee Georg II. vom modernen Regietheater rasch auf den Bühnen Europas. Meiningen gilt noch heute als Theaterstadt. Der Film zeichnet die Höhepunkte des Lebens von Georg II. von Sachsen-Meiningen nach, dessen Todestag sich am 25. Juni 2014 zum 100. Mal jährt. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 19.06.2014 MDR Jan Josef Liefers – Keine halben Sachen
Folge 148 (30 Min.)Kauzig, leidenschaftlich, mit snobistischer Attitüde, so lieben Millionen Fernsehzuschauer Jan Josef Liefers in der Rolle des Rechtsmediziners Prof. Boerne. Mit dieser Figur erobert der Schauspieler die Herzen des Publikums. Seit 2002 löst er zweimal im Jahr mit seinem Kollegen Axel Prahl kniffelige Fälle. Doch der 1964 in der DDR geborene Künstler kann mehr als das. Als Sohn einer Schauspielerin und eines Regisseurs ist er ein Multitalent: „Wenn meine Mutter gespielt hat, bin ich sofort nach der Schule ins Theater gerannt.“ Die Welt des Theaters inspiriert den Jungen und wird für ihn zur schützenden Nische vor Bevormundung durch das politische System.Zum Beispiel als er sich weigert, zur Armee zu gehen. „Letztlich war das auch für mich so instinktiv der richtige Weg. Ich wäre sonst alle drei Meter kollidiert mit jemandem.“ Die Dokumentation zeigt Jan Josef Liefers in seinen Filmen wie „Knockin’ on Heavens Door“, „Das Wunder von Lengede“ oder „Die Nachrichten“. Und in ganz unterschiedlichen Facetten als Schauspieler, Musiker, Geliebter, Sohn und Freund. Dafür sprechen wir mit seiner Mutter Brigitte Liefers-Wähner, mit seinem Freund aus Jugendtagen Tobias Langhoff und mit Kollegen wie Til Schweiger und Axel Prahl. Mit der gemeinsamen Reise in seine Geburtsstadt Dresden beginnt unsere Erkundung seines Lebensweges. Er wird ihn aus der kleinen Wohnung seiner Oma in Dresden über die Demonstration auf dem Alexanderplatz im November 1989, wo er vor einer halben Million Menschen seine Rede hält, bis auf die Bühnen der deutschen Film- und Fernsehpreise führen. Und an die Seite einer faszinierenden Frau: Seit 2004 ist er mit der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos verheiratet. 2011 erhielten die beiden als erstes Paar unabhängig voneinander die Goldene Kamera. „Ich habe mich in der ersten Sekunde in ihn verliebt“, verrät Anna Loos. Wir sprechen mit beiden über das Geheimnis ihrer kreativen und leidenschaftlichen Beziehung. Und darüber, wie sie den Spagat zwischen der Glamourwelt und dem Familienleben mit zwei kleinen Töchtern meistern. Auf der filmischen Reise durch sein Leben wird uns Jan Josef Liefers als Musiker begleiten. Für sein Konzertprogramm mit der Band „Jan Josef Liefers & Oblivion“ hat er den Soundtrack seiner Kindheit eingefangen, wie er es nennt. Es sind individuelle Interpretationen alter DDR-Songs, die er da spielt und mit seinen eigenen Erinnerungen verknüpft. Durch sie entsteht eine subtile Nähe, die im Film spürbar wird. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 07.08.2014 MDR Erstausstrahlung als eigenständige Dokumentation am 06.10.2011 (MDR)Der Maler Otto Dix – Trau deinen Augen – Trau deinen Augen
Folge 149Ein Bild wie ein Schrei: DER KRIEG. Von Künstlerhand festgehalten – das Geschehen von vor genau 100 Jahren, 1914, Erster Weltkrieg, ein Schlachtfeld irgendwo in Europa. Die Mitteltafel des Triptychons zeigt eine vollständig verwüstete Landschaft, über die Leichen und Leichenteile verstreut sind. Nur ein Soldat mit Gasmaske scheint noch am Leben zu sein. Auf dem linken Flügel sieht man eine Soldatenkolonne voll ausgerüstet durch eine nebelige Kriegslandschaft marschieren, möglicherweise in den Kampf. Auf dem rechten Flügel sind Menschen zu erkennen, die sich aus dem Kampf zurückziehen. Die beherrschende Figur dieses rechten Bilderflügels, die einem Kameraden unter die Arme greift, ist ein Selbstportät.Der hier sich selbst Porträtierte ist der Maler Otto Dix. DER KRIEG, dieses berühmteste aller Kriegsbilder, das in der Galerie Neue Meister in Dresden hängt, bekommt man nicht mehr aus dem Sinn. Otto Dix sagte von sich selbst, er sei kein Pazifist gewesen, war er doch freiwillig in den Krieg gezogen, um zu sehen, zu erleben, um Zeugnis abzulegen. Die Erfahrungen des Krieges haben ihn zum Antikriegsmaler gemacht, seine Kriegsbilder sind von einer verstörend künstlerischen Wucht. Sie rütteln auf, bis heute. Otto Dix, am 2. Dezember 1891 in Gera geboren, wurde als Maler und Grafiker mit seinem künstlerischen Schaffen zu einem herausragenden Repräsentanten der Neuen Sachlichkeit. Er lehrte bis 1933 als Professor an der Kunstakademie in Dresden und war Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Sein Werk wurde von den Nazis als „entartet“ diffamiert und aus den deutschen Museen entfernt. Der Film in der Reihe „Lebensläufe“ erzählt, ausgehend von Dix’ Bildern über den Ersten Weltkrieg, eine Malerbiografie, die von den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt wurde. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 04.09.2014 MDR Lutz Jahoda – mit Lust und Liebe
Folge 150 (30 Min.)Lutz Jahoda ist ein Entertainer der klassischen Prägung. Er liebt seinen Beruf und er liebt sein Publikum. Immer alles geben, sorgfältigst in der Ausführung des Handwerks, leidenschaftlich in der Darbietung, perfekt im Äußeren – danach hat er immer gearbeitet. Ein Gentleman – oft verglichen mit Peter Alexander – immer neugierig geblieben, jüngst zum Romanautor avanciert. In der DDR war Lutz Jahoda Fernsehliebling über Jahrzehnte. Seine damals eigene Show „Mit Lutz und Liebe“ ist inzwischen Kult.Auf vielen Bühnen – auch großen Theaterbühnen – des deutschsprachigen Raumes hat Lutz Jahoda Erfolge gefeiert. 1955 gehörte er zu den Pionieren bei der Einführung des Fernsehens in Berlin-Adlershof. Im größten Revuetheater Europas – im Friedrichstadtpalast – feierte er Triumphe. Bei der DEFA stand Lutz Jahoda an der Seite von Angelica Domröse und Manfred Krug vor der Kamera. Ein Multitalent wie Jahoda kann nicht in den Ruhestand gehen. Er wird sein Publikum auch im neunten Lebensjahrzehnt immer wieder überraschen. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 11.09.2014 MDR lief zuvor bereits außerhalb von "Lebensläufe" (EA: 07.07.2011)Silbermann – Zwei Brüder erobern die Orgelwelt
Folge 15119. August 1714. Bis auf den letzten Platz ist die Kirche gefüllt. Eifriges Getuschel in den Bankreihen: Haben sich die drei Jahre ungeduldigen Wartens wirklich gelohnt? War das viele Geld wirklich eine gute Investition? Doch als die ersten Töne erklingen, sind alle verzaubert. Sie ist ein Meisterwerk, die neue Orgel im Dom zu Freiberg. Ihr Schöpfer wird mit 31 Jahren über Nacht berühmt: Gottfried Silbermann. Im selben Jahr beginnt Gottfrieds älterer Bruder Andreas mit dem Bau seiner Orgel für die Kathedrale in Straßburg.Es wird seine größte sein. Zusammengerechnet bauen die Brüder Silbermann fast 80 Orgeln, alle von höchster Klangqualität. Durch ihre Werke und die ihrer Schüler prägen sie den Orgelbau in ganz Europa. Deutschland kennt keinen berühmteren Orgelbauer als Gottfried Silbermann. Die Nachfahren seines Bruders Andreas bauen in Frankreich noch bis ins 19. Jahrhundert erfolgreich Musikinstrumente. Bis heute rankt sich um die Orgeln der Brüder ein wahrer Kult. Scharenweise kommen die Fans von weit her, nur um sich am Klang einer echten Silbermann-Orgel zu berauschen. Was der Name Stradivari für die Geige, das ist die Marke Silbermann für die Königin der Instrumente. Doch so berühmt ihre Orgeln sind, so wenig wissen wir über das Leben der Silbermann-Brüder. Nicht mal ein Bild von ihnen ist überliefert. Grund genug, um in einem neuen Film der MDR-Reihe „Lebensläufe“ auf Spurensuche zu gehen und zu erkunden wie es dem Brüderpaar aus Sachsen gelang, die Orgelwelt zu erobern. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 02.10.2014 MDR Der Papstmaler Michael Triegel
Folge 152Eine Meldung hat den Leipziger Maler Michael Triegel mit einem Schlag berühmt gemacht: Triegel malt den Papst! Auftraggeber ist das Regensburger Institut Papst Benedikt XVI. Michael Triegel reiste nach Rom zur Audienz – konnte fotografieren und Skizzen machen – und mit Benedikt sprechen. „Sie sind also mein Raffael“, sagte der Papst. Welch ein Satz, welch eine Bürde, welch eine Herausforderung für Michael Triegel. Triegel ist jung, ein bisschen über 40, aber ein großer Meister seines Metiers. Die hervorragende Ausbildung an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst bei Professor Arno Rink und Ulrich Hachulla hat den Grundstein gelegt.Und: Michael Triegel ist bodenständig. Der Medienhype um die Neue Leipziger Schule hat ihn nicht von der ernsthaften Suche nach seinem eigenen Stil abgebracht. In der Reihe „Lebensläufe“ wird der künstlerische Werdegang Michael Triegels nachgezeichnet – bis zur offiziellen Übergabe des Papstbildes und der Eröffnung einer Personalausstellung im Leipziger Bildermuseum am 27. November 2010. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 16.10.2014 MDR Heike Drechsler: 19 Jahre 19 Schritte
Folge 15319 Schritte – soviel Anlauf brauchte Heike Drechsler, um sich auf Weltrekord-Weiten zu katapultieren. 19 Jahre – über diesen unfassbar langen Zeitraum verkörperte Heike Drechsler Leichtathletik-Weltklasse, von 1981 bis 2000. Jetzt, zu ihrem 50. Geburtstag, hält sie Rückschau. Von der scheuen, zurückhaltenden „Gerschen Fettgusche“ zum gefeierten Sport-Star – und von dort zur gereiften, souveränen Frau, die mit sich selbst im Reinen ist: Es sind viele Brüche und Wendungen, die das Leben von Heike Drechsler bestimmen. Die MDR-Sendereihe „Lebensläufe“ vollzieht sie nach, gemeinsam mit Wegbereitern, Freundinnen, Konkurrentinnen und Familienangehörigen.Autor Sascha Mönch reist mit der größten deutschen Leichtathletin aller Zeiten zurück zu ihren eigenen Wurzeln. Als Kind, das in Gera die ersten Läufe und Sprünge lernt. Als Jugendliche, die sich auf der Sportschule in Jena anfangs nur dank ihrer Freundin Esther Zschieschow durchbeißt. Eine Freundschaft übrigens, die bis heute anhält. Spätestens mit dem ersten DDR-Meister-Titel 1981 ist Heike in der internationalen Spitze angekommen. Wie zum Beweis wird sie 1983 die erste Weitsprung-Weltmeisterin der Geschichte. Es folgt ein Triumphzug in die Leichtathletik-Annalen: Europameisterin, Weltrekordlerin, Sportlerin des Jahres. Ihre Dauer-Konkurrentin: Jackie Joyner-Kersee aus den USA, mit der sie gleichzeitig eine ungewöhnliche Ost-West-Freundschaft verbindet. Den größten Bruch in Drechslers Leben bringt das Jahr 1990 mit sich. Sie ist frischgebackene Mutter, macht ihren Schwiegervater zum Trainer – und muss sich davon verabschieden, wie bisher als Staats-Star verhätschelt zu werden. Aber sie schafft den Sprung in die neuen Verhältnisse – so gut wie kaum ein anderer der DDR-Sport-Heroen. Bester Beweis: 1992 wird sie Olympiasiegerin. Gleichzeitig holen die Schatten der Vergangenheit sie ein: Dopingvorwürfe, Stasi-Mitarbeit. Die neue Freiheit ist auch schmerzhaft. Doch Heike macht das, was sie immer am besten konnte: Kämpfen. Sich durchbeißen. Und belohnt sich selbst mit dem vielleicht größten Triumph ihrer Karriere, dem zweiten Olympiasieg im Jahr 2000, als mittlerweile fast 36-Jährige! Jetzt, kurz vor ihrem 50. Geburtstag, scheinen die Brüche der Vergangenheit geheilt. Eine gewisse Gelassenheit bestimmt Heike Drechslers Umgang mit dem eigenen Leben – einem Leben, in dem sie noch viele Schritte gehen will. (Text: mdr) Deutsche TV-Premiere Do. 11.12.2014 MDR
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Lebensläufe direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Lebensläufe und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.
Erinnerungs-Service per
E-Mail