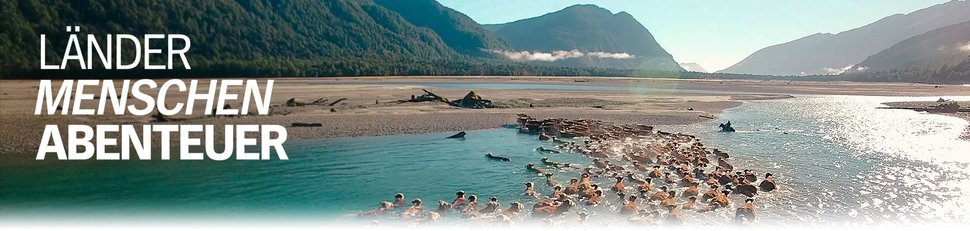1783 Folgen erfasst, Seite 52
Eine Reise durch Schlesien – Von Görlitz bis Glatz
Jahrhunderte lang war Schlesien Zankapfel zwischen wechselnden Mächten. Viele Länder haben hier ihre Spuren hinterlassen – Österreicher, Preußen und zuletzt die Polen. Drei Kriege führte der Preußenkönig Friedrich der Große gegen seine Erzrivalin Maria Theresia um dieses Land und machte es, als er siegreich blieb, zur blühenden Industrie- und Kulturregion seines Reiches. Heute gehört Schlesien größtenteils zu Polen. Auf seiner Reise durch Schlesien hat Filmautor Wolfgang Wegner bekannte und unbekannte Ecken wiederentdeckt. Die Neiße trennt Schlesien. Diesseits des Flusses liegt Görlitz, die alte, liebevoll restaurierte Tuchweberstadt mit einem Stadtkern alter Häuser aus vielen Epochen.In Bunzlau, dem polnischen Boleslawiec, wird noch, wie in deutscher Zeit, die berühmte Bunzlauer Keramik hergestellt. In Zielona Góra – Grünberg – befindet sich Polens einziges Weinbaugebiet, in Treibhäusern werden die meisten Reben gezogen. Weiter geht die Reise ins sagenumwobene Riesengebirge mit seinem höchsten Berg, der Schneekoppe. In Agnetendorf, am Fuße des Riesengebirges, befindet sich das „Haus Wiesenstein“, wo der deutsche Schriftsteller Gerhart Hauptmann sein berühmtes Drama „Die Weber“ schrieb. Schlesien ist das Land uralter Burgen, verwunschener Schlösser, eleganter Herrenhäuser. Einige Geschäftstüchtige erwecken sie zu neuem Leben, restaurieren sie, machen Hotels und Gästehäuser daraus. Wolfgang Wegner besucht die Glashütte „Julia“ und das „Schlesier“-Gestüt in Petersdorf, wo seit 1844 edle Pferde gezüchtet werden, und in Waldenburg die Klosterschule der Ursulinen. Begegnungen mit Gegenwart und Vergangenheit zwischen Görlitz und Glatz – mit Menschen, die Einblicke in ihr Leben zulassen. Die meisten von ihnen sind Polen, denen Schlesien zur Heimat geworden ist. (Text: hr-fernsehen) Eine Reise durch Schlesien – Von Kattowitz bis Breslau
Eine Reise durchs Memelland – Litauens Süden
Der Oberlauf des Flusses Memel bildet die Grenze zwischen dem Königsberger Gebiet, dem zu Russland gehörenden Teil des ehemaligen Ostpreußens, und Litauen. Nemunas heißt die Memel auf Litauisch. Im Memeldelta an der Ostsee mündet der Fluss ins Kurische Haff. Am Horizont erkennt man die Silhouette der Kurischen Nehrung. Über viele Jahrhunderte war das Memelland eine multikulturelle Grenzlandschaft, in der Deutsche, Litauer, Juden, Russen, Polen und viele andere friedlich zusammenlebten. Die Memel hat die Menschen in der Grenzregion zu allen Zeiten geprägt. Sie hatten schon immer ein ganz besonders enges Verhältnis zu diesem Fluss, zur Landschaft, durch die er fließt, zur Natur überhaupt.Die filmische Reise durchs Memelland beginnt in Smalininkai (Schmalliningken), führt an der Memel entlang nach Ruß (Rusne) am Memeldelta. Weitere Stationen sind Heydekrug (Šilute), die Kurische Nehrung und die Hafenstadt Klaipeda, die früher einmal Memel hieß. Das Fernsehteam hat auf der Reise Menschen getroffen, die unterschiedlicher nicht sein können: Eine alte Frau, deren Familie seit Jahrhunderten im Memelland lebt, erzählt von ihrer Kindheit. Der Hof in Bitenai, auf dem ihr Sohn Mindaugas 200 Milchkühe hält, ist schon 200 Jahre alt. Junge Leute aus der Abschlussklasse des Gymnasiums von Šilute sind begeisterte Mitglieder des Theaterensembles ihrer Schule und wollen einmal Journalisten werden. Sie berichten über kleine und große, bemerkenswerte und typische Dinge in ihrer Heimat. Auf der Kurischen Nehrung, die zu den europäischen Sehnsuchtslandschaften gehört, lernt das Fernsehteam einen deutschen Rechtsanwalt kennen, der sich hier zusammen mit seiner litauischen Frau niedergelassen hat. In der Stadt Klaipeda, heute Litauens Tor zur Welt, endet die Reise durch das Memelland. Ihr prosperierender Hafen ist Teil einer Sonderwirtschaftszone, deren Boom eng mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union verbunden ist. (Text: BR Fernsehen) Reise in die Hölle – Straflager Workuta
Sechs Monate lang ist es in Workuta stockdunkel und erbarmungslos kalt – bis minus 50/60 Grad. Workuta war Teil des Archipel Gulag. Dorthin wurden Hunderttausende von Stalins Gegnern deportiert. NDR Autorin Rita Knobel-Ulrich hat sich mit drei deutschen ehemaligen Häftlingen auf den gleichen Weg gemacht, den sie damals im Viehwaggon zurücklegen mussten, von Berlin über Moskau nach Workuta. Sie war mit ihnen auf Spurensuche: Im KGB-Archiv durften die inzwischen Rehabilitierten ihre Häftlingsakte einsehen und im Butyrki-Gefängnis in Moskau ihre alte Zelle besuchen. Erinnerungen wurden wach, Tränen flossen. (Text: NDR)Deutsche TV-Premiere So. 20.03.2005 Südwest Fernsehen von Rita Knobel-UlrichReise nach Mähren
Zu Besuch bei Nachbarn in Europa. Eine Reise mit historischen und touristischen Eindrücken von Land und Leuten. (Text: WDR)Reise nach Wirikuta – Die Huichol und der Peyote-Kaktus
Deutsche TV-Premiere Mi. 23.09.1998 Südwest Fernsehen von Ingrid Kummels und Manfred SchäferReisen in ferne Welten
Der australische Inselstaat Tasmanien ist ein Synonym für „Entlegenheit“, „Sträflingsinsel“ oder auch „Paradies am Ende der Welt“. Um der jungen Kolonie Australien mit billigen Arbeitskräften auf die Beine zu helfen, deportierte die britische Regierung massenhaft Sträflinge, 76.000 in den ersten fünfzig Jahren. Für die meisten war Tasmanien tatsächlich eine „Teufelsinsel“. Unter den Gefangenen waren nicht nur Mörder und Vergewaltiger, sondern auch Taschendiebe und Obdachlose. Doch die mächtige Van Diemens Land Compagnie versuchte den Schaffarmern ein anderes Bild von Tasmanien zu zeichnen. Landgeschenke lockten, Wolle brachte beachtiliche Gewinne. In wenigen Jahren übertraf die Zahl der Schafe die der Menschen um den Faktor tausend.Auch die Fruchtbarkeit des Bodens wurde gerühmt. Der Mensch mache sich die Natur untertan – diese Losung hat in Tasmanien einen fortgesetzten Feldzug gegen die Umwelt initiiert, gegen Ureinwohner, Beuteltiere, Wälder. Erst in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, nachdem es längst keine reinblütigen Aborigines mehr gab, die Hälfte aller Säugetierarten in Australien ausgerottet und die meisten alten Eukalyptuswälder abgeholzt waren, hat ein Umdenken eingesetzt. 1972 wurde in Hobart sogar die erste Grüne Partei der Welt gegründet. Jetzt versuchen die Tasmanier, das vom Paradies zu retten, was noch übrig ist: die letzten Quadratkilometer saubere, unberührte Natur. (Text: hr-fernsehen) Rentiermädchen – Leben am Polarkreis
Schnee und Eis beherrschen den Norden Norwegens – in dieser rauen Welt leben Europas letzte Nomaden. Jahr für Jahr ziehen die Samen mit ihren riesigen Rentierherden durch die arktische Tundra. Auch die Familie der 16-jährigen Elle begibt sich von den Überwinterungsgebieten im nordnorwegischen Kautokeino zur Insel Anoeya, wo die Tiere ihre Jungen zur Welt bringen. Was aber bewegt ein 16 Jahre altes Mädchen dazu, bei Minustemperaturen Rentieren zu folgen, statt wie andere Teenager ein modernes Leben zu führen? Auf der über 270 Kilometer langen Reise leben Elle und ihre Cousine Inga nach den uralten Traditionen ihrer Familien und müssen mehrere hundert Tiere sicher ans Ziel bringen. (Text: SWR)Retter an Irlands Küsten – Bei der Irish Coast Guard
County Kerry im Westen Irlands gehört zu den für viele Menschen schönsten Regionen der Britischen Inseln. Doch die raue Küste fordert jedes Jahr ihre Opfer: Freizeitsegler, Surfer und Schwimmer unterschätzen die Kraft des Ozeans. Fischer riskieren in der tosenden See zu viel und geraten in Seenot. An Land verleiten die spektakulären Klippen manchen Wanderer, zu nah an die Felskante zu treten. Bei einem Notfall rücken die Freiwilligen der traditionsreichen irischen Küstenwache aus. Per Rettungsboot, Hubschrauber und mit Spürhunden suchen die Helfer nach Verletzten und Verschollenen. In dem Film werden die Lebensretter der Dingle Coast Guard begleitet.21 Lebensretter umfasst das Team. Mindestens einmal in der Woche treffen sie sich zum Training. Diesmal hat Einsatzleiter Frank Heidtke eine Kletterübung an den Klippen von Dingle angesetzt. Bis 200 Meter ragen sie an einigen Stellen fast senkrecht aus dem Atlantik. Während der deutschstämmige Einsatzleiter seit Jahren im Team ist, muss sich Neuling Seamus Murphy erst noch bewähren. Er hat seine Ausbildung zum Kletterer erst vor Kurzem abgeschlossen. Nun wartet er auf die Chance, dass ihm die Verantwortung für eine Rettungsaktion übergeben wird. Bei über 20 Einsätzen im Jahr dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis es so weit ist. (Text: rbb) Die Retter der Schneeleoparden
Sie sind die Könige der Bergwelt: schnell wie der Wind, schlau wie ein Fuchs und stark wie ein Bär. Seit Jahrtausenden leben die Schneeleoparden von Kirgisistan hoch oben im ewigen Eis des Tien-Shan-Massivs, fern von jeder Zivilisation. Sie müssen nur den Hunger fürchten – und die Menschen. Denn in der letzten Zeit ist der Bestand der edlen Tiere in dem zentralasiatischen Staat mehr und mehr bedroht, wird ihnen der nötige Lebensraum immer mehr eingeschnürt. Der Klimawandel lässt die Gletscher schmelzen, die Bauern ziehen mit ihren Ziegen immer höher in die unwirtlichen Gebirgs-Regionen und betrachten die Schneeleoparden als Feinde, die ihre Herden bedrohen.Jäger wildern die Tiere, deren Fell auf dem Schwarzmarkt gerne 10.000 Dollar bringt. Vor zwanzig Jahren streiften mehr als 4.000 Großkatzen durch die Berge, heute – so wird geschätzt – gibt es in Kirgisistan nur noch 250 Schneeleoparden. Der deutsche Naturschutzbund NABU hat hoch über dem Issyk-Kul-See ein Projekt zum Schutz der bedrohten Raubkatzen eingerichtet. Geleitet wird das weltgrößte Freigehege zum Schutz der Raubkatzen von dem Biologen Thorsten Harder. Hier leben auf einer Fläche von etwa 7.000 Quadratmetern mehrere Tiere, die aus den Fallen von Wilderern gerettet wurden und die in freier Wildbahn wenig Überlebenschance hätten. Vor einer traumhaften Bergkulisse leben sie nun unter nahezu normalen Bedingungen, Pfleger kümmern sich um ihre Wunden und sorgen für ausreichend Futter. Inzwischen haben Kunak, Bagira und Co. auch Nachwuchs, zwei junge Leoparden, die später wieder ausgewildert werden sollen. Mit der kirgisischen Tierärztin Saltanat Seitova gelang es Thorsten Harder auch, zahlreiche Tiere aus dem Privatzoo des ehemaligen kirgisischen Präsidenten Kurmanbek Bakiew zu befreien, darunter Wölfe, Bären und auch ein Schneeleoparden-Männchen. Wenn alles gut geht, kann es bald auch zu den Tieren am Issyk-Kul. Die schwarz-weiß gefleckten Tiere werden in der kirgisischen Kultur mythisch verehrt. Ein Schneeleopardenfell würde seinem Besitzer Macht und Prestige übertragen, glauben viele. Deswegen schmückte bis vor kurzem auch die politische Elite ihr Heim gern mit solchen Trophäen. Dem Einsatz von Thorsten Harder und seinen Mitstreitern ist es zu verdanken, dass die Schneeleoparden von Kirgisistan heute sicherer sind denn je. Das Schutzprogramm umfasst auch Ranger, die den Wilderern nachstellen und dafür sorgen, dass der Schwarzmarkt nach und nach austrocknet. So bleibt die Hoffnung, dass die Schneeleoparden wie früher die weiten Gebirgszüge des Landes bewohnen und das einstige Wappentier Kirgisistans eine Zukunft hat. Der Film zeigt in spektakulären Aufnahmen Schneeleopardenbabys und erwachsene Tiere vor einer grandiosen Bergwelt. Es ist ein Porträt der Menschen, die sich dem Schutz dieser Tiere verschrieben haben, ebenso wie des Landes Kirgisistan. Der Film lässt miterleben, unter welch teilweise primitiven Bedingungen die Naturschützer sich ihrer Aufgabe widmen müssen und welche kleinen und großen Triumphe sie dabei erringen. Das ehemalige Bollwerk gegen China kämpft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit bitterer Armut und politischer Instabilität. Sein größter Schatz – seine weite, unberührte Natur – droht im Zuge dieses Kampfes mehr und mehr unter die Räder zu kommen. Umso wichtiger sind Signale, wie sie die Retter der Schneeleoparden setzen. (Text: rbb) Der Rhein von oben – Von der Quelle zum Deutschen Eck
Rhythmus, Erotik, Revolution – Frauenbilder in Kuba
Seit 50 Jahren zwingt das von den US-Amerikanern verhängte Wirtschaftsembargo die Kubaner dazu, losgelöst von der Moderne zu leben. In den Straßen von Havanna gibt es weder Staus noch Werbetafeln. Dafür ist der Besucher aber erstaunt über die unbändige Lebensfreude der Kubaner und über ihre Energie, die sie entwickeln, um mit dem wenigen auszukommen, das sie zum Leben haben. Jeden Tag müssen sie erfinderisch sein, um von A nach B zu kommen, um sich zu ernähren oder gut zu kleiden. Die Mehrzahl der Kubanerinnen hat noch nie eine Modezeitschrift gelesen.Für Kosmetikprodukte oder schöne Kleidung fehlt den meisten das Geld. Also machen sie das Beste aus dem wenigen, das ihnen zur Verfügung steht. Von rund ein Dutzend Frauen gibt Filmemacher Daniel Lainé Einblick in deren Leben, darunter sind Tänzerinnen, Schriftstellerinnen, Musikerinnen, Schauspielerinnern und Arbeiterinnen. Die meisten sind zufrieden mit ihrem Körper – ganz egal, ob sie jung oder alt, dick oder dünn sind. Ihnen sind die Komplexe, die so viele Europäerinnen quälen, völlig fremd. Ihre multiethnische Herkunft, die Verschmelzung spanischer, afrikanischer und chinesischer Abstammung, scheint ihnen eine natürliche Gelassenheit zu verleihen, die durch die Sonne und das tropische Klima noch gestärkt wird. Auf Kuba kommt jeder leicht mit dem andern ins Gespräch. Hier lächeln die Frauen, wenn die Männer ihnen hinterherpfeifen oder ein „Piropo“ – ein unverblümtes Kompliment – nachrufen. In Europa mag dies als vulgär gelten, doch auf Kuba gehören „Piropos“, die die Schönheit der Frauen preisen, einfach dazu. (Text: SWR) Der Rideau Kanal in Kanada – Eine Romanze zwischen Technik und Natur
Der Rideau-Kanal wurde als Versorgungskanal zwischen dem Atlantik und den Großen Seen im amerikanisch-kanadischen Krieg Anfang des 19. Jahrhunderts geplant. 1832 wurde der 200 Kilometer lange Kanal mit 43 Schleusen eingeweiht. Seinem militärischen Zweck diente er nie. Heute zählt die Region um den Kanal zu den beliebtesten Erholungs- und Freizeitgebieten Nordamerikas. Ein sportlicher Klub abenteuerlustiger junger Amerikaner bepackt mit Zelten, Rucksäcken, Angeln und Kletterschuhen ist am unteren Ausgang der Schleuse von Lower Brewers an Land gegangen, um ihr Biwak aufzubauen an einem der romantischsten Flecken, die man sich auf Erden vorstellen kann.Vor 180 Jahren wäre es noch ganz undenkbar gewesen, dass eine Gruppe amerikanischer Kanuten den Rideau-Fluss im Südosten Kanadas zu einem Ausflug genutzt hätte. Nicht nur weil das wilde, versumpfte Gelände zwischen dem heutigen Ottawa und Kingston am Ontario See entlang Hunderter von Seen am Rideau lebensgefährlich malariaverseucht war, sondern auch Kriegsgebiet zwischen Kanada und den jungen Vereinigten Staaten von Amerika. Wo einst die eingeborenen Indianerstämme, vor allem die Algonquin, Jagd auf Tierfelle machten, plante die britische Kolonialmacht Anfang des 19. Jahrhunderts einen Kanal zu bauen, um ihren militärischen Nachschub zwischen Atlantik und den Großen Seen Nordamerikas zu sichern – der Rideau-Kanal entstand. 1832 wurde er eingeweiht. Bis heute ist der Rideau-Kanal von urwüchsiger, natürlicher Schönheit geblieben, obwohl er ein von Menschen geschaffener Wasserweg ist. Die Landschaft gilt als die abwechslungsreichste Kanadas und die Tierwelt entfaltet sich artenreich und unerschrocken von der moderaten Zivilisation entlang des Gewässers. 43 Schleusen verbinden den zuvor unschiffbaren Rideau-Fluss mit der unendlichen Seenlandschaft. So wurde der Rideau-Kanal nicht nur die bedeutendste und längste künstliche Wasserstraße Nordamerikas, sondern auch eine technische Meisterleistung des frühen 19. Jahrhunderts. Ununterbrochen in Betrieb seit seiner Eröffnung, ist er außerdem der einzige Kanal des Kontinents, der noch genauso funktioniert, wie ihn einst seine kolonialen britischen Erbauer errichten ließen. Der Rideau-Kanal jedoch hat nie seinem militärischen Zweck gedient, denn es herrschte bald Frieden zwischen den kanadischen und amerikanischen Völkern. So hat ihn schlichtweg die Bevölkerung erobert. Die Kanadier lieben ihn, die Touristen aus aller Welt bewundern ihn. Heute zählt die Region in der Provinz Ontario zu den begehrtesten Erholungs- und Freizeitgebieten Nordamerikas. (Text: BR Fernsehen) Riga – Rose im Baltikum
Riga ist die Hauptstadt Lettlands. Stadt und Land im Herzen des Baltikums kehren nach langer Versunkenheit im Sowjetimperium nun allmählich ins Bewusstsein der Westeuropäer zurück. Für manche ist Riga eine Stadt der Prostitution, abenteuerlicher Geschäfte, der Kriminalität. Doch daneben und recht eigentlich ist es eine Stadt wie überall in Europa, voller Verkehr in einer historischen Kulisse, die für andere Fortbewegungsarten gebaut worden ist. Voll mit Menschen, die vertraut sind in ihren Gesten, ihrer Sehnsucht und ihrer Suche nach dem Glück. Der Film erzählt von der Stadt, ihrer Geschichte, ihren Bewohnern, zeigt Riga und seine Umgebung in Erwartung einer neuen Epoche. (Text: hr-fernsehen)Rio de la Plata
Das Parana-Delta, ein Labyrinth aus Wasserwegen an der Ostküste Argentiniens, rund 30 Kilometer nördlich von Buenos Aires. Jahrelang galt die Region als Rückzugsort für Künstler, Aussteiger und Eigenbrötler. Doch zunehmend entdecken auch gestresste Großstädter diese Idylle für sich – mit noch nicht absehbaren Folgen für das Delta und seine ständigen Bewohner. 360° – GEO Reportage hat den charismatischen Flusskapitän Oskar „Chiqui“ Bruzzone bei seinen Touren durchs Delta begleitet und erlebt, wie die Menschen auf den drohenden Wandel reagieren. (Text: WDR)Rio Paraná – der dunkle Fluss
Deutsche TV-Premiere Sa. 28.01.1984 S3 von Rolf PflückeRios Rebellen bei Nacht
Rio de Janeiro hält sich bis heute für die großartigste Stadt der Welt. Dabei leben rund vier der zehn Millionen Einwohner in den so genannten Favelas, den Elendsvierteln an den Hängen Rios. Kontrolliert werden diese Slums von den Drogenbaronen, die sich auch untereinander Machtkämpfe liefern, willkürlich Menschen ermorden, Angst und Schrecken verbreiten und in den Favelas unter anderem ihren Nachwuchs rekrutieren. Gouverneursregierung, Verwaltung und Polizei haben entweder kapituliert oder arbeiten mit der Drogenmafia zusammen. Filmautor Klaus Werner und Kameramann Florian Pfeiffer, die beide viele Jahre in Rio gelebt haben, zeigen aber nicht nur diese brutale Seite des alltäglichen Lebens in Rio.Ihnen ist es gelungen, Kontakt zu Favela-Bewohnern zu bekommen, die versuchen, mit verschiedensten Aktivitäten insbesondere den jungen Menschen in den Favelas das Leben erträglicher zu machen und ihnen Alternativen aufzuzeigen. So konnten sie unter anderem auf den verbotenen Funk-Partys drehen, wo die beiden Musiker Catra und Jovem mit HipHop und Rap den Jugendlichen die Botschaft vermitteln, dass es auch ein Leben außerhalb von Gewalt und Kriminalität gibt. (Text: hr-fernsehen) Die Riviera der Zaren
Die Halbinsel Krim ist nicht nur für den gleichnamigen Sekt bekannt, sondern schon seit der Zarenzeit Anbaugebiet von Tisch-, Dessert- und Qualitätsweinen. Berühmt ist die Krim aber vor allem als Urlaubsregion, die nicht nur die russischen Herrscher, sondern auch viele Künstler wie Lew Tolstoi, Anton Tschechow oder Pjotr Iljitsch Tschaikowsky zu schätzen wussten. Sonnenverwöhnt voller Zypressen, Palmen und Feigenbäume, eine grandiose Landschaft mit einer Fülle prächtiger Paläste und großartiger Bauwerke: Die Südküste der Halbinsel Krim ist unbestritten die Riviera des Schwarzen Meers, und der Bade- und Kurort Nummer eins war und ist Jalta, ein idealer Ausgangspunkt für Touren zu anderen Sehenswürdigkeiten der Krim. Der Film lädt ein zu einer Reise durch die Geschichte und die Kultur dieses einzigartigen Fleckens Erde inmitten des Schwarzen Meeres. (Text: hr-fernsehen)Die Römer im Totenreich der Pharaonen
Jahrhundertelang konzentrierten die Ägyptologen ihre Aktivitäten auf Ausgrabungen im fruchtbaren Niltal. Die Geschichte der Westlichen Wüste und der Oasen aber blieb im Dunkeln. Erst neueste Ausgrabungen zeigen, welchen wichtigen Stellenwert die Oasen in der Welt der Pharaonen hatten: Es waren Orte, in denen sehr reiche und mächtige Gouverneure regierten. Es waren Zwischenstationen einer Handelsstraße, die von Dachla aus weiter nach Westen führte. (Text: rbb)Rooibos – Roter Tee aus Afrika
250 Kilometer nördlich vom legendären Kap der Guten Hoffnung liegt das Rooibos-Gebiet. Nur hier, am Rand der Cedarberge, herrschen die weltweit einmaligen Bedingungen, die der Tee für sein Gedeihen braucht: heiße Sommer, regnerische Winter und sandigen Boden mit einer besonderen Mischung von Mineralien. Das kleine Städtchen Clanwilliam mit seinen 6.000 Einwohnern ist das Zentrum des Rooibos-Gebiets. Fast alle Bewohner der Region leben von der Teeproduktion. Der Pflücker Gert Paulse arbeitet sich täglich mit einer Sichel auf der Teeplantage durch die grünen, ginsterartigen Büsche.Bis zu tausend Kilogramm erntet er an einem Tag. Willem Engelbrecht hat eine der größten Rooibosfarmen des Landes. Er ist mit dem Tee aufgewachsen und erläutert auf seinem „Teacourt“, wie aus dem grünen Busch ein guter roter Tee wird. Die Mitglieder einer Kooperative farbiger Kleinbauern zeigen, dass sie sich mit ihrem Zusammenschluss von der Dominanz der weißen Südafrikaner befreien können und gleichzeitig durch ökologischen Anbau ein neues Bewusstsein für die einzigartige Landschaft und ihre Pflanzen entwickeln. (Text: hr-fernsehen) Die rote Wüste
Der Gebirgszug MacDonnell erstreckt sich einige Hundert Kilometer in westöstlicher Richtung durch das ansonsten vollkommen flache, wüstenartige Zentrum Australiens. Nur die berühmten abgeschliffenen Sandsteinkuppen von Kata Tjuta (früher: The Olgas) und Uluru (früher: Ayers Rock) ragen noch aus dieser riesigen Ebene heraus. 1992 wurde die Bergkette auf ihrer gesamten Länge zum Nationalpark West-MacDonnell-Ranges erklärt. Das vor 350 Millionen Jahre entstandene Gebirge wird von mehreren Flussläufen durchschnitten, der bekannteste von ihnen ist der Finke River, eines der ältesten Flusssysteme der Erde.Kaum ein anderer kennt die Natur dieser Region so gut wie der deutschstämmige Botaniker Peter Latz. Er wuchs in Hermannsburg auf, einer Missionsstadt am Südrand der West Macs. Seine Jugendfreunde waren Aborigenes der Aranda, deren Sprache er beherrscht. Krater und eigenwillig geformten Felslandschaften prägen die Region. Für die Aborigenes, die Ureinwohner, sind die Landschaftsformationen lebendig, Spuren der mythischen Regenbogenschlange aus der spirituellen Traumzeit, die durch die Erklärungen und Anekdoten des Botanikers Peter Latz auch dem Europäer verständlich werden. Grasland, Heidelandschaft, Regenwald, Wüste und schroffe Berge, die Wildnis Australiens hat viele Gesichter. Die fünfteilige Dokumentationsreihe führt durch ganz verschiedene Regionen des Fünften Kontinents. Filmemacher Peter Moers hat auf seiner Reise Menschen besucht, die sich der Einsamkeit und Wildheit des Landes stellen und der sengenden Dürre, den Buschfeuern und anderen Widrigkeiten gewachsen sind. Sie sehen das Outback nicht als lebensfeindlich. Es dient vielmehr als Nahrungsquelle und Apotheke. Sogar heftige Überflutungen können für bedrohte Tierarten ein rettender Segen sein. (Text: ARD alpha) Rounding up Buffaloes
Den bis zu einer Tonne schweren Bisons liegt die Wanderlust im Blut und davon lassen sie sich auch durch Zäune nicht abhalten. Bisonrancher wie Ron Thiel meistern solche Schwierigkeiten. In Zusammenarbeit mit indianischen und weißen Naturschützern vom Yellowstone- und Custer-Nationalpark will er den Indianerbüffel vor dem Aussterben bewahren. Höhepunkt der Dokumentation ist das zweitägige „Buffalo Round up“ im Custer-State-Park. Die Kamera ist hautnah dabei, wenn die Buffalo-Boys die Herden durch die Hügellandschaft South-Dakotas für die Herbstauktion zusammentreiben. (Text: BR Fernsehen)Die Rückkehr der Moschusochsen
Früher bewohnten Moschusochsen die kalten Regionen im Norden Amerikas, Asiens und Europas. Doch nach der letzten Eiszeit konnten sie nur in Nordamerika überleben. In den 70er Jahren wurden 30 Tiere von Kanada nach Sibirien gebracht, um sie hier wieder anzusiedeln. Die Filmemacher Vasili Sarana und Valeri Fidirkin haben sich in die Tundra aufgemacht, um die scheuen Tiere zu filmen. Einen arktischen Sommer lang sind die Filmemacher Vasili Sarana und Valeri Fidirkin aus Tallinn unterwegs auf der Halbinsel Taimyr im äußersten Nordosten Sibiriens [Russland]. Sie wollen hier einen Film über Moschusochsen drehen. Vor vielen Tausend Jahren waren diese großen Hornträger überall in den kalten Regionen des Nordens verbreitet.Nach der letzten Eiszeit starben sie in Asien und Europa vollständig aus, nicht aber in Nordamerika. Von Kanada aus wurden Mitte der 70er Jahre 30 Moschusochsen in die Sowjetunion nach Taimyr gebracht. Die Wissenschaftler hegten die Hoffnung, die Art hier wieder heimisch werden zu lassen. Gut 30 Jahre später suchen nun die beiden Filmemacher in der faszinierenden Landschaft des riesigen menschenleeren Gebietes nach den Nachkommen der ausgewilderten Tiere. – Ein Geduldsspiel. Doch endlich: Im milden Licht der Polarsonne ziehen Moschusochsen durch die Tundra von Taimyr – und lassen sich filmen. (Text: EinsPlus) Rückzug in die Taiga – Leben wie vor 100 Jahren
Seit drei Jahrhunderten nehmen die Altgläubigen Russlands ein mühseliges und entbehrungsreiches Leben in der freiwilligen Verbannung Sibiriens auf sich – aus Liebe zu Gott. Jedweder Fortschritt wird aus Überzeugung abgelehnt. Fotografiert und gefilmt zu werden gilt als Sünde. Viel Überredungskunst war nötig, diesen Film drehen zu dürfen. Leontij lebt mit seiner Familie versteckt in der Taiga. Wie alle priesterlosen Altgläubigen in seinem Dorf lehnt er aus Überzeugung jedweden Fortschritt ab. So wie vor 100 Jahren sind und bleiben Pferde für ihn das einzige Transportmittel. Leontij hat sechs Kinder.Viel zu wenig für eine altgläubige Familie, wie er meint. Eine Schule kennen seine Kinder nicht. Sie werden, wie alle Kinder hier, nach alter russischer Tradition erzogen. Lesen und Schreiben bringt traditionell die Mutter zu Hause aus der Bibel bei. Und was man zum Überleben in der Taiga braucht, lernen die Kinder vom Vater. Hauptnahrungsmittel der Altgläubigen sind Kartoffeln und Getreide, ergänzt durch das selbst angebaute Gemüse und die in der Taiga gesammelten Zirbelnüsse. Seit drei Jahrhunderten nehmen die Altgläubigen Russlands ein mühseliges und entbehrungsreiches Leben in der freiwilligen Verbannung Sibiriens auf sich – aus Liebe zu Gott. Jahrhundertlange Verfolgungen zwangen sie, sich immer tiefer in die Abgeschiedenheit zurückzuziehen, in der Wildnis zu überleben, von niemandem abhängig zu sein. Während die Gruppe der priesterlichen Altgläubigen ein Minimum an Zivilisation zum Überleben in der Wildnis der Sibirischen Taiga bejaht, lehnen viele Priesterlose jede Art von Fortschritt ab. Fotografiert und gefilmt zu werden, gilt als Sünde. Zwei Jahre Recherche und viel Überredungskunst waren nötig, um die Leute zu überzeugen, die Dreharbeiten zu diesem Film zuzulassen. (Text: BR Fernsehen) Rund um den Olymp – Griechenlands göttliche Mitte
45 Min.Die heiligen Klöster von Meteora.Bild: NDR/Carin Günther / ZDF und NDR/Carin GüntherDer Olymp ist mit 2.918 Metern das höchste Gebirge Griechenlands, in der griechischen Mythologie Sitz des Zeus sowie seiner illustren Götterschar. Nicht weit davon entfernt liegt die Pilion-Halbinsel mit Platanenwäldern, Olivenhainen, alten Bergdörfern und Traumbuchten. Getoppt wird diese Schönheit wohl nur von den weltberühmten Meteora-Klöstern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Die heiligen Stätten sind auf spitzen Felsen errichtet. Maria Zolota und ihr Mann Dionisis sind die Wirtsleute der Schutzhütte Spilios Agapitos, die auf 2.060 Metern Höhe auf dem Olymp liegt. Über 10.000 Gäste übernachten hier pro Saison, da ist Organisationstalent und Fleiß gefragt.Das Wasser kommt über eine Leitung aus den Bergen zur Hütte: Schmelzwasser. Marias Vater hat die Leitung einst gebaut, Dionisis kontrolliert sie täglich und prüft, ob das Eis noch reicht. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln muss organisiert werden, denn eine Materialseilbahn oder Zubringerstraße gibt es nicht. Dafür aber Takis und seinen Muli-Express. Wobei der Begriff Express etwas irreführend ist. Knapp drei Stunden braucht Takis für den steilen Weg zur Hütte, vorausgesetzt, das Wetter ist mild. Denn wenn es regnet, wird die Strecke zur Rutschpartie. Panajotis Paschos und seine Freundin Litsa sind Trüffeljäger. Mit ihren Hündinnen Dorita und Maja sind sie im Wald von Kalambaka auf der Suche nach dem „schwarzen Gold“. Im Auftrag eines Restaurantbesitzers wollen sie 300 Gramm Trüffel finden, rund 400 Euro bekommen sie pro Kilogramm. Ein guter Preis, der steigt, je weniger Trüffel es in der Saison gibt. Panajotis hat die Labradorhündinnen schon als Welpen trainiert, hat Stunde um Stunde Trüffel im Haus versteckt und die Hunde suchen lassen. „Sie stehen über meiner Freundin Litsa“, sagt Panajotis lachend. Deren Nase kann eben keine 200 Meter weit Trüffel erschnüffeln und darüber entscheiden, ob er heute ein Geschäft machen wird oder nicht. Ein knallrotes Stück Tradition bewahren Pavlos und Ilias Kogias in ihrer Schusterei. Die Brüder fertigen Tsarouchi, traditionell griechische rote Mokassins mit schwarzem Riesenbommel. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das Schuhwerk in Griechenland weit verbreitet. Heute werden die Mokassins nur noch von wenigen Griechen, dafür aber äußerst prominenten, getragen: den Palastwachen von Athen. In der Sohle stecken rund 50 Nägel, das soll Gegner beeindrucken und ihnen Angst einflößen. (Text: NDR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.