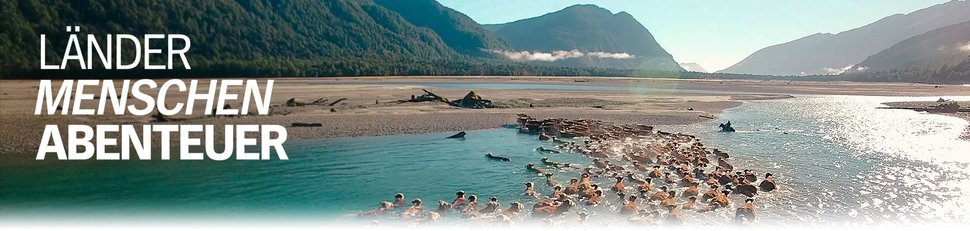1783 Folgen erfasst, Seite 27
Im Bann der Pferde – Argentinien
Gauchos und ihre Pferde – seit Jahrhunderten sind sie die Helden der Pampa und das Symbol für Freiheit. In den Weiten der argentinischen Grassteppen gibt es sie auch heute noch: Männer, die 60 Stunden in der Woche im Sattel sitzen, denn viele Ecken und Winkel der Estancias sind nur zu Pferd erreichbar. Der kleine Juan ist mit sechs Jahren der jüngste Reiter auf San Juan Poriahu, einem Landgut mit 4.000 Rindern und über 300 Pferden. Das Leben von Polospieler und Pferdezüchter José Lartirigoyen ist mit dem der Gauchos kaum vergleichbar. Polo ist Nationalsport, aber auch knallhartes Geschäft. In einer Wellblechhütte am Stadtrand von La Plata leben Pitu und Marina mit fünf Kindern und der Stute Negra.Ohne Negra könnte die Familie nicht überleben. Jeden Abend schleppt sie nach Hause, was andere wegwerfen. Negra gehört zu den Pferden der Karton- und Müllsammler, der Cartoneros. Rund 800 Pferde, Ponys und Maultiere bilden die Existenzgrundlage des gesamten Viertels. Tierärztin Doctora Oliva lehrt eigentlich an der Veterinärfakultät, aber seit fünf Jahren sind Cartonero-Pferde ihr ganzer Lebensinhalt. „Con alma por los caballos“, mit Seele für die Pferde, nennt sie ihre Kampagne. Einmal wöchentlich kümmert sich Dr. Dolores Oliva um die durch Stöße, Schläge oder falsches Anschirren verletzten Tiere. (Text: BR Fernsehen) Im Bann der Pferde – Indien
Maharaja-Paläste, Tempel und Zitadellen, Frauen in bunten Saris und Männer mit leuchtenden Turbanen – das Land der Rajas, der Königssöhne, weckt Phantasien aus tausendundeiner Nacht. Reger Handel und kriegerische Ereignisse in der Vergangenheit haben in der Region eine einzigartige Pferdekultur entstehen lassen: Marwaris – die stolzen Pferde der indischen Rajas. Jedes Jahr im November verwandelt sich die kleine, karge Wüstenoase Pushkar zum Pilgerort für Millionen Inder. Auf der Pushkar Mela, dem turbulenten Markt für über 50 000 Pferde und Kamele trifft sich, was in Rajasthans Pferdewelt Rang und Namen hat: Maharajas, Züchter und Pferdemeister. Pushkar ist der Ort, wo sie ihre Geschäfte mit den legendären Marwaris machen. (Text: ARD-alpha)Im Bann der Pferde – Island
Islandpferde gelten als die spritzigsten und zugleich ausdauerndsten Pferde in ganz Europa. Von Beginn der Kolonisierung an waren die Isländer derart eng mit ihren Pferden verbunden wie sonst nur die Reitervölker Zentralasiens. Und bis heute hegen die Isländer eine ganz besondere Liebe zu ihren Pferden. Island: Die weltweit größte Vulkaninsel ist bekannt für ihre grandiose Landschaft, für ihre Geysire und Gletscher. Noch berühmter ist sie für ihre Pferde. Islandpferde gelten als die spritzigsten und zugleich ausdauerndsten in ganz Europa. In stürmischem Stakkato galoppieren sie über Mooskissen und Lavagestein.Unerschrocken ziehen sie durch Flüsse, über Gletscher und Geröllfelder. In der nordischen Mythologie kommen die Rösser gleich nach den Recken. Was wäre Siegfried ohne sein Pferd Grani, was Odin ohne Sleipnir. Selbst die Sonne käme nicht vom Fleck, zögen nicht „Frühwach“ und „Allgeschwind“ ihren Wagen. Von Beginn der Kolonisierung an waren die Isländer derart eng mit ihren Pferden verbunden wie sonst nur die Reitervölker Zentralasiens. Und bis heute ist sie geblieben: die besondere Liebe der Isländer zu ihren Pferden. (Text: BR Fernsehen) Im Bann der Pferde – Marokko
Das große Fantasia-Reiterspiel findet zu Ehren des Propheten Mohammed an dessen Geburtstag in der alten Königsstadt Meknes statt. Das Reiterfest wird von dem Volksstamm der Atlas-Berber ausgerichtet, und das prachtvolle und archaische Spektakel dient allein zu Ehren des Propheten sowie der eigenen. Oft ist allein schon die Anreise voller Entbehrungen wie bei den beiden Protagonisten des Films, dem Berber Lachsen Slimani und seinem Sohn Mohammed. Fantasias sind Reiterspiele, die unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gefeiert werden.Einmal jährlich verwandelt sich die Königsstadt Meknes in ein orientalisches Feldlager. Der Turnierplatz direkt vor der Stadtmauer wird von großen Mannschaftszelten flankiert. Rund 2.000 Schaulustige säumen den Platz. Zum großen Fantasia-Reiterspiel werden mehr als 500 Teilnehmer erwartet. Mit den Fantasias halten die Berber eine mehr 2.000-jährige Kampftradition aufrecht. In vollem Ornat ziehen sie auf ihren mit Gold und Pailletten geschmückten Pferden zum Start. Auch der 56-jährige Berber Lachsen Slimani ist besessen von den Reiterspielen. Er ist Anführer einer Fantasiagruppe und lebt mit seiner Familie auf einem abgelegenen Hochplateau im Mittleren Atlas. Lachsen ist stolz, weil auch sein 18-jähriger Sohn Mohammed ein begeisterter Reiter ist und in die Fußstapfen seines Vaters treten will. „Im Bann der Pferde“ führt mit eindrucksvollen Bildern in die Welt der Fantasias. Porträtiert wird das Leben der Berberfamilie Slimani, die zwei Pferde besitzt: ein Arbeitspferd und einen Fantasia-Hengst. Er ist der ganze Stolz der Familie. Mohammed will unbedingt mit seinem Vater auf einer Fantasia reiten. Dazu benötigt er ein eigenes Reittier. So verlangt es die Tradition. Lachsen will seinem Sohn diesen Traum erfüllen. Um das nötige Geld aufzutreiben, wagt er ein Abenteuer. Regisseurin Lisa Eder begleitet Lachsen mit ihrem Team auf dem Weg durch die Gebirgslandschaft des Mittleren Atlas bis an den Rand der Wüste. Nur dort kann es Lachsen gelingen, sich und seinem Sohn den Traum von einer gemeinsamen Fantasia in der Königsstadt Meknes zu erfüllen … (Text: BR Fernsehen) Im Bann des Polarlichts
Im Winterhalbjahr flimmert das Polarlicht Aurora Borealis nachts über den Horizont. Sonnenstürme schicken ihre Energie auf die Erde, so entsteht das faszinierende Phänomen. Hoch im Norden Europas zieht das Naturschauspiel die Menschen seit Jahrtausenden in seinen Bann. Die Ureinwohner, die Sami, hielten das Nordlicht für ein schlechtes Zeichen. In ihren Zelten wurde nur leise geredet, wenn das Polarlicht zu sehen war. Bis heute hält sich die Sitte unter den Sami, über das Polarlicht erst zu sprechen, wenn es dunkel geworden ist.Chad Blakely dagegen kann den ganzen Tag lang vom Nordlicht erzählen. Der US-Amerikaner ist vor ein paar Jahren nach Abisko gekommen, einem kleinen Ort kurz vor der schwedisch-norwegischen Grenze an der Erzbahntrasse von Kiruna nach Narvik. Durch Zufall entdeckte er, dass die Menschen aus südlicheren Regionen der Erde geradezu süchtig nach den bizarren Lichterscheinungen sind. Seitdem veranstaltet er Fotokurse für Polarlicht-Touristen, die inzwischen zu Tausenden in jedem Winter nach Abisko kommen. Vor allem aus Asien. Sie reisen aus China bis nach Lappland, lassen sich von Temperaturen bis minus 30 Grad nicht abschrecken und hoffen, dass sie Aurora Borealis einmal selbst erleben können. Abisko gilt inzwischen als Mekka des Polarlicht-Tourismus. Das Mikroklima und die dunklen Nächte rund um die 80-Einwohner-Gemeinde sorgen dafür, dass man das Nordlicht hier so gut erleben kann wie sonst kaum irgendwo auf der Welt. Aber das Polarlicht birgt auch Gefahren für die einzigartige Natur in Lappland. Forscher Urban Brandström sorgt sich über die Auswirkungen, die die vielen Touristen auf das einsame Lappland haben könnten. Bisher versuchen sie in Abisko, das große Interesse am Polarlicht nicht zum Massentourismus verkommen zu lassen. Aber das gute Geschäft will sich auch niemand entgehen lassen. Denn den Trip hinter den Polarkreis lassen sich die Reisenden eine Menge Geld kosten. Jack Hong aus Schanghai ist für vier Tage nach Abisko gekommen. Er ist extra aus den USA angereist, wo er gerade studiert. In Asien erzählt man sich viele Geschichten über das Polarlicht. Es soll Glück bringen, jungen Paaren, die sich Kinder wünschen, genauso wie Alleinreisenden auf Partnersuche. Ob der Single Jack aus diesem Grund hergekommen ist oder ob es „nur“ das Interesse am Fotografieren des Himmelsphänomens ist, will er nicht verraten. Urban Brändström sind die Wünsche und Träume der Touristen ganz gleich. Der Forscher vom Institut für Weltraumphysik ist dem Polar- oder Nordlicht aus anderen Gründen auf der Spur. Er forscht leidenschaftlich nach den Ursachen der Stürme auf der Sonne. Denn sie haben große Auswirkungen auf die Erde. Nicht nur, dass sie das Polarlicht hervorrufen, sondern sie verändern auch das Magnetfeld der Erde. In den USA habe es schon Stromausfälle gegeben, weil die Stürme auf der Sonne so viel Energie freigesetzt hätten, berichtet Urban Brandström. Deshalb ist es wichtig, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Und in seinem Labor in Kiruna ist der richtige Platz dafür. Er arbeitet eng zusammen mit der Weltraumforschungsstation Esrange in Nordschweden, ein wichtiger Raketenstart steht kurz bevor. (Text: SWR) Im Bann des Voodoo
Deutsche TV-Premiere Mi. 25.04.2001 Südwest Fernsehen von Marcel BauerIm Bas Languedoc
Der Bas Languedoc oder Languedoc Méditerranée erstreckt sich ungefähr in vierzig Kilometer Breite entlang des Mittelmeeres, mit Montpellier als Hauptstadt. Im Norden stößt er an die südlichen Cevennen, dann kommen hohe Macchia und bis zum Meer sandige Flächen mit Weinbergen und Tümpeln. Nur bei Montpellier erhebt sich das kleine Gariole-Gebirge, bei Sète der Berg St. Clair. Kleine Landzungen haben sich hier und da vor die Küste geschoben. Dadurch sind kleine Binnenmeere entstanden, wo vor allem Austern und Muscheln gezüchtet werden. Der Film von Vera Botterbusch zeigt diese Vielfalt von Landesinnerem und Küstenstreifen, die gewachsene Kultur – zu der Namen wie Georges Brassens und Paul Valéry gehören – und neuere Entwicklungen, die mit Retortendörfern wie La Grande Motte in den siebziger Jahren eingeleitet wurden.Der Dichter Jean Joubert, der hier seine Wahlheimat fand und sie in seinen Romanen und Gedichten thematisiert, erzählt vom Wesen dieser mediterranen Landschaft, wo sich Spuren der Antike mit der romantischen Kunst vermischen und die Lebensart des Midi mit Boulespiel und Fischfang der heutigen Zeit standzuhalten versucht. (Text: hr-fernsehen) Im Doppeldecker um die Ostsee (1): Skandinavien
Jugendtraum oder Schnapsidee: Zwei Piloten und ein Navigator ziehen aus, um die Ostsee aus der Luft zu entdecken. Im Sichtflug, im offenen Cockpit riskieren sie Kopf und Kragen, erkunden Land und Leute und vermitteln eine ungewöhnliche Perspektive auf Deutschlands nordische Nachbarländer. Die Küsten der Ostsee zeigen sich in vielfältiger Weise: Kalksteinfelsen, Schärenlabyrinthe und weite Sandstrände. Die Sicherheitsregeln müssen bei diesem Flug von Anfang an missachtet werden, denn es bieten sich keine Notlandeplätze bei den weiten Wasserüberquerungen, dichten Waldüberflügen und auf karstigen Steininseln.Die Piloten sind auf sich und die Ausdauer ihrer Maschinen gestellt. Gut drei Wochen lang umfliegt die Mannschaft die Ostsee und kämpft nicht nur mit den Tücken der Technik. Über dem Baltikum ziehen dunkle Wolken auf und verzögern die Weiterreise. Die beiden Flugzeuge werden von einer 50 Jahre alten Dornier 27 begleitet. Der zweiteilige Film folgt dem Reiseverlauf von Usedom aus über Dänemark, Schweden, Finnland ins Baltikum und zurück nach Deutschland. (Text: NDR) Im Doppeldecker um die Ostsee (2): Baltikum
Jugendtraum oder Schnapsidee: Zwei Piloten und ein Navigator ziehen aus, um die Ostsee aus der Luft zu entdecken. Im Sichtflug, im offenen Cockpit, riskieren sie Kopf und Kragen, erkunden Land und Leute und vermitteln eine ungewöhnliche Perspektive auf die Küsten der Ostsee: Kalksteinfelsen, Schärenlabyrinthe und weite Sandstrände. Die Sicherheitsregeln müssen bei diesem Flug von Anfang an missachtet werden, denn es bieten sich keine Notlandeplätze bei den weiten Wasserüberquerungen, dichten Waldüberflügen und auf karstigen Steininseln. Die Piloten sind auf sich und die Ausdauer ihrer Maschinen gestellt. Gut drei Wochen lang umfliegt die Mannschaft die Ostsee und kämpft nicht nur mit den Tücken der Technik. Über dem Baltikum ziehen dunkle Wolken auf und verzögern die Weiterreise. Die beiden Flugzeuge werden von einer 50 Jahre alten Dornier 27 begleitet. Der zweiteilige Film folgt dem Reiseverlauf von Usedom aus über Dänemark, Schweden, Finnland ins Baltikum und zurück nach Deutschland. (Text: BR Fernsehen)Im Doppeldecker um die Ostsee – Baltikum
Zwei Piloten und ein Navigator sind im Doppeldecker unterwegs, um die Ostsee aus der Luft zu entdecken: eine ungewöhnliche Perspektive auf Deutschlands nordische Nachbarländer. Jugendtraum oder Schnapsidee: Zwei Piloten und ein Navigator ziehen aus, um die Ostsee aus der Luft zu entdecken. Im Sichtflug, im offenen Cockpit, riskieren sie Kopf und Kragen, erkunden Land und Leute und vermitteln eine ungewöhnliche Perspektive auf die Küsten der Ostsee: Kalksteinfelsen, Schärenlabyrinthe und weite Sandstrände. Die Sicherheitsregeln müssen bei diesem Flug von Anfang an missachtet werden, denn es bieten sich keine Notlandeplätze bei den weiten Wasserüberquerungen, dichten Waldüberflügen und auf karstigen Steininseln.Die Piloten sind auf sich und die Ausdauer ihrer Maschinen gestellt. Gut drei Wochen lang umfliegt die Mannschaft die Ostsee und kämpft nicht nur mit den Tücken der Technik. Über dem Baltikum ziehen dunkle Wolken auf und verzögern die Weiterreise. Die beiden Flugzeuge werden von einer 50 Jahre alten Dornier 27 begleitet. Der zweiteilige Film folgt dem Reiseverlauf von Usedom aus über Dänemark, Schweden, Finnland ins Baltikum und zurück nach Deutschland. (Text: BR) Im Etosha-Nationalpark – Leben und Arbeiten in Namibia
Der Etosha-Nationalpark im Norden Namibias zieht Touristen aus aller Welt an. Bereits vor 110 Jahren gegründet, gehört er zu den ältesten Nationalparks der Erde. Ein Filmteam begleitet den Tierarzt Mark Jago und eine Gruppe von Rangern bei ihren Einsätzen im unwegsamen Gelände. Mark Jago fährt seit Wochen durch den Busch. Im Mai, wenn die Regenzeit zu Ende ist, laufen in Namibia die Fangaktionen für Wildtiere auf Hochtouren. Denn nur so lassen sich auf Dauer gesunde Tierbestände gewährleisten. Der 49-jährige Brite ist der Tierarzt von Etosha. Der Nationalpark im Norden Namibias zieht Touristen aus aller Welt an.Gegründet wurde er vor 110 Jahren und gehört somit zu den ältesten Nationalparks der Erde. Doch Etosha ist beileibe keine heile Welt: Auch hier konkurrieren Löwen, Nashörner, Zebras, Elefanten und Giraffen mit den Menschen und ihrem Vieh um Land, Wasser und Nahrung. Immer wieder dringen Elefanten in angrenzende Farmen ein und zerstören einen Teil der Ernte. Löwen reißen Rinder. Umgekehrt machen Viehherden den Wildtieren Wasser und Futter streitig. Umso wichtiger ist es, die Anwohner ins Management des Parks einzubeziehen. Gemeinsam mit 20 Rangern kämpft Mark Jago sich im Jeep durch das Dornengestrüpp. Endlich haben sie die Herde Giraffen gesichtet, die umgesiedelt werden soll. Nun wechselt Jago in den Hubschrauber und schießt schließlich vom Hubschrauber aus mit dem Betäubungsgewehr auf die Giraffen. Später werden sie in einer anderen Zone des Parks wieder ausgesetzt. „Mit solchen Aktionen wollen wir die genetische Vielfalt erhalten“, erklärt Jago. Der Erfolg gibt den Verantwortlichen recht: Namibia kann sich seiner Vorreiterrolle beim Tier- und Naturschutz in ganz Afrika rühmen. Der Bestand vom Aussterben bedrohter Arten wie etwa dem Breitmaulnashorn ist seit Jahren stabil. Die Wilderei wurde erfolgreich eingedämmt. Ein Filmteam begleitet Mark Jago und eine Gruppe von Rangern bei ihren halsbrecherischen Einsätzen im unwegsamen Gelände. Dokumentiert wird auch die Aufklärungsarbeit der Wildhüter, etwa bei den Himba, die als Halbnomaden im Hinterland des Parks leben, bis hinauf an die Grenze zu Angola. Station wurde auch bei den San gemacht, das kleine Volk der Buschleute hat Jahrtausende in den Wüsten und Steppen des südlichen Afrika überlebt. (Text: BR Fernsehen) Im Herzen Afrikas – Der Boubandjida Park in Kamerun
Im Norden von Kamerun erstreckt sich über eine Fläche von 2.200 Quadratkilometern der Boubandjida Nationalpark, eines der artenreichsten Schutzgebiete der Welt und zugleich Heimat der größten Elefantenpopulation im zentralen Afrika. In der von zahlreichen Wasserläufen durchzogenen Buschsavanne gibt es außerdem seltene Antilopen, Raubtiere wie Panther und Löwen und unzählige Vogelarten. Der Film begleitet den Franzosen Paul Bour, der sich einen Kindheitstraum erfüllt hat und seit mehr als fünf Jahren als Berater im Boubandjida Park tätig ist. Gemeinsam mit seinem kamerunischen Kollegen Alexandre Vailia N’Gertou kämpft er für die Erhaltung dieses beeindruckenden Naturreservoirs und vermittelt, wenn es um Konflikte zwischen Naturschutz und den Interessen der Bevölkerung geht.Denn es gibt Hirten, die ihre Rinder weiden lassen wollen, Bauern, die Ackerfläche benötigen, um ihre Familien zu ernähren, und Brandrodung betreiben, und es gibt das Problem der Wilderei. Dabei ist es nicht immer einfach, die Bewohner der an den Park angrenzenden Dörfer vom Nutzen des Naturschutzes gegenüber ihren eigenen gewachsenen Traditionen zu überzeugen. Dennoch trägt die Arbeit der Parkschützer ihre Früchte – inzwischen sogar über die Grenzen des Kameruns hinweg. Im angrenzenden Tschad kämpft ein Verbündeter für die Errichtung eines Naturreservats nach dem Vorbild Boubandjidas : Dorfchef Paul Tao hat es geschafft, die eigene Bevölkerung von nachhaltiger Landwirtschaft zu überzeugen und seine Regierung von einem ambitionierten Plan: Auch der Tschad soll in der Grenzregion einen Nationalpark bekommen – den Séna-Oura Park. Das Besondere an diesem Projekt ist die geplante Zusammenlegung mit dem Boubandjida Park auf der kamerunesischen Seite. Der Film lässt die Zuschauer Zeuge der ersten Schritte eines ambitionierten länderüberschreitenden Projektes in Zentralafrika werden. (Text: SWR) Im Herzen Balis – Tempel, Tropen, Traditionen
45 Min.Bali ist bekannt für Traumstrände, doch das Herz der indonesischen Insel offenbart sich in ihrem grünen Inneren: tropischer Regenwald, imposante Tempelanlagen, Reisterrassen, eine einzigartige hinduistische Kultur und aktive Vulkane. Zusammen mit seinen freundlichen Einwohnerinnen und Einwohner eine Mischung mit ganz eigener Magie. Bali ist die Insel der Götter und Rituale. Galungan ist das bedeutendste religiöse Fest im 210 Tage umfassenden balinesischen Kalender. Dann wird der Sieg des Guten über das Böse gefeiert.In prächtigen Prozessionen ziehen die Menschen durch die Straßen, die traditionell von Penjors gesäumt sind. Das sind lange, gebogene Bambusstangen, an deren Ende Opfergaben hängen und die den heiligen Berg Agung symbolisieren. Das Filmteam folgt Erna und ihrer typischen Großfamilie durch die farbenfrohen Feiertage. Opfergaben müssen vorbereitet, der traditionelle Tanz geprobt und die Festtagskleidung zusammengesucht werden. Auch die Ahnen kehren in dieser Zeit zurück, um die Menschen zu segnen. Doch es gibt auch böse Geister. Um deren schädlichem Wirken zu entgehen, besuchen Balinesen traditionelle Heiler genauso selbstverständlich wie Ärzte. Wo die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt, können die magischen Kräfte der Heiler, Beschwörungsformeln und Räucherwerk Abhilfe schaffen, so sind sich die Patienten von Heiler Jro Putu Arnawa sicher. Balis moderne Seite zeigt sich rund um die Stadt Ubud, wo ein Zentrum der Bambusarchitektur entstanden ist. Der Architekt Ewe Yin Low will die Einheimischen wieder für das traditionelle Baumaterial begeistern. Und das internationale Team von Pablo Luna erforscht sein Potenzial für modernes Bauen. Die Wiederentdeckung des nachhaltigen Werkstoffes könnte wegweisend für die Zukunft sein: schnell nachwachsend, lokal verfügbar, mit guten klimatischen Eigenschaften. Gleichzeitig hat Bambus ideale Eigenschaften als Baustoff für wahre Meisterwerke der Architektur. Die windige Jahreszeit wird von Kitefestivals geprägt. Traditionell war das Drachensteigen ein Erntefest, heutzutage treten Kitegruppen bei Wettbewerben gegeneinander an. Inzwischen haben sich die Festivals zu einer Mischung aus Traditionsveranstaltung und internationalem Sportereignis entwickelt. Höhepunkt ist ein großes Drachenevent am Strand von Sanur. Obwohl sie früher überall auf der Insel heimisch waren, sind die Bali-Stare fast ausgestorben. Die Begawan Foundation will die Tiere mithilfe von Vogelpaten in den Dörfern wiederansiedeln und Wilderei verhindern. Einige Brutpaare gibt es bereits wieder, nun sind die nächsten Jungvögel so weit. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 10.11.2022 NDR Im Herzen Österreichs – Ein Sommer in den Bergen
45 Min.Insgesamt 695 Dreitausendergipfel gibt es in Deutschlands Nachbarland Österreich, so der Österreichische Alpenverein. In der Welt voll steinerner Giganten ist der Großglockner mit 3.798 Metern der höchste Berg und das Wahrzeichen Österreichs. Wer in den Bergen des Nationalparks Hohe Tauern lebt, braucht Kraft und Gelassenheit. Denn die Natur gibt den Takt des Lebens vor. Da kann es auch vorkommen, dass es im August plötzlich schneit. Helga Pratl ist Hüttenwirtin. Die Salmhütte liegt unterhalb des Großglockners auf 2.644 Metern.Drei Monate im Jahr bewirtschaftet die gelernte Köchin Helga Pratl das Haus, in das während der Saison rund 1.500 Übernachtungsgäste und 250 Tagesgäste einkehren. Eine Materialseilbahn, die Lebensmittel zur Salmhütte bringt, gibt es nicht. Einmal in der Saison kommen Material und Trockenprodukte per Helikopter. Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse schleppen die 54-jährige Helga und ihre Mitarbeiter jede Woche zu Fuß nach oben. Ein harter Job. Aber Helga findet es dort oben so schön und fit bleibt man noch dazu. Auf der Grieswiesalm im Raurisertal findet jedes Jahr ein Kampf unter Hengsten statt. Zehn Pferde kämpfen in einer Arena um die Position des Leithengstes. Der wird später die Gruppe anführen, wenn die Tiere den Sommer auf der Alm verbringen. Georg Lechner ist mit seinem dreijährigen Hengst Kratos das erste Mal dabei. Beißen, treten und boxen: alles an Machtdemonstration ist erlaubt. Was für die Menschen rau und brutal aussieht, ist für die Tiere ein überlebenswichtiges Ritual. Und es gibt eine Überraschung: Nicht der Stärkste macht das Rennen! Anders ist das beim Ranggeln. Diese Art Ringkampf ist Brauchtum in Österreich und eine letzte Männerbastion. Schon die Ritter haben ihn betrieben, um sich auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten. Später ging es darum, dem Kräftemessen einen Rahmen zu geben. Hermann Höllwart ist einer der besten Ranggler in Österreich. Die Technik hat sich der 30-Jährige von seinem Opa abgeguckt, den er zusammen mit seinen Rangglerfreunden besucht. Im Sommer lebt der über 90-jährige Hans Höllwart mit seiner Frau in einer einsamen Hütte auf einer Alm im Raurisertal. Da kommt ihm jede Abwechslung recht. In Armschlag in Niederösterreich kann man den Zauber des Mohns erleben. Das Dorf mit seinen 87 Bewohnern ist das Mohndorf Österreichs. Dort wird alles aus Graumohn produziert: Mohnöl, -honig, -schnaps. Sogar Handcreme aus Mohn gibt es. Früher war der Ort ein verlassenes Kaff ohne Perspektive. Heute leben viele dort vom Mohn und seiner Vermarktung. Auch Markus Weinmann und seine Familie. „Die schönste Saison ist die Blüte des Mohns“, schwärmt er. Doch die Saison ist kurz. Jede Blüte ist nur einen einzigen Tag geöffnet. Gerade einmal zwei bis drei Wochen im Jahr kann man den Zauber der Mohnblüte bewundern. In Gaflenz hat eine Gruppe Mädels eine alte Tradition auf den Kopf gestellt. Sie „platteln“, wie es dort heißt. Natürlich in Lederhosen. Dabei war das früher den Männern vorbehalten, die damit die Mädels beeindrucken wollten. Das hat auch in Gaflenz funktioniert, nur fanden die Mädchen es so gut, dass sie sich das Platteln selbst beigebracht haben und jetzt selber damit auftreten. Zur Resonanz bei den Männern sagt die 20-jährige Stephanie Riegler: „Ein Großteil war begeistert, aber es gab auch einen Teil, der gesagt hat, Mädchen und platteln, das passt nicht.“ Uneingeschränkter Zuspruch kommt von Spielmann Manuel Reitner: „Es ist einfach a Gaudi mit den Mädchen. Und es ist super, weil man der Hahn im Korb ist.“. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 25.04.2019 NDR Im Herzen Portugals – Mit dem Zug von der Küste in das Douro-Tal
45 Min.Schroffe Felsen, an denen die Brandung meterhoch peitscht. Surfparadiese an weißen Sandstränden. Steile Weinberge in malerischen Flusstälern. Dörfer mit jahrhundertealter Tradition. Mit dem Zug geht es von Portugals Westküste an die spanische Grenze im Nordosten, eine Entdeckungsreise geprägt von einer Vielzahl an Farben, Landschaften und Klimazonen. Entlang der Atlantikküste und zweier Bahnstrecken durchqueren die Autoren Maik Gizinski und Babette Hnup den Nordwesten und Zentralportugal: vom Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt des europäischen Festlands, bis hinauf in die Berge von Portugals einzigem Nationalpark, dem Peneda-Gerês.Vom quirligen Porto, der heimlichen Hauptstadt, bis hinüber an die spanische Grenze im Nordosten. Der Zug führt vom blauen Meer ins grüne Douro-Tal, von der urbanen Großstadt bis in die sengende Hitze des verlassenen Hinterlandes. In einer perfekt arrangierten Hügellandschaft liegt Sintra. Das Dorf diente lange als Sommerresidenz der Könige, die das kühle Klima den heißen Temperaturen in Lissabon vorzogen. Und was im Prinzip auf jeden, der hier lebt, zutrifft, gilt für Maria und Tomé Marmelo umso mehr: Sie wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Denn ihr Haus, besser gesagt: ihr Palast, steht nicht irgendwo, sondern mitten in Quinta da Regaleira, einem herrschaftlichen Ensemble aus prachtvollen Bauwerken und verwunschenem Park, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Maria und Tomé sind jedoch beileibe nicht reich oder royal: Sie sind hier die Hausmeister. Und damit die Einzigen, die hier 365 Tage im Jahr rund um die Uhr sein dürfen. Von hier aus beginnt die Zugfahrt vorbei an Palästen und Pinienwäldern in Richtung Praia de Espinho, einem weiten, windumtosten Strandabschnitt vor den Toren der Stadt Porto. Der raue Atlantik türmt hier beste Surfwellen auf. Ricardo Marquez weiß sie zu reiten. Surfen ist Ricardos große Leidenschaft, aber selbst hier an der Atlantikküste ist auf Wind nicht immer Verlass. Ricardo baut deshalb ganz besondere Surfboards: „Die Idee entstand am Strand, als ich den Horizont betrachtete und dachte: Die Wellen sind schlecht, aber ich will surfen. Das muss doch auch irgendwie auf der Straße, also ohne Wellen, gehen.“ Also entwickelte Ricardo ein Board, das sich anfühlt und dieselbe Technik wie ein Surfbrett erfordert, aber auf der Straße fährt. Auf einem seiner Boards nimmt Ricardo das Filmteam mit nach Porto, eine der schönsten Metropolen Europas. Dort trifft sich direkt am Konzerthaus Casa da Música, das vom Stararchitekten Rem Koolhaas entworfen wurde, nun die Szene zum Skaten, sorry: zum Surfen. Fin del Mundo (das Ende der Welt): So nannte man Portugal im Zeitalter der Entdeckungen. Und so fühlt es sich ganz oben im Norden an, im Nationalpark Peneda-Gerês. Mit seiner Randlage zum spanischen Karstgrenzgebirge ist der einige Nationalpark Portugals schon von Natur aus eine wenig berührte Region. Victor Afonso hatte früher ein Café in Paris. Nun führt er tagtäglich 250 Ziegen auf die Alm, jeden Morgen hin, spät am Nachmittag wieder zurück. Es ist ein straffer Tag, der nur auf den ersten Blick Romantik verspricht. Victor betreibt seine Farm gemeinsam mit seinem Sohn Ricardo, der auch schon woanders gelebt hat, in den USA und Kanada. Doch auch Ricardo ist hierher zurückgekehrt und heute einer von vielleicht 15 Menschen in der gesamten Region, die jünger als 30 Jahre alt sind. Seine Freunde von früher sind längst aus Peneda weggezogen. Das Dorf stirbt aus. Wie so viele in den ländlichen Regionen Portugals. Die Reise geht nun mit der Linha do Douro nach Osten. Ursprünglich wurde die Bahnlinie gebaut, um Wein aus dem Douro-Tal zu den Portweinkellereien zu schaffen. Heute ist die Strecke berühmt für ihre atemberaubende Aussicht auf den Fluss. Und an den Hängen des Douro, der sich aus den Bergen bis zum Meer schlängelt, reifen nicht nur Trauben für die berühmten Portweine, sondern auch kleine Juwelen. Mit seiner Weinkellerei Quinta do Cume hat sich Jorge Tenreiro einen Traum erfüllt. Der Herzchirurg ist auf einem Weingut aufgewachsen. Als er 18 war, verkaufte sein Vater das Anwesen. Doch die Kindheitserinnerungen ließen Jorge nicht los. Deshalb investierten er und seine Frau Claudia in ein paar Hektar Land im Herzen des grünen Douro-Tals. Immer im September kommt die ganze Familie zur Weinernte. Auf der Bahnstrecke Linha do Douro hat Luís Patrício 31 Jahre lang gearbeitet. Er hat sozusagen seine Jugend dort verbracht. Noch heute ist die Linha do Douro die direkteste und schnellste Verbindung nach Spanien und Frankreich, theoretisch. Die Spanier haben den Grenzverkehr Mitte der 1980er-Jahre aus Rentabilitätsgründen gekappt und den Zugbetrieb von heute auf morgen eingestellt. Damals verschwand das quirlige Grenzörtchen Barca d’Alva vom Streckennetz und war, trotz hinreißender Grenzlage direkt am Douro, ziemlich von der Außenwelt abgeschnitten. Doch es regt sich Widerstand. Es gibt Forderungen, die Strecke müsse wieder eröffnet werden. „Das glaube ich erst, wenn ich den Zug sehe“, sagt Luís und blickt kopfschüttelnd über die Douro-Brücke gen Spanien. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere ungesendet Im Herzen Schottlands (1): Mit dem Zug durch die Lowlands
45 Min.Am Hauptbahnhof Edinburgh beginnt eine Zugreise in ein Land voller Farben und Gegensätze. Vorbei am weltberühmten Edinburgh Castle geht es nach Norden, über die imposante, knallrote Forth Bridge, 50 Meter hoch über dem blau schimmernden Meeresarm Firth of Forth.Der erste Teil dieser Reise mit dem Zug durch Schottland beginnt in der bunten, brodelnden Hauptstadt Edinburgh. Durch die sanften Hügelketten der schottischen Midlands geht es bis an die wilde, malerische Ostküste rund um Aberdeen. Entlang der Strecke warten Begegnungen mit den ganz eigenen, kantigen Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Gegend. Mit Menschen wie dem einzigen schottischen Schwertschlucker Steven Archibald, der beim weltgrößten Straßenkünstler-Festival Fringe in Edinburgh versucht, das Geld für einen Urlaub mit seinem Sohn zu verdienen. Früher war Steven Fabrikarbeiter, heute riskiert er Tag für Tag sein Leben, wenn er sich eine 30 Zentimeter lange Stahlklinge tief in den Rachen schiebt. Nur einen Steinwurf entfernt von der berühmten Royal Mile Edinburghs oben auf dem Burghügel hat Howard Nicholsby seinen Laden. Howard ist dort bekannt wie ein bunter Hund. Er haucht dem schottischen Nationalsymbol, Kilts, neues Leben ein. Er schneidert nicht die typisch karierten Billigröcke, mit denen Touristen sich verkleiden, sondern außergewöhnliche Modelle. In seiner Kollektion finden sich Kilts aus Materialien wie Baumwolle, Hanf, Plastik und Jeans. Ungewöhnlich, modern und sehr erfolgreich. Rockstars wie Lenny Kravitz, Robbie Williams und Schaupieler Vin Diesel tragen seine Stücke. „Ich selber habe seit 17 Jahren keine Hose mehr angezogen“, sagt er. Howard fährt mit dem Zug Richtung Norden zu seinem Vater Geoffrey. In dessen Kiltwerkstatt hat er das Handwerk damals erlernt. Doch nicht nur die Faszination für Schottenröcke haben sie gemeinsam, es gibt ein noch viel größeres Projekt: Vor 30 Jahren hat die Familie eine Schlossruine gekauft. „Das Schloss wieder aufzubauen, ist so ein bisschen auch mein Traum geworden.“ Es dürfte, vorsichtig geschätzt, noch ein paar Jahre dauern. Wer im Zug aus dem Fenster schaut, sieht nicht nur malerische Buchten und dramatisch anmutende Landschaften, sondern immer wieder auch Golfplätze. Über 550 gibt es davon im Land, Schottland ist die Geburtsstätte des Golfs. Hier trainiert die 20-jährige Ellie Docherty, um den sehr männlich dominierten Nationalsport aufzumischen. Sie will Profisportlerin werden. Die Leidenschaft dafür hat sie von ihrem Großvater geerbt. Er war selbst Profi und ist seit über 70 Jahren auf den schottischen Greens zu Hause. Heute ist er Ellies größter Fan. Weiter im Osten, am äußersten Ende des Firth of Forth, liegt das beschauliche Örtchen St. Monans, ein kleines Fischerdorf mit einem hinreißend schönen Leuchtturm. Hier residiert die dienstälteste Küstenwache Schottlands. Und es dürfte die einzige sein, die kein eigenes Rettungsboot hat. Doch Küstenwächterin Anne, agil, Mitte 70 und so ruhig und gleichmütig, wie nur jemand sein kann, der mit allen Küstenwassern gewaschen ist, schiebt das Problem schmunzelnd beiseite. „Wenn jemand in Seenot gerät, rufen wir die Küstenwache in Aberdeen an. Und die schicken dann ein Rettungsschiff.“ Mit einer Tasse Tee setzt sie sich vor den Leuchtturm und genießt die Aussicht über die felsige, raue Küste. Auf dem Bahnhof in Perth wartet Calum Richardson auf seinen Zug nach Hause an die Ostküste. Calums kleiner, aber legendärer Fish-and-Chips-Laden The Bay in Stonehaven gilt als bester in ganz Großbritannien. Das will was heißen, denn Fish and Chips ist britisches Nationalgericht. Entsprechend ist die Menschenschlange vor seinem winzigen Laden manchmal über 100 Meter lang. Seinen Fisch bekommt Calum von der Familiendynastie Couper aus Aberdeen. Dort wird mittlerweile in dritter Generation Fisch filetiert, von Hand wohlgemerkt. Jamie Couper ist Mitte 30 und leitet jetzt den Betrieb im Aberdeener Stadtteil Torry. Sein Vater Danny steht seit nunmehr 40 Jahren jeden Morgen um 5:30 Uhr in einer riesigen Fischauktionshalle in Peterhead, 50 Kilometer weiter nördlich, und ersteigert die Ware. Um acht Uhr hat er schon 9.000 Euro für frisch gefangenen Fisch ausgegeben, aber beste Laune: „Das macht Spaß! Und heute habe ich einige gute Deals gemacht!“ In der „Silver City“ wie das nahezu vollends aus silbergrauem Granit erbaute Aberdeen genannt wird, endet der erste Teil einer Zugreise durch das Herz Schottlands. Die Kameraarbeit von Sebastian Wagner für diese Dokumentation wurde mit dem Columbus-Filmpreis ausgezeichnet. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.08.2020 NDR Im Herzen Schottlands (2): Mit dem Zug durch die Highlands
45 Min.In den Schottischen Highlands warten hinter jeder Kurve neue, traumhaft schöne Ausblicke: violett leuchtende heidebewachsene Hügel, malerische Seen und tiefgrüne Wälder.Im zweiten Teil der Reise durch Schottland geht es von Aberdeen weiter nach Norden zum Zielbahnhof Inverness. Immer entlang der legendären Highland-Main-Line-Zugstrecke, die mitten durch den Cairngorms National Park führt. Aber was wären diese noch immer weithin unberührten Flecken ohne die Menschen, die hier leben? Los geht es auf diesem Reiseabschnitt in der alten Königsstadt Stirling. Sie gilt als Nahtstelle zwischen den sanften Lowlands und den Highlands. 2009 ist Alan Waldron aus dem turbulenten Edinburgh hierher gezogen und hat sich hier einen Traum erfüllt. Was aussieht wie ein kleiner Tischlerbetrieb, ist doch viel mehr: Alan baut Dudelsäcke in Handarbeit, das Innenleder dafür stammt von einer ganz besonderen Schafrasse. Aber das Geheimnis verrät er nicht. Nächste Station: Aviemore, 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Edinburgh. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Hier lebt Walter Micklethwait, Inhaber einer der kleinsten Gin-Destillerien des Landes, die einer Filmkulisse ähnelt. In den umliegenden Wäldern erntet er im Herbst die Zutaten, die er für seinen selbstgebrannten Schnaps braucht: Wacholder und Hagebutten. Gin stand immer im Schatten des Whiskys, doch das ändert sich nun. Rund zwei Drittel des Gins im Vereinigten Königreichs kommt inzwischen aus Schottland. Der Inshriach Navy Strength tröpfelt mit 57 Volumenprozent Alkohol aus dem Messingboiler. Ein paar Kilometer brodeln in einem weitaus größeren Kessel 11.000 Liter Wasser und eineinhalb Tonnen Kohle. Das jagen Ken Plant und John Greig jeden Tag durch den Strathspey Dampfzug. Fast 70 Jahre alt und 210 Tonnen schwer, schlängelt er sich drei Mal am Tag durch die sanfte Flusslandschaft auf einem Gleisabschnitt, der sonst nicht mehr befahren wird. Die Leute in Braemar, 30 Kilometer Luftlinie von dort, können von Gleisen nur träumen. Simon Blackett erzählt eine tragische Geschichte von einem Zug, der niemals in ein Dorf kam, das sogar schon einen Bahnhof gebaut hatte. Mit diesem typisch trockenen Humor und ihrer heiteren Gelassenheit repräsentieren stolze Schotten ihr kleines und einzigartiges Land. Ein Abstecher von hier an die schottische Nordküste führt nach Sandend, der Heimat von Megan Mackay (21). Sie ist die erste Schottin, die einen internationalen Wettbewerb im Wellenreiten gewonnen hat. Schottland ist nicht gerade eines der bekannten Surfparadiese. Doch mit dickem Neoprenanzug kann man sich hier gut austoben. Abends trifft Megan sich mit ihren Freundinnen und Freunden am Strand und tanzt Ceilidh, den berühmten schottischen Volkstanz. Denn die Schotten hier tanzen gern, bei jeder Gelegenheit. Weiter nördlich, schon fast am Ziel, liegt die kleine Farm von Beth und Tim Rose. Die beiden ehemaligen Städter sind nun Crofter, also Landwirte. Sie haben einige Kühe und Schafe und bewirtschaften ihr Land. Da das Geld nicht reicht, muss Tim weiterhin regelmäßig auf Ölplattformen arbeiten. Währenddessen ist seine Frau Beth fünf Wochen lang mit den zwei Kleinkindern allein. Dabei ist sie nonstop damit beschäftigt, die Farm in Schuss zu halten und die Schafe, Kühe und die beiden Söhne zu versorgen. Nicht weit von der Rose-Farm liegt der sagenumwobene Loch Ness. Seebär Danny Coutts ist auf den zahlreichen Seen des Great Glenn zu Hause, seit er Kleinkind war. Mit ihm geht es auf einen Segeltrip bei überhaupt nicht typisch schottischem Wetter: sonnig, wolkenlos und windstill. Danny sehnt eine Brise herbei, aber seine Frau Maggieann schwärmt, dass man hier den Frieden und die Stille der Highlands genießen kann. Und Nessie, das Monster? „Mal sehen, ob wir es treffen“, schmunzelt Danny. Dann erreicht der Zug sein Ziel im Bahnhof von Inverness. Hier ist auch für Schaffnerin Jennifer Endstation. Sie ist auf allen Bahnstrecken Schottlands unterwegs, aber diese hier liebt sie besonders. Für sie sind die Highlands der schönste Ort auf der Welt, die Blicke einfach unvergleichlich. Die Kameraarbeit dieser Dokumentation von Sebastian Wagner wurde mit dem Columbus-Filmpreis ausgezeichnet. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 13.08.2020 NDR Im Kajak durchs Tor ohne Wiederkehr – Europas Grand Canyon: Die Verdon-Schlucht
Deutsche TV-Premiere Sa. 29.01.1983 S3 von Walter BittermannIm Kaukasus – Samuchas letzter Sommer
Noch gibt es in Georgien Hirten, die mit ihren riesigen Schafherden die Sommer in den Hochtälern des Kaukasus verbringen und im Winter hinab in die Täler ins Grenzgebiet zu Aserbaidschan ziehen. Einer von ihnen ist Samucha. Ein Mann wie aus einem amerikanischen Cowboy-Film: ein großartiger Reiter, Schafhirte, Musiker, Sänger und Geschichtenerzähler. Wenn der Herbst zu Ende geht, muss er die Weiden verlassen bevor der erste Schnee kommt. Dann macht er sich mit seinen Tieren auf den beschwerlichen Weg ins ferne Winterquartier. Sie müssen durch reißende Gebirgsflüsse und über Gebirgspässe bis sie die Ebene erreichen. Erst im nächsten Mai wird sich Samucha wieder auf den Weg zurück in die Berge machen und auch dann erst seine Frau wiedersehen. Ein Film über Männer und Frauen in einer einzigartigen Landschaft in dem kleinen Land Georgien – fast am Ende der Welt. (Text: BR Fernsehen)Im Kielwasser von Kolumbus
Deutsche TV-Premiere Mo. 10.10.1988 S3 von Heinz von MattheyIm Land der Gurus – Bilder einer Indienreise
Deutsche TV-Premiere Mi. 26.05.1999 Südwest Fernsehen von Ernst HunsickerIm Land der Haratin – Die schwarze Minderheit in Marokko
Deutsche TV-Premiere Mi. 20.02.2002 Südwest Fernsehen von Mouhcine El GhomriIm Land der Schwarzen Witwen
Das Gift der Schwarzen Witwe, einer der gefährlichsten Spinnenarten der Welt, ist 15 mal stärker als das der Klapperschlange. Doch kann diese Substanz, als Medizin eingesetzt, auch Leben retten. Um an das Gift zu gelangen, geht das Ehepaar Chuck und Anita Kristensen regelmäßig in der Wüste von Arizona auf Spinnenjagd. Neben den Schwarzen Witwen leben hier unzählige Gifttiere wie die Braune Einsiedlerspinne, Skorpione oder Riesentausendfüßer. Die Kristensens halten die gefangenen Tiere auf ihrer Farm. Dort werden sie gemolken und ihr Gift an Forschungseinrichtungen verkauft.Diese entwickeln daraus neue Medikamente – z.B. gegen Herzerkrankungen oder bestimmte Krebsarten. In den Boxen der „Spiderfarm“ tummeln sich je nach Bedarf bis zu 70.000 Tierchen. Denn die Kristensens züchten auch in großem Umfang Spinnen für die Pharmaindustrie. Eine Sisyphus-Arbeit: Jedes Tier muss in einer separaten Box aufgepäppelt werden, sonst würden sich die Spinnen gegenseitig auffressen. Der Film begleitet die Kristensens bei ihren nicht ungefährlichen Fangaktionen in der Wüste und bei der Aufzucht ihrer hochgiftigen „Haustiere“. (Text: WDR) Im Land der Tataren – Winter an der Wolga
Die liebenswerteste Gegend Russlands? Natürlich Tatarstan, da sind sich die meisten Landsleute einig. Regelmäßig geben sie ihrer Heimat Bestnoten als besonders liebenswerte Republik. Tatarstan, rund 800 Kilometer östlich von Moskau, wo Russland so russisch und doch so anders ist: wohlhabend, gepflegt und optimistisch. Hier leben Christen und Moslems friedlich miteinander. Rund die Hälfte der Bevölkerung gehört zu den Tataren und bekennt sich zum Islam. Der andere Teil ist russisch- und christlich-orthodox.Und alle wissen sich gut gegen den harten Winter zu wappnen. Der Film von Sven Jaax zeigt den rauen Alltag, wenn Frost und Schnee das Leben in Tatarstan fest im Griff haben. Manche Bewohner entwickeln unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen ganz besondere Leidenschaften. So wie Svetlana Kirichenko. Die resolute Russin zählt zu den einflussreichsten Geschäftsleuten in Tatarstans Hauptstadt Kasan. Svetlana investiert unter anderem in Kamele, die sie in Tatarstan neu angesiedelt hat. Die zuweilen eisigen Temperaturen sind für die Tiere kein Problem. Sie fühlen sich wohl und bescheren Svetlana russlandweit Aufmerksamkeit. Auf ihren Farmen werden die Tiere gezüchtet, gemolken, geschoren und geschlachtet. Die Wolle verarbeitet sie weiter und ist dafür sogar ins Textildesign eingestiegen. Yury Venediktov ist Rettungsmann und für die Sicherheit auf der Wolga zuständig. Sein wichtigstes Fortbewegungsmittel ist ein robustes Luftkissenboot. Damit kann er direkt vom Polizeihof auf den Fluss donnern. Im Winter machen ihm vor allem leichtsinnige Angler Sorgen. Jahr für Jahr verschwinden Petrijünger auf Nimmerwiedersehen, weil sie die Eisdecke auf dem Fluss überschätzt haben. Darum muss Yuri regelmäßig Patrouille fahren. Und dann ist da noch die Winterstraße über den Fluss. Yuri muss die Eisdicke prüfen und darf die Piste erst freigeben, wenn das Eis sicher trägt und kein Auto in der Wolga zu versinken droht. Auch Iljnur Latypov ist auf der Wolga unterwegs. Allerdings mit leichtem Gepäck. Er hat das Eis-Kiten in Tatarstan populär gemacht. Eigentlich ist er Physiker und sollte viel Zeit an der Uni zubringen. Aber wenn Wind und Wetter passen, muss das Labor warten. Sein Revier liegt direkt vor der Landeshauptstadt Kasan. Vor wenigen Jahren wurde Iljnur noch belächelt, wenn er mit selbst gebautem Brett und einfachem Drachen aufs Eis zog. Heute sind er und seine segelnden Freunde Stars in der Stadt. Radik Kadyrov wollte eigentlich nie „im Öl“ arbeiten. Doch nach 30 Jahren an den Förderpumpen könnte er sich heute keinen spannenderen Job mehr vorstellen. Jeden Tag drehen er und seine Männer Kontrollrunden zu den vielen Bohrlöchern im Land. Bei fast jedem Wetter. Nur wenn das Thermometer unter minus 50 Grad Celsius sinkt, darf Radik im Büro bleiben. Menschen wie ihm verdankt Tatarstan seinen Wohlstand. Die Republik ist reich durch Erdöl, man muss es nur sicher an die Oberfläche bringen und den Erlös sinnvoll ausgeben. Dafür gibt es in Radiks Heimatstadt Almetjevsk große Pläne: Die Bewohner sollen sich noch wohler fühlen. Gerade wird ein dichtes Netz aus Fahrradwegen gebaut, was für Russland sehr ungewöhnlich ist. Ali Suleimanov liebt Pferde auf seine ganz besondere Art: Er hält Exemplare einer seltenen tatarischen Rasse, er gibt kostenlosen Reitunterricht, er lädt Kinder zu freien Pferdeschlittenfahrten ein. Und: Er macht mit Leidenschaft Pferdewurst. Für ihn ist das kein Widerspruch. Pferde gehören seit Generationen zum Alltag. Da ist es für ihn nur folgerichtig, dass ihr Fleisch aus gegessen wird. Zu Sowjetzeiten waren Pferdefleischprodukte fast vollständig vom Speiseplan verschwunden. Dank Ali erlebt Pferdefleisch einen rasanten Wiederaufstieg in der Republik. Für europäische Tierfreunde klingt das befremdlich, für die meisten Tataren ist es ein Zeichen, dass ihre alte Kultur noch lebt. Der Film zeigt Menschen, die nicht nur in Tatarstan leben, sondern sich leidenschaftlich mit der Wolga-Republik verbunden fühlen: Frauen und Männer mit Pionier- und Unternehmergeist. (Text: NDR) Deutsche TV-Premiere Do. 10.01.2019 NDR Im Land der weißen Wölfe – Mit Arved Fuchs auf Ellesmere Island
30 bis 40 Grad minus, Biwakzelte als einzige Übernachtungsmöglichkeit, unter dem zweieinhalb Meter dicken Eis 800 Meter Polarmeer. Vor ihnen 1.000 Kilometer auf Skiern und mit dem Hundeschlitten. Das sind die Voraussetzungen, unter denen Arved Fuchs und sein Team aufbrechen, um Ellesmere Island, die nördlichste Insel der kanadischen Arktis, zu bezwingen. Arved Fuchs (54), deutscher Abenteurer und Polarexperte, hat sich sechs Wochen Zeit genommen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Ausgangspunkt ist die Wetterstation Eureka auf Ellesmere Island, die nördlichste Wetterstation der Welt. Von dort will er zunächst auf dem ewigen Eis, später quer durch die Insel über Hochgebirge und Gletscher zurück nach Eureka die Insel umrunden. Fuchs und sein Team haben mit Angriffen von Wölfen ebenso wie mit plötzlich einsetzender Wärme zu kämpfen; Tiefschnee, Eisschollen, Krankheiten und Erfrierungen. Gleichzeitig entschädigen die traumhaften Polarlandschaften für die Mühen. (Text: SWR)
zurückweiter
Erhalte Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer direkt auf dein Handy. Kostenlos per App-Benachrichtigung. Kostenlos mit der fernsehserien.de App.
Alle Neuigkeiten zu Länder – Menschen – Abenteuer und weiteren Serien
deiner Liste findest du in deinem
persönlichen Feed.